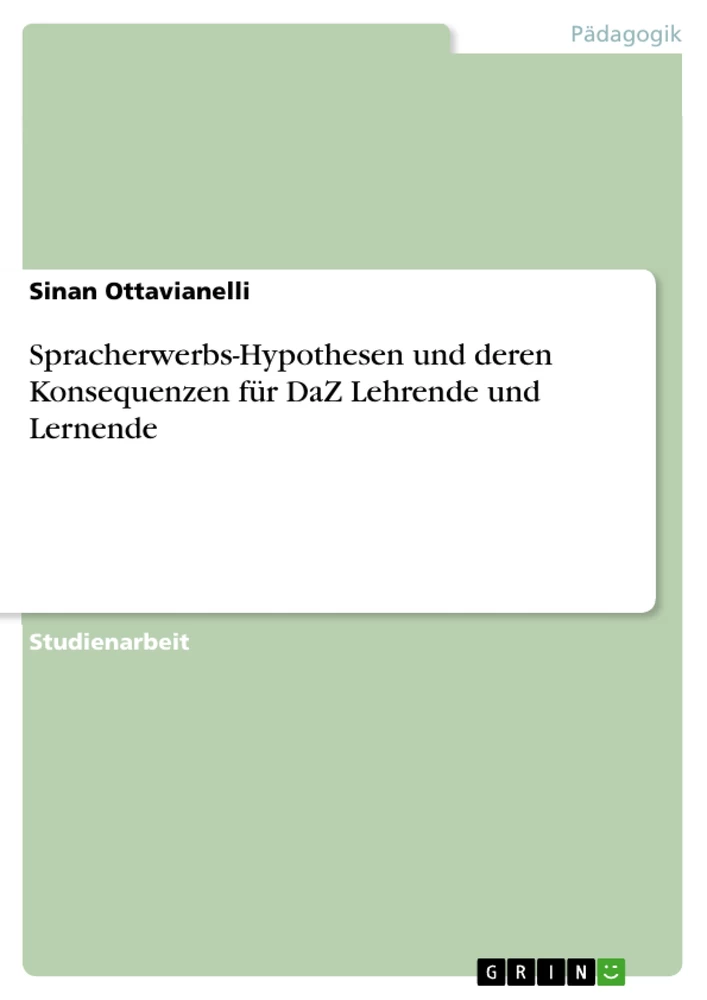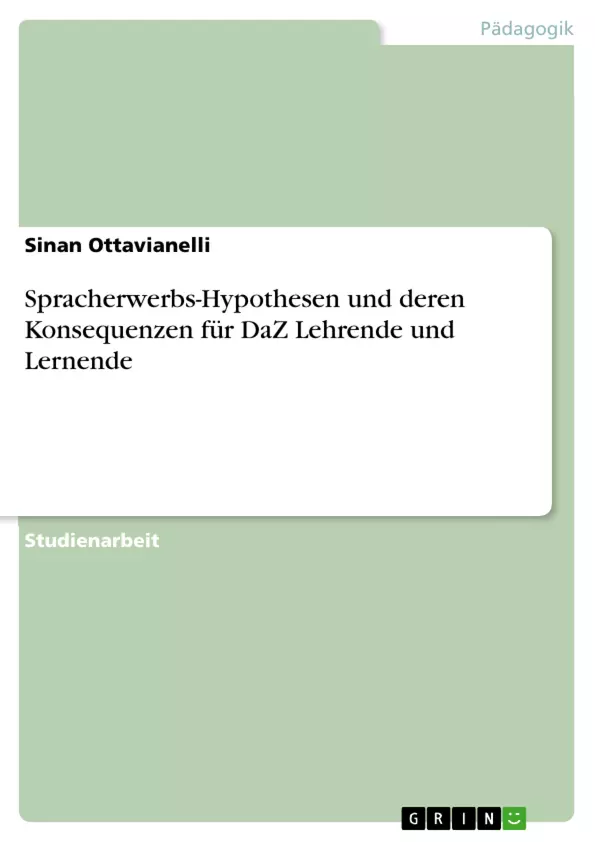Sprache – etwas Alltägliches, mit dem jeder von uns tagtäglich konfrontiert wird. Und doch wissen die meisten Leute kaum etwas darüber. Besonders nicht über den Erwerb einer Sprache (vor allem über den Erwerb einer Zweitsprache) beziehungsweise wie dieser verläuft.
Insbesondere aber für DaZ-Lehrende kann das Wissen über den Verlauf des Erwerbs einer Zweitsprache von großem Vorteil sein. Denn, wenngleich heutzutage wohl bekannt sein sollte, dass der Zweitspracherwerb auch maßgeblich mit der Erstsprache des Lernenden verbunden ist, so herrscht noch immer Unklarheit darüber, inwieweit Erst- und Zweitsprache in Verbindung miteinander stehen, wenn es um den Zweitspracherwerb geht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kontrastivhypothese
- Entstehung und Grundlage
- Kritik an der Kontrastivhypothese
- Die Identitätshypothese
- Entstehung und Grundlage
- Der Nativistische Ansatz (nach Chomsky)
- Kritik an der Identitätshypothese
- Die Interlanguage-Hypothese
- Entstehung und Grundlage
- Die Interimssprache und ihre Merkmale
- Entwicklungen der Interimssprache
- Fossilierungen
- Konsequenzen für den DaZ Unterricht/ die Praxis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht drei bedeutende Spracherwerbshypothesen – die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese und die Interlanguage-Hypothese – im Kontext des Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Unterrichts. Ziel ist es, die Entstehung, die Grundannahmen und die jeweilige Kritik an diesen Hypothesen zu beleuchten und deren Relevanz für die DaZ-Praxis zu diskutieren. Der nativistische Ansatz Chomskys wird im Zusammenhang mit der Identitätshypothese kurz erläutert.
- Die Kontrastivhypothese und ihre behavioristische Grundlage
- Die Identitätshypothese und der Einfluss des Nativismus
- Die Interlanguage-Hypothese und das Konzept der Interimsprache
- Kritik an den Spracherwerbshypothesen und deren empirische Überprüfung
- Implikationen für den DaZ-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Zweitspracherwerbs ein und betont die Bedeutung des Verständnisses von Spracherwerbsprozessen, insbesondere für DaZ-Lehrende. Sie hebt die Diskrepanz zwischen den Leistungen von DaZ- und Deutsch-als-Erstsprache-Lernenden hervor und verweist auf die Notwendigkeit, Spracherwerbshypothesen zu untersuchen, um den Lernprozess besser zu verstehen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Kontrastiv-, Identitäts- und Interlanguagehypothese, deren Kritik und deren Relevanz für die Unterrichtspraxis.
Die Kontrastivhypothese: Dieses Kapitel behandelt die Kontrastivhypothese, die auf einem behavioristischen Ansatz basiert. Sie geht davon aus, dass der Zweitspracherwerb stark von der Erstsprache beeinflusst wird. Übereinstimmungen zwischen Erst- und Zweitsprache führen zu positivem Transfer, Unterschiede zu negativem Transfer und Lernschwierigkeiten. Der Kapitel beleuchtet die Kritik an der starken Form der Hypothese, insbesondere ihren prognostischen Anspruch, der empirisch nicht bestätigt werden konnte. Es wird die abgeschwächte Version der Hypothese vorgestellt, die den interlingualen Transfer bei gleichzeitiger Berücksichtigung intralingualer Interferenzen berücksichtigt, jedoch den prognostischen Anspruch aufgibt.
Die Identitätshypothese: Dieses Kapitel beschreibt die Identitätshypothese und ihren Bezug zum nativistischen Ansatz Chomskys. Im Gegensatz zur Kontrastivhypothese betont sie die Unabhängigkeit des Zweitspracherwerbs von der Erstsprache und die Existenz angeborener sprachlicher Fähigkeiten. Der Nativismus Chomskys wird kurz erläutert, um den Hintergrund der Identitätshypothese besser zu verstehen. Die Kritik an der Identitätshypothese wird ebenfalls diskutiert, wobei die Grenzen des nativistischen Ansatzes im Kontext des Zweitspracherwerbs thematisiert werden.
Die Interlanguage-Hypothese: Das Kapitel widmet sich der Interlanguage-Hypothese, die den Zweitspracherwerb als einen dynamischen Prozess versteht, bei dem sich eine Interimsprache entwickelt. Es werden die Merkmale dieser Interimsprache und ihre Entwicklung beschrieben, einschließlich des Phänomens der Fossilierung. Die Interlanguage-Hypothese betont die eigenständige Entwicklung des Zweitsprachsystems des Lernenden und die Rolle von internalen Faktoren im Spracherwerbsprozess.
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguagehypothese, Nativismus, Chomsky, Interimsprache, Transfer, Interferenz, DaZ-Unterricht, Unterrichtspraxis, Lernschwierigkeiten, empirische Studien.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Spracherwerbshypothesen im DaZ-Unterricht
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über drei bedeutende Spracherwerbshypothesen – die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese und die Interlanguage-Hypothese – im Kontext des Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Unterrichts. Es analysiert deren Entstehung, Grundannahmen, Kritikpunkte und Relevanz für die DaZ-Praxis.
Welche Hypothesen werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese und die Interlanguage-Hypothese. Es beleuchtet jeweils deren Entstehung, Grundprinzipien und die dazugehörige Kritik.
Was ist die Kontrastivhypothese?
Die Kontrastivhypothese, basierend auf einem behavioristischen Ansatz, postuliert, dass der Zweitspracherwerb stark von der Erstsprache beeinflusst wird. Ähnlichkeiten führen zu positivem Transfer, Unterschiede zu negativem Transfer und Lernschwierigkeiten. Das Dokument diskutiert die Kritik an der starken Form der Hypothese und präsentiert die abgeschwächte Version.
Was ist die Identitätshypothese?
Die Identitätshypothese betont im Gegensatz zur Kontrastivhypothese die Unabhängigkeit des Zweitspracherwerbs von der Erstsprache und die Rolle angeborener sprachlicher Fähigkeiten. Der nativistische Ansatz Chomskys wird in diesem Zusammenhang erläutert, ebenso wie die Kritik an der Hypothese und die Grenzen des nativistischen Ansatzes im Kontext des Zweitspracherwerbs.
Was ist die Interlanguage-Hypothese?
Die Interlanguage-Hypothese versteht den Zweitspracherwerb als dynamischen Prozess mit der Entwicklung einer Interimsprache. Das Dokument beschreibt die Merkmale dieser Interimsprache, ihre Entwicklung und das Phänomen der Fossilierung. Die Hypothese betont die eigenständige Entwicklung des Zweitsprachsystems und die Rolle interner Faktoren.
Welche Rolle spielt Chomskys Nativismus?
Der nativistische Ansatz Chomskys wird im Zusammenhang mit der Identitätshypothese erläutert. Er bildet den theoretischen Hintergrund für die Annahme angeborener sprachlicher Fähigkeiten, die den Zweitspracherwerb unabhängig von der Erstsprache beeinflussen.
Welche praktischen Konsequenzen ergeben sich für den DaZ-Unterricht?
Das Dokument diskutiert die Implikationen der drei Hypothesen für den DaZ-Unterricht und die Praxis. Es zeigt auf, wie ein besseres Verständnis der Spracherwerbsprozesse zu einer effektiveren Gestaltung des Unterrichts beitragen kann.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Zweitspracherwerb, Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguagehypothese, Nativismus, Chomsky, Interimsprache, Transfer, Interferenz, DaZ-Unterricht, Unterrichtspraxis, Lernschwierigkeiten, empirische Studien.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen zu jeder Hypothese, einen Abschnitt zur Zielsetzung und zu den Themenschwerpunkten sowie eine Zusammenfassung der Schlüsselwörter.
- Arbeit zitieren
- Sinan Ottavianelli (Autor:in), 2018, Spracherwerbs-Hypothesen und deren Konsequenzen für DaZ Lehrende und Lernende, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/418922