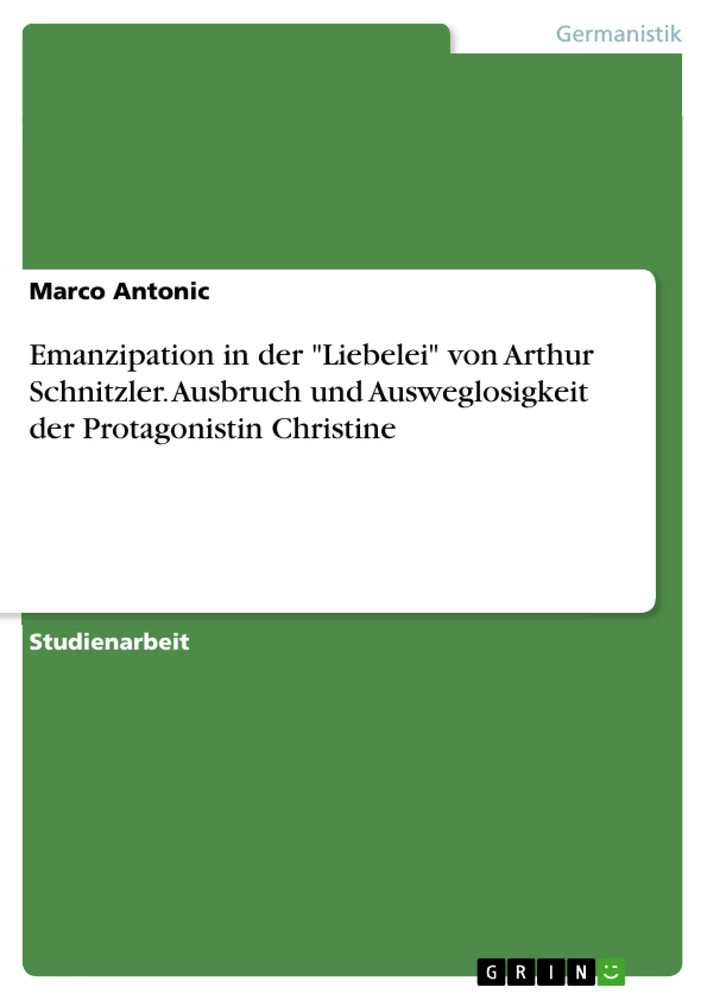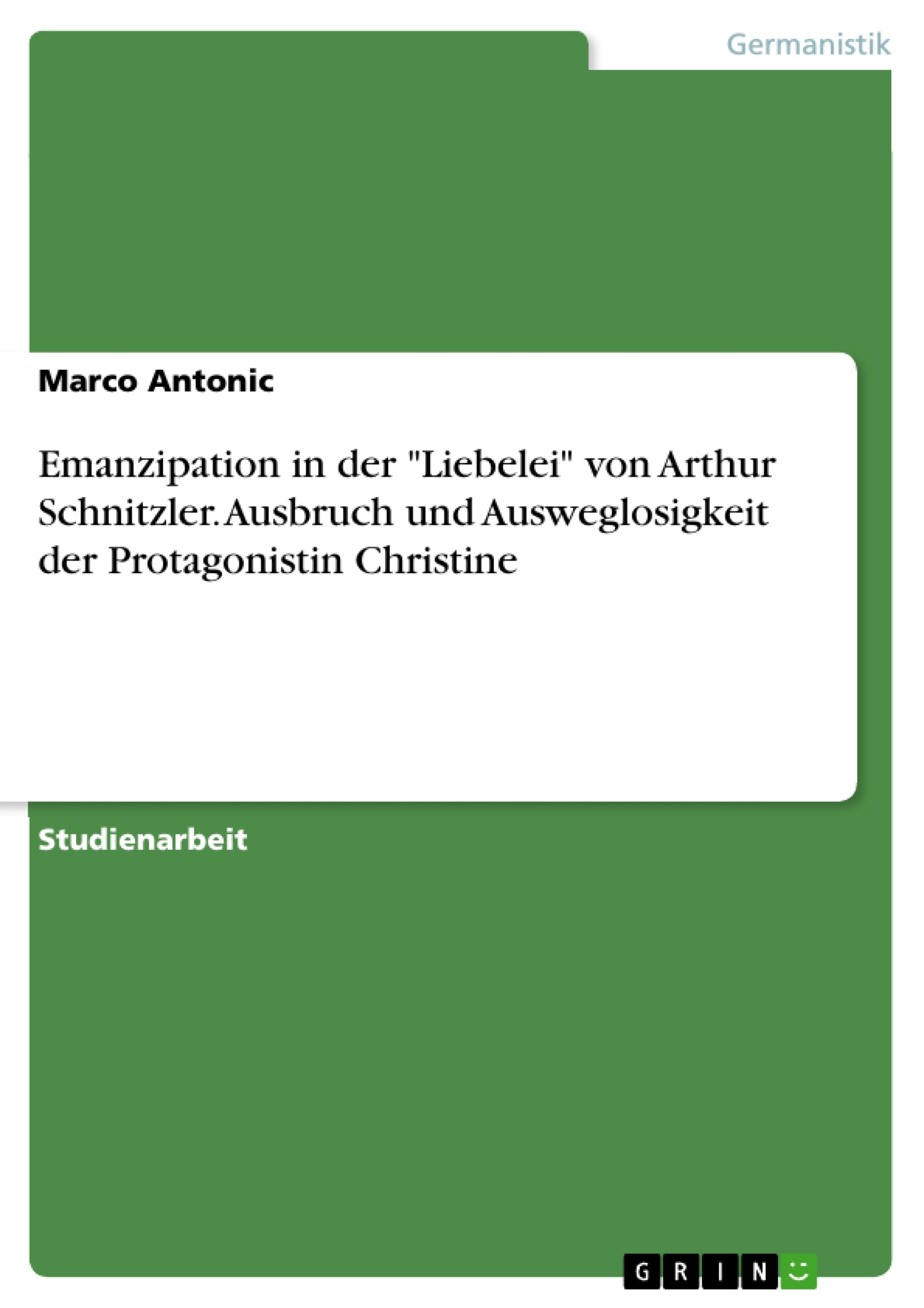[...] Schnitzler verstand sich als Anwalt der Frauen, jedoch musste er feststellen, dass eine Frau ihre innere Unzufriedenheit über ihre gesellschaftliche Unterdrückung nicht artikulieren konnte. An der Figur der Christine wird deutlich, dass sie ihre Situation zwar durchschaut, aber die oktroyierten Rollenzwänge nicht überwinden kann. Ihr Ausbruchsversuch aus den Konventionen hat nur die Rückkehr in männlich definierte Denk- und Verhaltensmuster zur Folge. Es soll gezeigt werden, dass ihr Ausbruch scheitern muss, da Christine außerhalb männlicher Normen nicht über eine eigene weibliche Authentizität verfügt. Ihre äußere Emanzipation bleibt aus, da sie in einem Zustand der Entfremdung von diesen Konventionen stehenbleibt. Ihre fehlende weibliche Authentizität in dieser Entfremdung führt schließlich zum Selbstmord, da Christine unfähig ist, in einer konventionslosen authentischen Realität zu existieren. Die Analyse nähert sich dieser Ausgangshypothese zunächst über die Darstellung der Situation der Frau. Hier werden die verschiedenen Unterdrückungsmechanismen aufgeführt, die Christine zu einer Emanzipation veranlassen. Die Beschreibungder zeithistorischen Hintergründe soll die Desillusionisierung von Christines Ausbruchsversuche durch gesellschaftliche Veränderungen und den Verlust einer kulturellen Identität erklären. Im dritten Kapitel wird zunächst anhand von Schnitzlers ambivalentem Frauenbild das Durchschauen ihrer Situation geschildert. Über ihre Versuche einer Rollendistanzierung und der Entlarvung der Fragwürdigkeit männlicher Denkmodelle wird die Parteinahme Schnitzlers für Christine deutlich. Im Anschluss daran wird abschließend die Unmöglichkeit der äußeren Artikulation ihrer durchschauten Situation erläutert. Über die Unterdrückung und Funktionalisierung von Christine soll die destruktive Seite von Schnitzlers ambivalentem Frauenbild zum Ausdruck kommen. Ihre Ausweglosigkeit durch die Gefangen- schaft in einem männlichen Wertesystem verhindert schließlich, dass es auch zu einer äußeren Emanzipation kommen kann. Die Forschungslage zum Thema Emanzipation bei Arthur Schnitzler ist recht unbefriedigend. Die emanzipatorische Substanz bei Schnitzlers Frauenfiguren wurde erstmals von Barbara Gutt im Jahre 1978 untersucht, die seinen Beitrag zu einer Überwindung der Situation der Frau anerkennt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die gesellschaftliche Situation der Frau und zeithistorische Hintergründe von Liebelei
- Die Problematik der weiblichen Identitätsfindung in einer männlichen Gesellschaftsordnung
- Im Spannungsverhältnis zwischen liberalen Einflüssen, dem Spiel mit der Liebe und dem Niedergang des Liberalismus
- Emanzipationsversuche der Protagonistin Christine
- Der Typus des süßen Mädels
- Die emanzipatorische Qualität des süßen Mädels
- Rollenbrechungen des süßen Mädels Christine und ihr Versuch der Lösung von gesellschaftlichen Konventionen
- Die Entlarvung der Unzulänglichkeit männlicher Denkmodelle
- Die Unmöglichkeit von Christines Emanzipation
- Rollenreduzierungen und die Unterdrückung von Autonomiebestrebungen
- Christines Gefangenschaft in der Klischeehaftigkeit der romantischen Liebe und der männlichen Interpretation weiblicher Liebesfähigkeit
- Christines Realitätsentfernung durch illusionäre Liebe und ihr Selbstmord als Ausdruck der Unmöglichkeit weiblicher Authentizität
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert den Ausbruchswunsch von Christine, der Protagonistin in Schnitzlers "Liebelei", aus einer männlich dominierten Gesellschaftsordnung im Wien des 19. Jahrhunderts. Er beleuchtet die Problematik der weiblichen Identitätsfindung in einer von männlichen Denk- und Verhaltensmustern geprägten Gesellschaft und analysiert die Unmöglichkeit von Christines Emanzipation.
- Weibliche Identitätsfindung in einer männlich dominierten Gesellschaft
- Emanzipationsversuche und ihre Grenzen
- Die Rolle von gesellschaftlichen Konventionen und Rollenbildern
- Die Ambivalenz von Schnitzlers Frauenbild
- Die Destruktivität männlicher Denkmodelle für die weibliche Autonomie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problematik der weiblichen Identitätsfindung in einer männlich dominierten Gesellschaftsordnung und die gesellschaftliche Situation der Frau im Österreich der Jahrhundertwende. Es zeigt auf, wie Unterdrückung und mangelnde Autonomie das Streben nach Emanzipation erschweren.
Das zweite Kapitel beschreibt den Typus des "süßen Mädels" und analysiert dessen emanzipatorisches Potenzial. Es untersucht die Versuche von Christine, sich aus den ihr vorgegebenen Rollen zu lösen und zeigt die Ambivalenz von Schnitzlers Frauenbild auf.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Unmöglichkeit von Christines Emanzipation, die durch die Unterdrückung ihrer Autonomiebestrebungen, die Gefangenschaft in der Klischeehaftigkeit der romantischen Liebe und die Realitätsentfernung durch illusionäre Liebe geprägt ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Emanzipation, weibliche Identitätsfindung, Liebelei, Arthur Schnitzler, österreichische Gesellschaft, Jahrhundertwende, Rollenbilder, "süßes Mädel", männliche Denkmodelle, Autonomie, Unterdrückung, romantische Liebe, Realitätsentfernung.
- Arbeit zitieren
- Marco Antonic (Autor:in), 2005, Emanzipation in der "Liebelei" von Arthur Schnitzler. Ausbruch und Ausweglosigkeit der Protagonistin Christine, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/39786