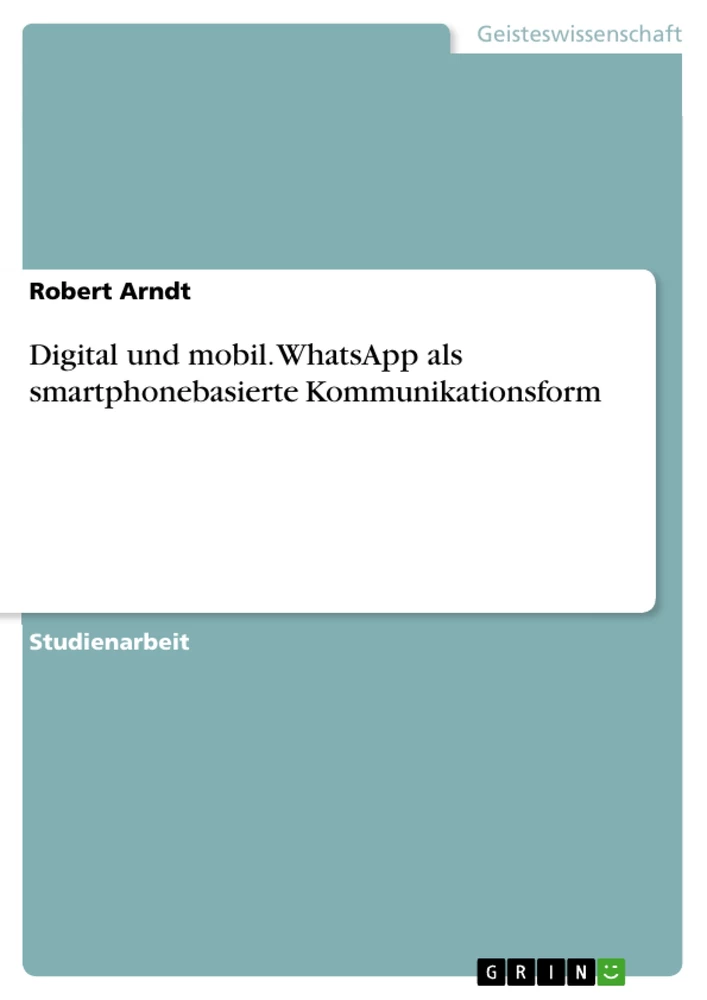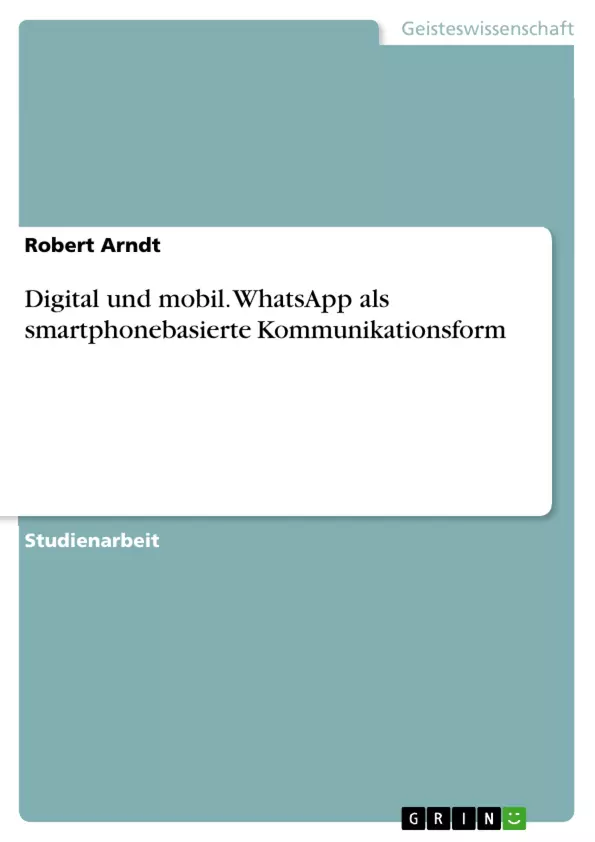Die digitale mobile Welt ist heutzutage vielseitig und farbenprächtig, da es unterschiedliche Kommunikationsformen gibt. Es existieren SMS, E-Mail und Chats, aber auch WhatsApp kam im Jahr 2009 hinzu. Die Popularität von WhatsApp ist gar nicht mehr aufzuhalten. Dieser Dienst ist sogar im Jahr 2015 am meisten heruntergeladen worden. Zudem zeigen gerade Jugendliche großes Interesse daran. Der Medienpädagogische Forschungsverband Südwest führte dazu eine JIM-Studie durch und fand heraus, dass 95% der Jugendlichen WhatsApp nutzen.
Zur Problematik der oben angesprochenen Kommunikationsformenvielfalt entwickelten Koch und Oesterreicher ein Modell, um einerseits eine Klassifikation hinsichtlich ihrer Charakteristika vorzunehmen, andererseits sie voneinander zu differenzieren. Aufgrund der Begeisterung gegenüber diesem Dienst ist es lohnenswert, sich in diesem Zusammenhang die Fragen zu stellen: Lässt sich WhatsApp als neu dazugekommene smartphonebasierte Kommunikationsform nach diesem Modell beschreiben und wie sieht der Forschungstand dazu aus?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mündlichkeit und Schriftlichkeit aus sprachtheoretischer Sicht
- 2.1 Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsmodell nach Koch/Oesterreicher (1985)
- 2.1.1 Medium und Konzeption
- 2.1.2 Sprache der Nähe und Sprache der Distanz
- 2.2 Kritik am Modell
- 2.3 Erweiterung des Modells nach Dürscheid (2003)
- 3. Charakteristische Merkmale von Smartphonebasierter Kommunikation
- 3.1 WhatsApp versus SMS
- 3.2 Abgrenzung von WhatsApp gegenüber Chats
- 4. Mediale und konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit bei WhatsApp – Forschungsstand
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einordnung von WhatsApp in bestehende Modelle der Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Ziel ist es, die smartphonebasierte Kommunikationsform WhatsApp anhand des Modells von Koch/Oesterreicher (1985) zu analysieren und den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema darzustellen.
- Klassifizierung von WhatsApp im Kontext mündlicher und schriftlicher Kommunikation
- Analyse des Modells von Koch/Oesterreicher (1985) und dessen Kritikpunkte
- Vergleich von WhatsApp mit SMS und Chats
- Bewertung des Forschungsstands zur medialen und konzeptionellen Mündlichkeit/Schriftlichkeit von WhatsApp
- Diskussion der Eignung des Modells zur Beschreibung neuer Kommunikationsformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der vielseitigen digitalen Kommunikationsformen ein und hebt die besondere Popularität von WhatsApp hervor, insbesondere bei Jugendlichen. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Einordnung von WhatsApp in bestehende Modelle der Mündlichkeit und Schriftlichkeit und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die wachsende Bedeutung von WhatsApp im Kontext anderer Kommunikationsmittel wie SMS und E-Mail wird hervorgehoben und die Notwendigkeit einer eingehenden Untersuchung begründet.
2. Mündlichkeit und Schriftlichkeit aus sprachtheoretischer Sicht: Dieses Kapitel erläutert das Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsmodell von Koch/Oesterreicher (1985), welches auf der Unterscheidung zwischen Medium (gesprochen/geschrieben) und Konzeption (mündlich/schriftlich) basiert. Es werden die dichotomische Natur des Mediums und das Kontinuum der Konzeption detailliert beschrieben. Die Kapitel analysieren das Modell kritisch und zeigen die Erweiterung durch Dürscheid (2003) auf, die eine differenziertere Betrachtung ermöglicht.
3. Charakteristische Merkmale von Smartphonebasierter Kommunikation: Dieses Kapitel vergleicht WhatsApp mit SMS und grenzt es von Chat-Kommunikationen ab. Es beleuchtet die spezifischen Merkmale von WhatsApp, wie z.B. die Möglichkeit von Multimedia-Nachrichten, Gruppenchats und Echtzeit-Benachrichtigungen. Der Vergleich verdeutlicht die Positionierung von WhatsApp im Spektrum der digitalen Kommunikationsformen und hebt seine Besonderheiten hervor.
4. Mediale und konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit bei WhatsApp – Forschungsstand: Das Kapitel präsentiert den aktuellen Forschungsstand zur Einordnung von WhatsApp in Bezug auf Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Es analysiert, inwiefern die bestehenden Modelle die spezifischen Merkmale von WhatsApp adäquat beschreiben können und diskutiert die Herausforderungen bei der Klassifizierung dieser neuen Kommunikationsform. Die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln werden hier zusammengeführt und im Kontext der aktuellen Forschung bewertet.
Schlüsselwörter
WhatsApp, Smartphone-basierte Kommunikation, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Koch/Oesterreicher-Modell, Dürscheid-Modell, digitale Kommunikation, SMS, Chat, Medienwandel, JIM-Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von WhatsApp im Kontext von Mündlichkeit und Schriftlichkeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Kommunikationsform WhatsApp im Hinblick auf bestehende Modelle der Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Sie untersucht, wie WhatsApp in diese Modelle eingeordnet werden kann und welche spezifischen Merkmale diese Einordnung beeinflussen.
Welche Modelle der Mündlichkeit und Schriftlichkeit werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich primär auf das Modell von Koch/Oesterreicher (1985), welches die Unterscheidung zwischen Medium (gesprochen/geschrieben) und Konzeption (mündlich/schriftlich) vornimmt. Zusätzlich wird die Erweiterung dieses Modells durch Dürscheid (2003) berücksichtigt, die eine differenziertere Betrachtung ermöglicht.
Wie wird WhatsApp in Bezug auf Mündlichkeit und Schriftlichkeit klassifiziert?
Die Arbeit untersucht die mediale und konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit von WhatsApp anhand des gewählten Modells. Es wird analysiert, inwieweit die Merkmale von WhatsApp (z.B. Multimedia-Nachrichten, Gruppenchats, Echtzeit-Benachrichtigungen) mit den Kriterien der Modelle übereinstimmen und wie diese Kommunikationsform dadurch eingeordnet werden kann.
Welche weiteren Kommunikationsformen werden mit WhatsApp verglichen?
WhatsApp wird im Vergleich zu SMS und Chat-Kommunikation betrachtet, um seine spezifischen Eigenschaften und seine Positionierung im Spektrum der digitalen Kommunikationsformen herauszuarbeiten.
Welche Kritikpunkte an den Modellen werden angesprochen?
Die Arbeit diskutiert kritische Punkte des Modells von Koch/Oesterreicher (1985) und zeigt auf, wie die Erweiterung durch Dürscheid (2003) zu einer differenzierteren Betrachtung beiträgt. Es wird auch die Frage diskutiert, inwieweit die bestehenden Modelle überhaupt geeignet sind, neue Kommunikationsformen wie WhatsApp adäquat zu beschreiben.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Einordnung von WhatsApp in die bestehenden Modelle der Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Weitere Fragen betreffen den Vergleich mit ähnlichen Kommunikationsformen (SMS, Chat), die Bewertung des Forschungsstands und die Eignung der Modelle zur Beschreibung neuer Kommunikationsformen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur sprachtheoretischen Betrachtung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit (inkl. der Modelle von Koch/Oesterreicher und Dürscheid), ein Kapitel zu den Merkmalen smartphonebasierter Kommunikation mit einem Vergleich von WhatsApp, SMS und Chat, ein Kapitel zum Forschungsstand bezüglich WhatsApp und ein abschließendes Ausblick-Kapitel.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: WhatsApp, Smartphone-basierte Kommunikation, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Koch/Oesterreicher-Modell, Dürscheid-Modell, digitale Kommunikation, SMS, Chat, Medienwandel, JIM-Studie.
- Arbeit zitieren
- Robert Arndt (Autor:in), 2017, Digital und mobil. WhatsApp als smartphonebasierte Kommunikationsform, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/396468