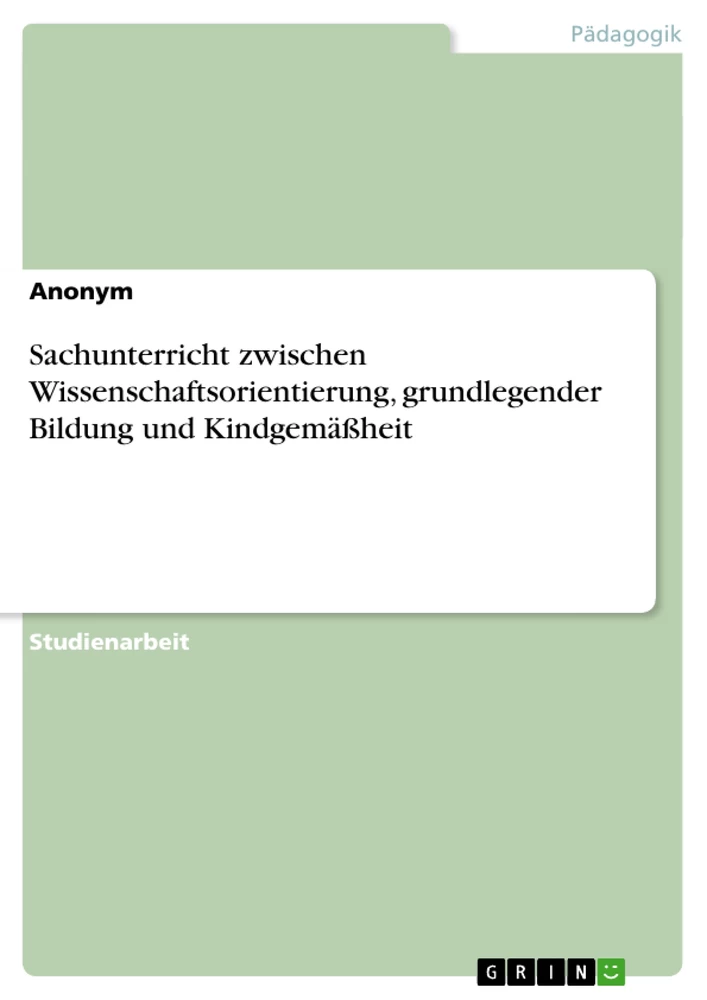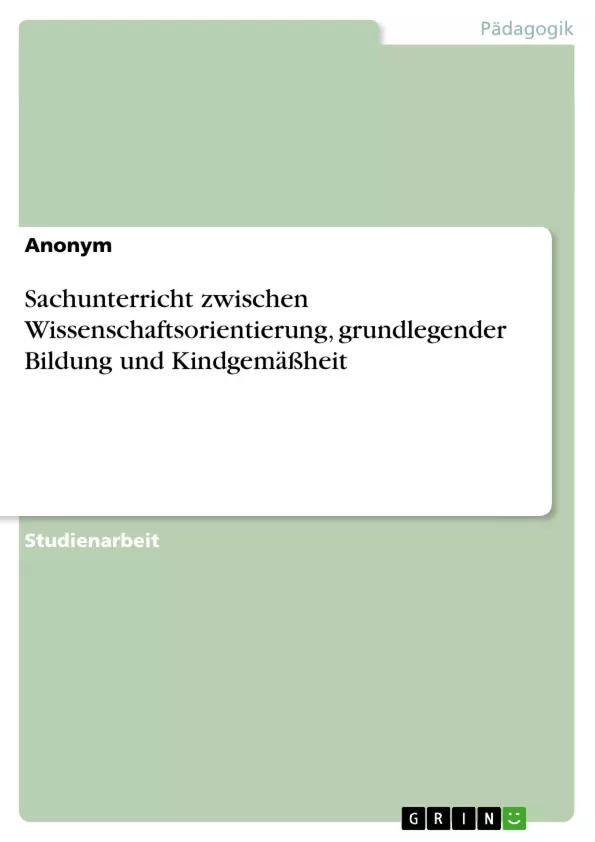Der Sachunterricht hat im Laufe seiner Entwicklung verschiedene Richtungen eingeschlagen und sich an unterschiedlichen Denkweisen orientiert. Die Heimatkunde, geprägt von der sogenannten "Kindgemäßheit", wurde von der Wissenschaftsorientierung der 70er Jahre abgelöst. Diese großen Akzente der Geschichte des Sachunterrichts, aber auch viele weitere kleinschrittigere Denkrichtungen haben sich auf die Gestaltung des Sachunterrichts bis heute ausgewirkt. Das neueste Schlagwort, das den Sachunterricht der Zukunft sicherlich ebenfalls weitreichend beeinflussen wird, ist die von Walter Köhnlein neu definierte "Grundlegende Bildung". In der folgenden Arbeit sollen die Denkansätze der "Grundlegenden Bildung" und der "Wissenschaftsorientierung" vorgestellt werden. Ausgangspunkt für W. Köhnlein ist "die gesellschaftliche Bedeutung des Bildungsbegriffs". Er versteht die pädagogische Aufgabe der Schule darin, die "Grundzüge einer Kultur" an die Schüler zu vermitteln. Bildung soll sich also auf die "Gemeinsamkeiten in einer Kultur" beziehen. Durch deren Betrachtung und durch den Einblick in ihre Strukturen und Inhalte sollen die Schüler dazu befähigt werden, sich orientieren zu können. Dies scheint ihm besonders wichtig, da sich unsere Gesellschaft als vielschichtig, pluralistisch darstellt mit "durchaus widerstreitende(n) Vorstellungen", die es Kindern heute schwer macht, ihren Standpunkt in ihr zu finden. Daher erhebt er Bildung "zur Leitkategorie für den Aufbau des Weltverständnisses junger Menschen". Zur Beantwortung der Frage, was Kindern nun vermittelt werden soll und nach welchen Prinzipien das geschenhen könnte, zieht W. Köhnlein Tenorth und Heymann heran, die den Begriff "allgemeine Bildung" "als die konkrete (pädagogische) Aufgabe... ein Bildungsminimum für alle zu sichern und zugleich die Kultivierung von Lernfähigkeit zu eröffnen" definiert haben. Dabei zielt der Begriff der allgemeine Bildung auf das Wesentliche unserer Kultur ab, auf die "Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fähigkeiten". Denn erst wenn diese als solche erkannt und als Konzepte schematisiert werden konnten, bietet sich dem Schüler die Möglichkeit, sich selbst darin einzuorden, seinen Standpunkt zu diesen Grunddimensionen für sich zu erkennen, zu finden oder auch abzuändern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundlegende Bildung
- 1.1 Definition
- 1.2 Inhalte und Ziele grundlegender Bildung im Sachunterricht
- 1.2.1 Inhalte grundlegender Bildung
- 1.2.2 Ziele grundlegender Bildung allgemein
- 1.2.3 Ziele grundlegender Bildung im Sachunterricht
- 1.2.3.1 Erkundung und kulturelle Rekonstruktion von Welt
- 1.2.3.2 Formale Bildung
- 1.3 Gestaltung
- 1.3.1 Das exemplarische Prinzip
- 1.3.2 Das genetische Prinzip
- 1.3.3 Ziele der didaktischen Prinzipien
- 1.4 Beispiel eines Planungsmodells
- 2. Wissenschaftsorientierung
- 2.1 Der Bayerische Lehrplan von 1971
- 2.1.1 Vorgeschichte
- 2.1.2 Vorgaben der Präambel des Lehrplans von 1971
- 2.1.3 Inhalte und Ziele
- 2.1.4 Kritik am Bayerischen Lehrplan von 1971
- 2.1.5 Umorientierung und Umbennenung von Sachunterricht in Heimat- und Sachkunde
- 2.2 Der Bayerische Lehrplan für die Grundschule von 1981
- 2.2.1 Merkmale des Bay. LP '81
- 2.2.2 Neuerungen des Bay. Lehrplans von 1981 gegenüber dem Bay. Lehrplan von 1971
- 2.2.3 Heimat- und Sachkunde im Bay. Lehrplan von 1981
- 2.2.4 Konsequenzen für den Lehrer
- 2.2.5 Neuerungen im Unterricht
- 2.2.6 Wissenschaftsorientierung im Unterricht
- 2.3.1 Begriff „Wissenschaftsorientierter Unterricht“
- 2.3.2 Merkmale des wissenschaftsorientierten Unterrichts
- 2.3.3 Ziele des wissenschaftsorientierten Unterrichts
- 2.4 Geschlossene Curricula
- 2.4.1 „Science Curriculum Improvement Study“ (SCIS)
- 2.4.2 Science - A Process Approach (S-APA)
- 2.5 Offene Curricula
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entwicklung des Sachunterrichts in Deutschland, insbesondere die Paradigmenwechsel zwischen der „Kindgemäßheit“ der Heimatkunde und der Wissenschaftsorientierung der 70er Jahre. Im Fokus steht der Vergleich der Konzepte „Grundlegende Bildung“ und „Wissenschaftsorientierung“ im Sachunterricht der Grundschule. Die Arbeit analysiert die jeweiligen Inhalte, Ziele und didaktischen Prinzipien beider Ansätze und bewertet deren Bedeutung für die Gestaltung des modernen Sachunterrichts.
- Grundlegende Bildung als pädagogisches Konzept
- Wissenschaftsorientierung im Sachunterricht
- Vergleichende Analyse verschiedener Lehrpläne
- Didaktische Prinzipien im Sachunterricht
- Entwicklung des Sachunterrichts im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Grundlegende Bildung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der „Grundlegenden Bildung“ nach Walter Köhnlein, der die gesellschaftliche Bedeutung des Bildungsbegriffs betont und Bildung als Vermittlung der „Grundzüge einer Kultur“ versteht. Es analysiert die Notwendigkeit eines Bildungsminimums für alle Schüler und diskutiert die Kultivierung der Lernfähigkeit. Der Fokus liegt auf der Ermöglichung der Orientierung in einer pluralistischen Gesellschaft, wobei die Schüler befähigt werden sollen, ihren eigenen Standpunkt zu den „Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fähigkeiten“ zu finden und zu entwickeln. Die „Grundlegende Bildung“ wird als Anfang und Basis der allgemeinen Bildung verstanden, welche legitime öffentliche und individuelle Bedürfnisse und Interessen berücksichtigt. Die Ansätze von Kahlert und Rabenstein werden vorgestellt, die den Aspekt des grundlegenden Lernens aus verschiedenen Perspektiven beleuchten (fachliche und pädagogische Grundlegungsfunktion).
2. Wissenschaftsorientierung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Wissenschaftsorientierung im Sachunterricht, beginnt mit einer Analyse des Bayerischen Lehrplans von 1971, dessen Vorgeschichte, Inhalte, Ziele und Kritikpunkte beleuchtet werden. Die Umorientierung und Umbenennung von Sachunterricht in Heimat- und Sachkunde wird erörtert. Der Bayerische Lehrplan von 1981 wird im Detail untersucht, seine Merkmale, Neuerungen im Vergleich zum Lehrplan von 1971 und die daraus resultierenden Konsequenzen für den Unterricht und den Lehrer werden analysiert. Der Abschnitt zur Wissenschaftsorientierung im Unterricht definiert den Begriff „Wissenschaftsorientierter Unterricht“ und beschreibt seine Merkmale und Ziele. Schließlich werden geschlossene Curricula wie SCIS und S-APA sowie offene Curricula im Kontext der Wissenschaftsorientierung diskutiert.
Schlüsselwörter
Grundlegende Bildung, Wissenschaftsorientierung, Sachunterricht, Lehrplan, Heimat- und Sachkunde, didaktische Prinzipien, exemplarische Prinzip, genetische Prinzip, Bayerischer Lehrplan, Curricula, Bildungsminimum, Lernfähigkeit, pluralistische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Grundlegende Bildung vs. Wissenschaftsorientierung im Sachunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Entwicklung des Sachunterrichts in Deutschland, insbesondere den Paradigmenwechsel zwischen der „Kindgemäßheit“ der Heimatkunde und der Wissenschaftsorientierung der 1970er Jahre. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der Konzepte „Grundlegende Bildung“ und „Wissenschaftsorientierung“ im Sachunterricht der Grundschule. Analysiert werden die Inhalte, Ziele und didaktischen Prinzipien beider Ansätze und deren Bedeutung für den modernen Sachunterricht.
Welche Konzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Konzepte „Grundlegende Bildung“ und „Wissenschaftsorientierung“ im Hinblick auf ihre Ausprägungen im Sachunterricht der Grundschule. Dabei werden die jeweiligen Inhalte, Ziele und didaktischen Prinzipien beider Ansätze untersucht.
Was versteht die Arbeit unter „Grundlegender Bildung“?
Der Begriff „Grundlegende Bildung“ wird nach Walter Köhnlein definiert, der Bildung als Vermittlung der „Grundzüge einer Kultur“ versteht. Es geht um ein Bildungsminimum für alle Schüler, die Kultivierung der Lernfähigkeit und die Ermöglichung der Orientierung in einer pluralistischen Gesellschaft. Die Schüler sollen ihren eigenen Standpunkt zu den „Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fähigkeiten“ finden und entwickeln. Die „Grundlegende Bildung“ bildet die Basis der allgemeinen Bildung und berücksichtigt legitime öffentliche und individuelle Bedürfnisse und Interessen. Die Ansätze von Kahlert und Rabenstein werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird die „Wissenschaftsorientierung“ im Sachunterricht dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung der Wissenschaftsorientierung im Sachunterricht, beginnend mit einer Analyse des Bayerischen Lehrplans von 1971 (Vorgeschichte, Inhalte, Ziele, Kritik). Die Umorientierung und Umbenennung von Sachunterricht in Heimat- und Sachkunde wird erörtert. Der Bayerische Lehrplan von 1981 wird detailliert untersucht (Merkmale, Neuerungen gegenüber dem Lehrplan von 1971, Konsequenzen für Unterricht und Lehrer). Der Begriff „Wissenschaftsorientierter Unterricht“ wird definiert, seine Merkmale und Ziele beschrieben. Geschlossene (SCIS, S-APA) und offene Curricula im Kontext der Wissenschaftsorientierung werden diskutiert.
Welche Lehrpläne werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Bayerischen Lehrplan von 1971 und den Bayerischen Lehrplan für die Grundschule von 1981. Der Vergleich dieser Lehrpläne dient dazu, die Entwicklung der Konzepte „Grundlegende Bildung“ und „Wissenschaftsorientierung“ im Sachunterricht zu beleuchten.
Welche didaktischen Prinzipien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das exemplarische und das genetische Prinzip im Kontext der didaktischen Prinzipien des Sachunterrichts. Die Ziele dieser Prinzipien werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grundlegende Bildung, Wissenschaftsorientierung, Sachunterricht, Lehrplan, Heimat- und Sachkunde, didaktische Prinzipien, exemplarische Prinzip, genetische Prinzip, Bayerischer Lehrplan, Curricula, Bildungsminimum, Lernfähigkeit, pluralistische Gesellschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst mindestens zwei Kapitel: Kapitel 1 befasst sich mit „Grundlegender Bildung“ und Kapitel 2 mit „Wissenschaftsorientierung“. Jedes Kapitel enthält Unterkapitel mit detaillierten Analysen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 1999, Sachunterricht zwischen Wissenschaftsorientierung, grundlegender Bildung und Kindgemäßheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/39028