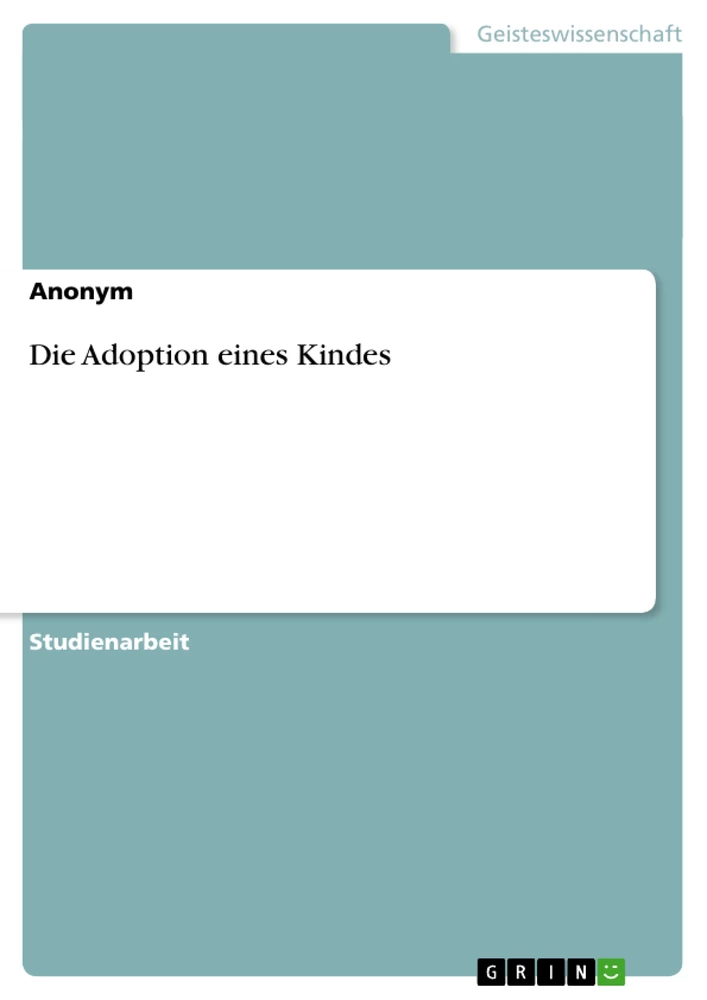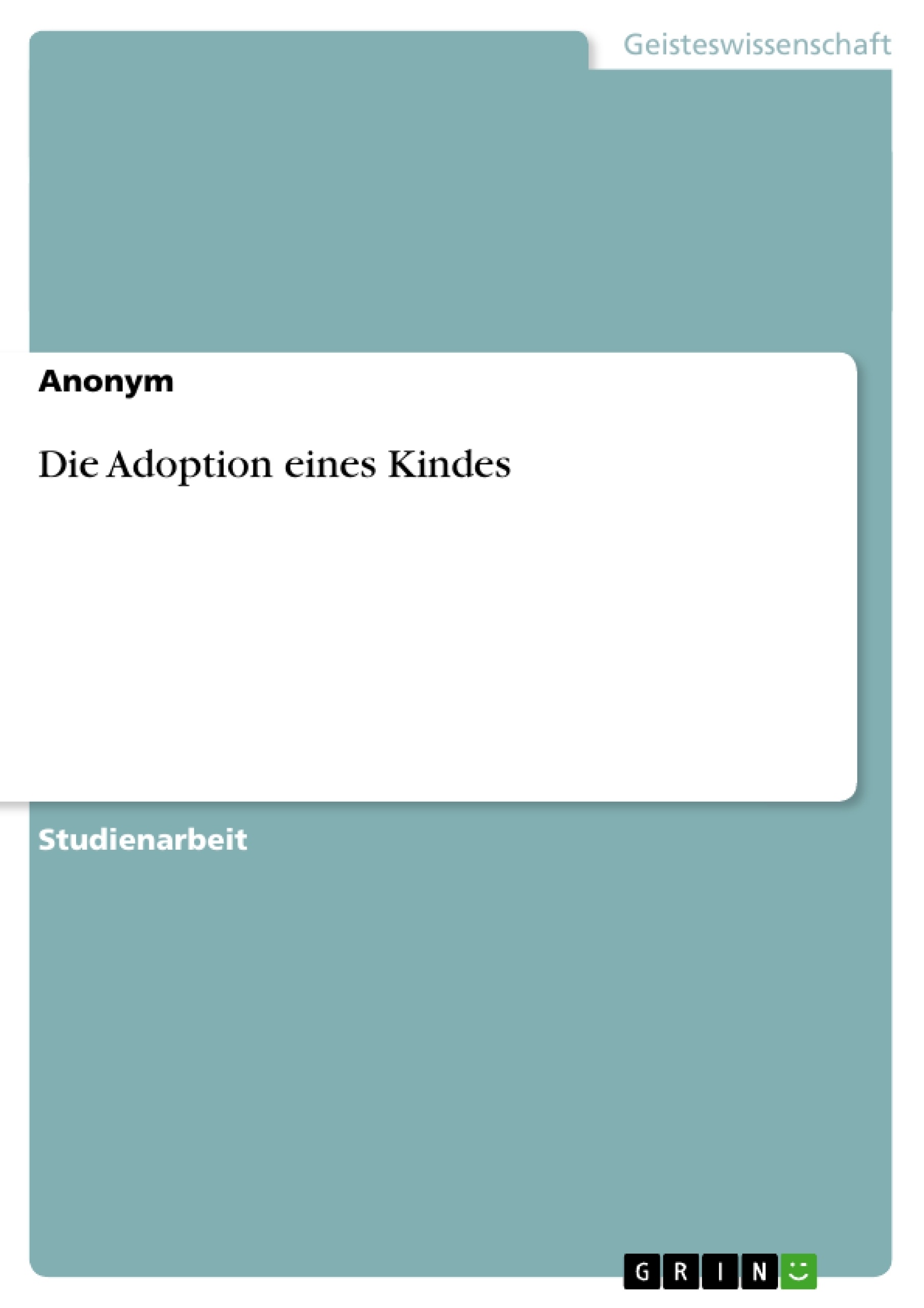[...] Früher, etwa zur Entstehungszeit des BGB, diente eine Adoption vorwiegend dazu, „kinderlosen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Namen und ihr Vermögen an die nächste Generation weiterzugeben“ (von Münch, 1992, S.14). Die Adoption diente demzufolge nicht dazu, familienlosen Kindern ein neues Zuhause zu geben, sondern wurde vielmehr von der Vorstellung, „Kinder für Eltern zu suchen“ geprägt (Wiemann, 1991, S. 192). Voraussetzungen für eine Adoption waren nach altem Recht ein relativ hohes Alter (ursprünglich 50 Jahre) und Kinderlosigkeit. Die Annahme kam durch einen Vertrag zwischen dem Annehmenden und dem gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Kindes zustande. Die leibliche Familie des Kindes spielte dabei keine Rolle. Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Kind und seinen leiblichen Verwandten blieben nach der Annahme weiterhin bestehen, die leiblichen Eltern waren lediglich nicht mehr sorge- und unterhaltspflichtig für ihren Sprößling. Nach heutigem Recht soll eine Adoption nicht mehr „den Fortbestand des Namens und Vermögens sichern“ (Palandt, 54. Aufl., S. 1699), sondern dazu dienen, einem Kind, das bisher ein gesundes Zuhause entbehren mußte, eine Familie zu geben, in der es voll integriert wird. Die Adoption ist demnach in erster Linie ein Mittel der Fürsorge für elternlose und verlassene Kinder. Im Gegensatz zu früher wird sie nach dem Grundsatz, Eltern für ein bestimmtes Kind zu finden, definiert. Seit 1. 1. 1977, dem Wirksamwerden des revidierten Adoptionsrechts, basiert sie auf der Begründung eines Eltern - Kind - Verhältnisses und soll ausschließlich dem Wohl des Kindes dienen. Durch die Neuregelung des Adoptionsgesetzes wurde nicht nur die soziale Stellung des Kindes verbessert, sondern auch die rechtliche. Eine Annahme kommt nicht mehr durch einen „einfachen“ Vertrag zustande, sondern durch einen gerichtlichen Beschluß (Dekretsystem). Außerdem erlöschen mit Ausspruch der Adoption die alten Verwandtschaftsverhältnisse vollständig (Volladoption). „Damit sollen die neuen Eltern und das Kind die Sicherheit erhalten, die für ein gedeihliches Familienleben notwendig ist“ (BT - Drucks 7/3061, S. 2). Im folgenden werde ich kurz die zwei verschiedenen Adoptionsformen vorstellen, die Voraussetzungen und das Zustandekommen einer Annahme ebenso wie eventuelle Auswirkungen einer Adoption erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die zwei verschiedenen Adoptionsformen
- Inkognito Adoption
- Offene Adoptionen
- Voraussetzungen einer Annahme
- Rechtliche Voraussetzungen
- Adoptionspflegeverhältnis als besondere Voraussetzung der Annahme als Kind
- Zustandekommen einer Adoption
- Adoptionsvermittlungsstellen
- Die Adoptionspflege
- Die richterliche Entscheidung
- Auswirkungen einer Adoption
- Probleme der Adoptivfamilie
- Psychosoziale Folgen für das Kind
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der juristischen Regulierung der Familie in Bezug auf Gleichberechtigung, Lebensgemeinschaften und Kinderrechte. Der Fokus liegt dabei auf der Adoption eines minderjährigen Kindes. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen der Adoption, die Voraussetzungen für eine Annahme, das Zustandekommen einer Adoption und die Auswirkungen einer Adoption auf die betroffenen Familien und Kinder.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Adoption in Deutschland
- Die unterschiedlichen Formen der Adoption (Inkognito-Adoption, offene Adoption)
- Die Bedeutung des Kindeswohls als zentrale Voraussetzung für eine Adoption
- Die Rolle von Adoptionspflege und Adoptionsvermittlungsstellen
- Die psychosozialen Folgen einer Adoption für das Kind
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff der Adoption und erläutert die historische Entwicklung des Adoptionsrechts in Deutschland. Sie beleuchtet die veränderten Zielsetzungen der Adoption im Laufe der Zeit, vom Fokus auf die Interessen der Annehmenden hin zur Konzentration auf das Kindeswohl.
- Die zwei verschiedenen Adoptionsformen: Dieses Kapitel stellt die zwei gängigen Adoptionsformen vor: die Inkognito-Adoption, bei der die leiblichen Eltern nicht über die Identität der Adoptiveltern informiert werden, und die offene Adoption, die einen Kontakt zwischen den Familien ermöglicht. Die Vor- und Nachteile beider Formen werden beleuchtet.
- Voraussetzungen einer Annahme: Das Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Voraussetzungen für eine Adoption. Die zentrale Bedingung, das Kindeswohl, wird näher definiert. Es werden die rechtlichen Anforderungen an die Annehmenden und die Besonderheiten des Adoptionspflegeverhältnisses erläutert.
- Zustandekommen einer Adoption: Hier werden die verschiedenen Schritte des Adoptionsverfahrens beschrieben, von der Vermittlung durch Adoptionsvermittlungsstellen über die Adoptionspflege bis hin zur richterlichen Entscheidung. Die Rolle der Jugendämter und die rechtlichen Aspekte des Verfahrens werden dargestellt.
- Auswirkungen einer Adoption: Das Kapitel analysiert die möglichen Auswirkungen einer Adoption auf die Adoptivfamilie und das Kind. Es werden Herausforderungen und Probleme, die in Adoptivfamilien auftreten können, sowie die psychosozialen Folgen für das Kind beleuchtet.
Schlüsselwörter
Adoption, Kindeswohl, Inkognito-Adoption, offene Adoption, Adoptionspflege, Adoptionsvermittlung, rechtliche Voraussetzungen, Familienrecht, Kindesentwicklung, psychosoziale Folgen, Adoptionsprozess, Familienleben, Integration, soziale Stellung, Rechtsgeschichte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 1998, Die Adoption eines Kindes, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/38627