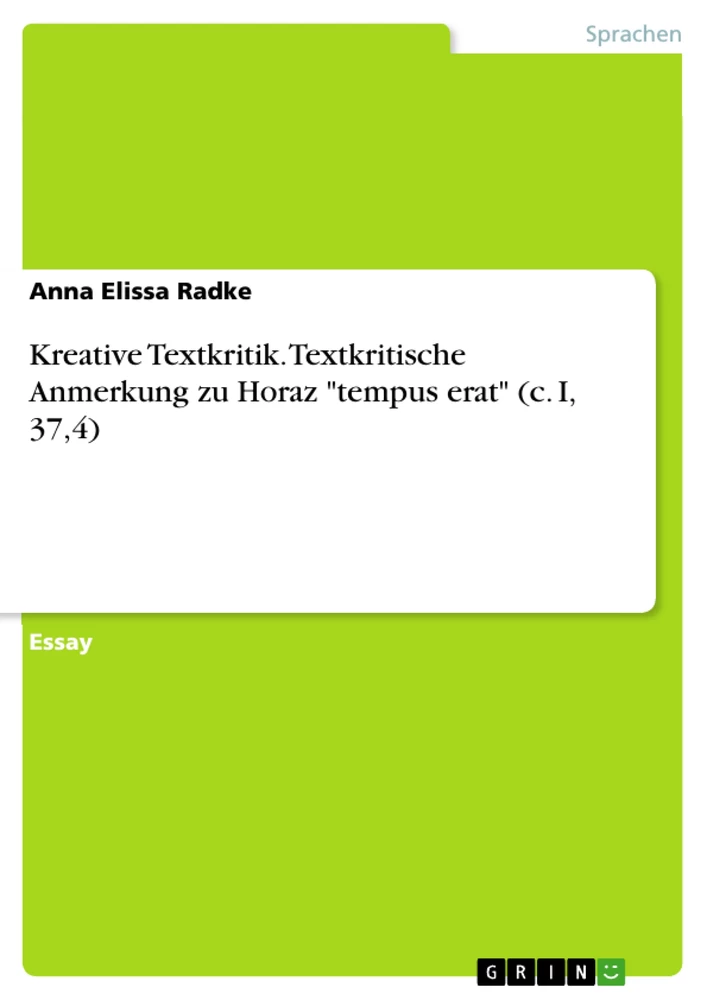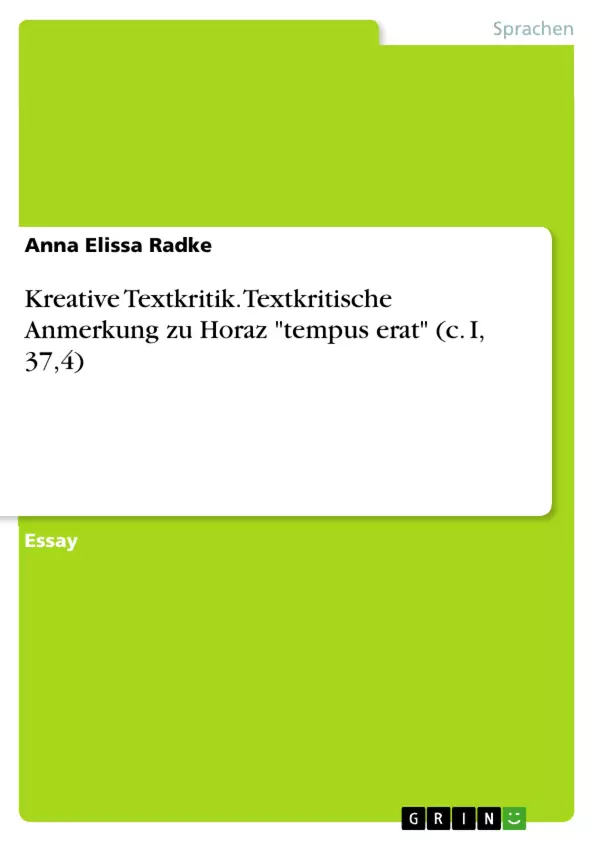Es geht um eine textkritische Analyse unter Einbeziehung eines kreativen Umgangs mit Latein.
Auf den ersten Lehrstuhl für Poetik an der neugegründeten ersten evangelischen Universität wurde Helius Eobanus Hessus 1536 nach Marburg berufen, der bereits als 10jähriger in der Lateinschule von Frankenberg bemerkte, dass der Bibelvers Joh. 12, 42 (in der Vulgata-Version) „qui sequitur me, non ambulat in tenebris.“ ein Pentameter ist, was seinen Lehrer Horlaeus aufhorchen ließ – zu Recht, wie der Werdegang seines Schülers zeigt, der wohl eine ähnlich natürliche Begabung für Versmelodien hatte wie Ovid (quid temptabam scribere versus erat).
Und so war es auch ein von Ovid inspiriertes Werk, das Eobanus den Lehrstuhl einbrachte: seine christlichen Heroides, in denen weibliche Heilige Briefe schreiben, wie z.B. die heilige Elisabeth an ihren Gatten Ludwig, der zu einem Kreuzzug aufgebrochen war. Und die letzte Epistel dieser Heroides ist überschrieben: „Eobanus posteritate“, worauf ich ihm nach über 400 Jahren geantwortet habe: „Anna Elissa Eobano“.
Was aber hat diese Anekdote aus der Kindheit des Eobanus und des Ovid mit meinen textkritischen Anmerkungen zu einem Horaz-Gedicht zu tun?
Inhaltsverzeichnis
- Kreative Textkritik
- Zu Horaz, c. 1, 37, 4: tempus erat
- Als ich meinen Weg hin zur Betrachtung der vielfach interpretierten Horaz-Stelle „tempus erat“ (c. 1, 37, 4) nachzeichnen:
- Ad inaugurationem et symposium seminarii philologici Marburgensis
- Das Gedicht ist gleichsam mit doppeltem Faden - wie ein Norwegerpullover - gestrickt: der eine Faden strickt das „neue Gedicht“, und der andere Faden ist die immer mitlaufende Tradition der antiken Dichtung, der nur hin und wieder an die rechte Oberfläche geholt wird:
- Aber jeder Philologe stutzt bei meiner Formulierung „tempus adest“ statt des gewohnten horazischen „tempus erat“. Und mancher stutzt vielleicht nicht nur, sondern ist empört über meine Anmaßung, den heiligen Horaztext, zu dem keine zweite Lesart überliefert ist, verbessern zu wollen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit von Anna Elissa Radke widmet sich einer kreativen und innovativen Herangehensweise an die Textkritik, indem sie die Bedeutung der dichterischen Begabung für die philologische Arbeit hervorhebt. Sie plädiert dafür, dass Philologen, um Texte tiefgreifend zu verstehen, selbst kreativ mit Sprache umgehen und sich in einen Dialog mit den antiken Dichtern begeben müssen.
- Die Rolle der kreativen Sprachbeherrschung in der Philologie
- Die Bedeutung von „Imitatio und Aemulatio“ für die Textinterpretation
- Der Vergleich von Konjekturen von Renaissance-Philologen mit materiellen Lesarten
- Die Interpretation der Horaz-Stelle „tempus erat“
- Das Verhältnis von Tradition und Innovation in der Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Autorin beginnt mit einer persönlichen Anekdote über Helius Eobanus Hessus, um die Wichtigkeit der kreativen Begabung für philologische Arbeit zu betonen. Sie argumentiert, dass der Verlust der aktiven Sprachbeherrschung bei Philologen zu einer Verarmung der Textinterpretation geführt hat.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Interpretation der Horaz-Stelle „tempus erat“ (c. 1, 37, 4). Die Autorin analysiert verschiedene Interpretationen und zeigt auf, wie sie selbst zu einer neuen Lesart gelangt ist, indem sie sich von verschiedenen Quellen, wie dem Studentenlied „Cohors generosa, turba studiosa“, dem Horaz-Zitat „ornate pulvinar deorum/ tempus erat dapibus, sodales!“ und der Tradition des „Ave Caesar, morituri te salutant“, inspirieren ließ.
Radke zeigt, dass die „kreative Textkritik“ zu einer neuen und tieferen Lesart des Horaz-Textes führen kann, indem sie die Bedeutung der dichterischen Tradition und des zeitgenössischen Kontexts berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Kreative Textkritik, Philologie, Dichterische Begabung, „Imitatio und Aemulatio“, Horaz, „tempus erat“, Konjekturen, Renaissance-Philologie, Tradition, Innovation, Lateinische Dichtung, Studentenlied, „Ave Caesar, morituri te salutant“, Interpretation.
- Arbeit zitieren
- Anna Elissa Radke (Autor:in), 2017, Kreative Textkritik. Textkritische Anmerkung zu Horaz "tempus erat" (c. I, 37,4), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/385521