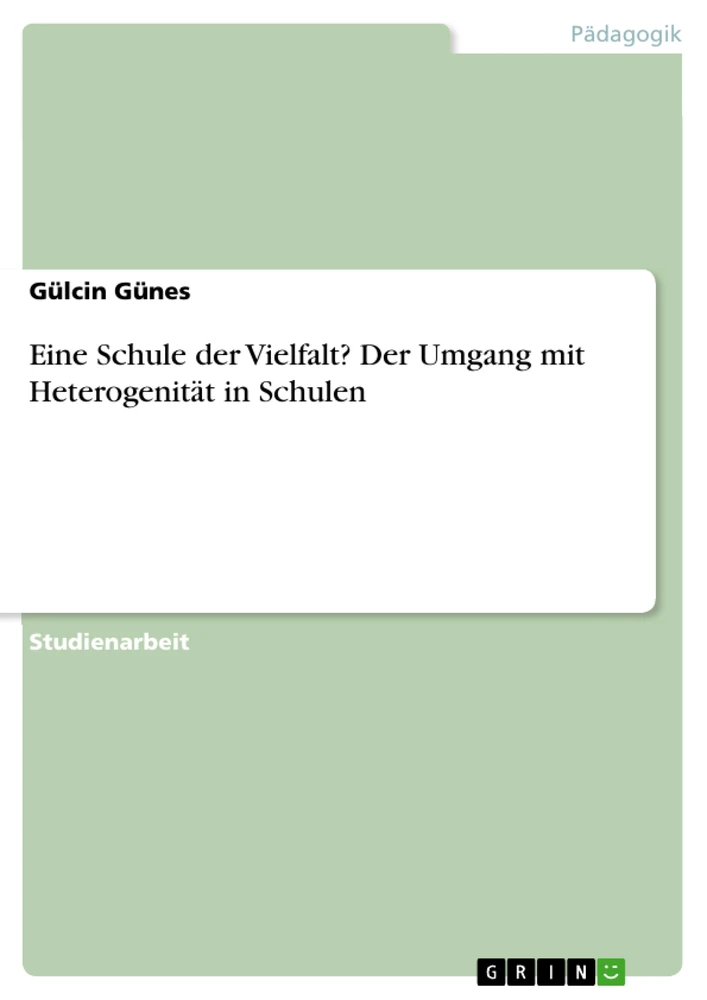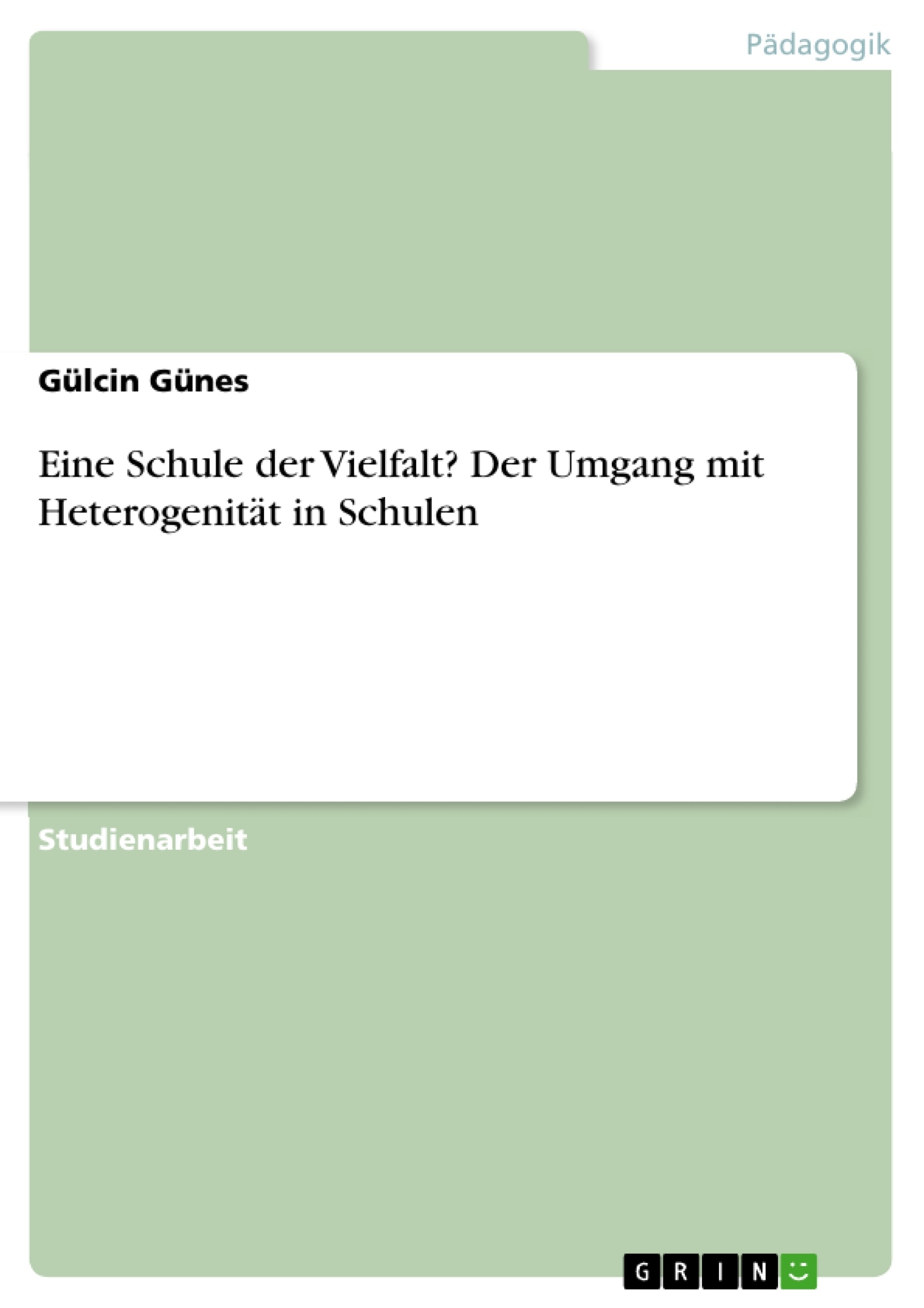Mit der hier vorliegenden Hausarbeit möchte ich deshalb untersuchen, wie mit Heterogenität in den Schulen umgegangen wird. Vorweg möchte ich jedoch konstatieren, dass Bestandteil dieser Hausarbeit ausschließlich das Thema „Umgang mit Heterogenität in der Schule“ ist und andere Sichtweisen zu dem Thema Heterogenität nicht in den Blick genommen werden.
Das Thema „Umgang mit Heterogenität“ ist nicht nur eines der wichtigsten Themen im Alltag der Menschen, sondern auch eines der relevantesten Themen bei der anstehenden Umstrukturierung des deutschen Schulwesens. Das Erfassen der begleitenden Chancen und Risiken von Heterogenität war schon immer ein Thema der Schulpädagogik. In der heutigen Zeit wird dem Thema Heterogenität und dem Umgang mit ihr in der Schule, im Unterricht und in der Gesellschaft aktuelle Bedeutung beigemessen. Im Mittelpunkt von verschiedenen pädagogischen Veröffentlichungen steht die Forderung nach einem effizienten Umgang mit Heterogenität. Schlagworte, wie „Individuelle Förderung, neue Lernkultur, Flexibilisierung von Bildungswesen und Chancengleichheit“ treten gleichlaufend in Erscheinung und werden dabei verschiedenartig und kontrovers debattiert. Häufig wird dabei die Verschiedenheit der Schüler und Schülerinnen betont, welche ein unterrichtspraktisches Problem darstellt.
Die Unterschiedlichkeit der Schüler und Schülerinnen in Schulen wird weniger akzeptiert als in Kindergärten oder Grundschulen, da in den Schulen der vermittelte Lernstoff im Mittelpunkt steht und nicht die Schüler und Schülerinnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Heterogenität
- Heterogenität im schulischen Kontext
- Dimensionen der Heterogenität in der Schule
- Unterschiedliche Umgangsweisen mit Heterogenität
- Modelle zum Umgang mit Heterogenität
- Das Separierungsmodell
- Das Anpassungsmodell
- Das Ergänzungsmodell
- Übertragung der Modelle auf das Konzept „Schule“
- Die Koedukationsdebatte
- Die interkulturelle Debatte
- Die Integrationsdebatte
- Modelle zum Umgang mit Heterogenität
- Kritik am deutschen Bildungssystem
- Inklusive Schule als Gegenmodell
- Index für Inklusion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie mit Heterogenität in Schulen umgegangen wird. Sie zielt darauf ab, verschiedene Modelle und Ansätze zum Umgang mit Heterogenität im schulischen Kontext zu analysieren und zu bewerten. Dabei wird der Fokus auf die Herausforderungen und Chancen von Heterogenität im deutschen Bildungssystem gelegt.
- Begriffsbestimmung von Heterogenität und deren Relevanz im schulischen Kontext
- Untersuchung verschiedener Modelle zum Umgang mit Heterogenität (Separierungsmodell, Anpassungsmodell, Ergänzungsmodell)
- Kritik am deutschen Bildungssystem im Hinblick auf den Umgang mit Heterogenität
- Inklusive Schule als Gegenmodell zum traditionellen Bildungssystem
- Analyse des Index für Inklusion als Instrument zur Bewertung der Inklusionsfähigkeit von Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Das einleitende Kapitel stellt das Thema der Heterogenität und dessen Relevanz für das deutsche Bildungssystem vor. Es wird die Bedeutung des Umgangs mit Heterogenität in der heutigen Zeit hervorgehoben und auf die verschiedenen Facetten von Heterogenität eingegangen.
Kapitel 2: Begriffsbestimmung
Dieses Kapitel erläutert den Begriff „Heterogenität“ in seiner allgemeingültigen Bedeutung und beleuchtet dessen Bedeutung im schulischen Kontext. Es werden verschiedene Dimensionen von Heterogenität in der Schule aufgezeigt, die sich auf die individuellen Voraussetzungen und Lernbedürfnisse der Schüler und Schülerinnen beziehen.
Kapitel 3: Unterschiedliche Umgangsweisen mit Heterogenität
Das dritte Kapitel stellt verschiedene Modelle zum Umgang mit Heterogenität vor, darunter das Separierungs-, das Anpassungs- und das Ergänzungsmodell. Es werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle diskutiert und deren Übertragbarkeit auf das Konzept „Schule“ beleuchtet.
Kapitel 4: Kritik am deutschen Bildungssystem
In diesem Kapitel werden kritische Punkte des deutschen Bildungssystems im Hinblick auf den Umgang mit Heterogenität angesprochen. Es werden die Herausforderungen und Defizite des Systems beleuchtet und die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung des Bildungswesens im Hinblick auf Inklusion und Vielfalt betont.
Kapitel 5: Inklusive Schule als Gegenmodell
Das fünfte Kapitel stellt das Konzept der inklusiven Schule als Gegenmodell zum traditionellen Bildungssystem vor. Es werden die zentralen Elemente der inklusiven Schule erläutert und die Bedeutung des Index für Inklusion als Bewertungsinstrument für Schulen hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Heterogenität im Bildungssystem und greift dabei Schlüsselbegriffe wie Inklusion, Diversität, Individualisierung, Differenzierung und Chancengleichheit auf. Sie befasst sich mit unterschiedlichen Modellen zum Umgang mit Heterogenität und analysiert die kritischen Punkte des deutschen Bildungssystems im Hinblick auf seine Fähigkeit, der Vielfalt von Lernbedürfnissen gerecht zu werden.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Gülcin Günes (Autor:in), 2017, Eine Schule der Vielfalt? Der Umgang mit Heterogenität in Schulen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/383649