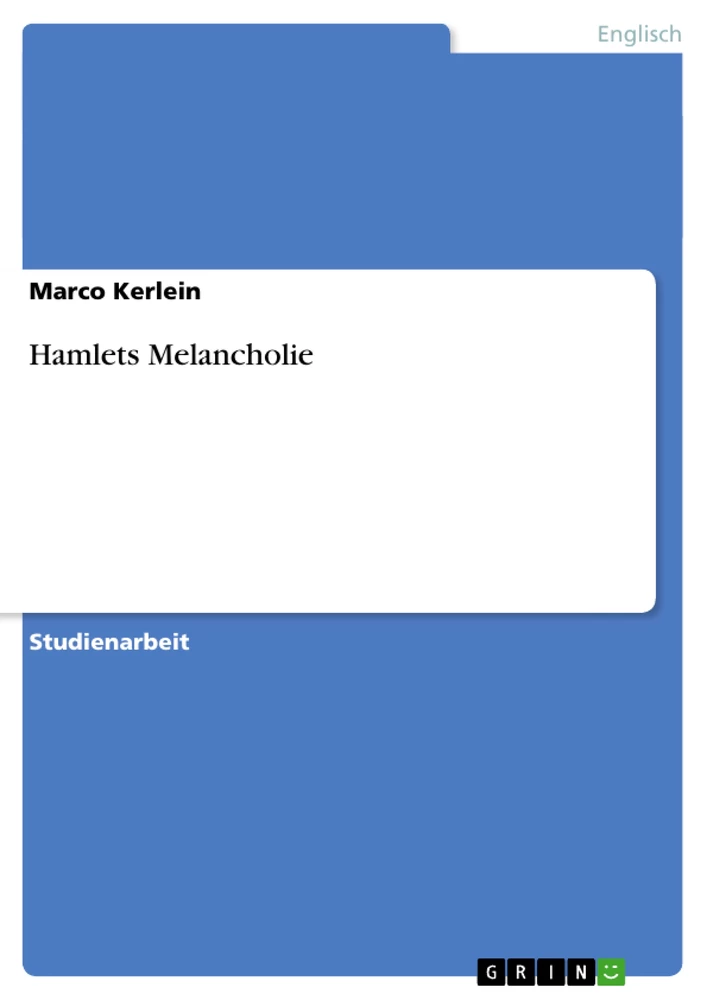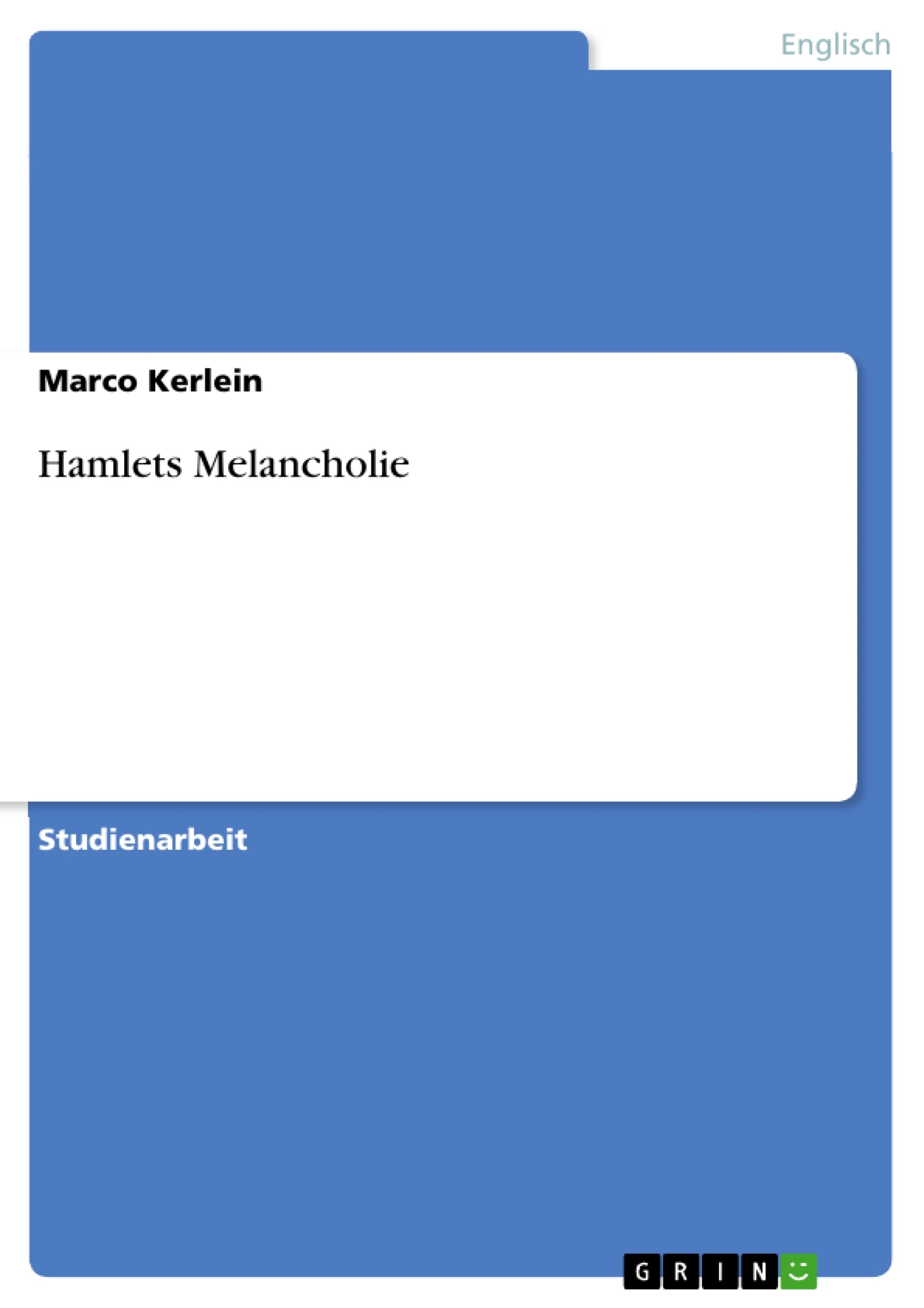Dass Shakespeare über außerordentliche Kenntnisse der menschlichen Seele verfügt haben muss ist unbestritten. Er formte die Personen seiner Stücke so detailliert und differenziert, dass man meinen könnte, er habe der Schaffung seiner Charaktere tiefgründige psychologische Studien des humanen Geistes zu Grunde gelegt. ‚Hamlet’ ist eines der berühmtesten Stücke der Weltliteratur, der Protagonist eine der undurchdringlichsten und zugleich faszinierendsten Personen, die Shakespeare entwarf. Dies liegt nicht zuletzt an der vielschichtigen Psyche Hamlets. Der Dänenprinz schwankt in dem Stück zwischen manischer Depression, Melancholie und Trauer auf der einen Seite und Rachegelüsten, Abscheu und vorgetäuschtem Wahnsinn auf der anderen Seite. Diese Arbeit untersucht den Gemütszustand Hamlets im Bezug auf seine Melancholie in den ersten beiden Akten. Grundlagen der Untersuchung bilden die elisabethanische Humoralpathologie und die moderne Definition der Melancholie, die in Sigmund Freuds Abhandlung ‚Trauer und Melancholie’ ihren Ursprung hat. Da die Begriffsbestimmung der Melancholie laut Freud auch in der deskriptiven Psychiatrie schwankend ist, wird in diesem Text auf pedantische Differenzierungen von psychologischen Fachtermini verzichtet. Welche Gründe und Anlässe für Hamlets Melancholie gibt es, wie äußert sich seine seelische Störung und welche Auswirkungen hat sie auf Hamlet und seine Umgebung? Dies sind die Fragen, denen ich in diesem Aufsatz nachgehen will. Ausgangspunkt der Analysen bilden die Texte von Bert O. States, Theodore Lidz und A.C. Bradley. Ursprünglich sollte das ganze Stück auf Hamlets Melancholie untersucht werden, dies war aber aus Zeitgründen nicht möglich, daher beschränke ich mich auf genauere Untersuchungen von Hamlets Trauer am Anfang des Stückes und ihrem Wandel hin zur Melancholie und Hamlets seelischen Gleichgewichtsschwankungen, vornehmlich im zweiten Akt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Melancholiebegriff
- 2.1. Der elisabethanische Melancholiebegriff
- 2.2. Der freudsche Melancholiebegriff
- 3. Hamlets Melancholie
- 3.1. Hamlets Trauer am Anfang des Stücks
- 3.2. Hamlets Stimmungsschwankungen
- 4. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hamlets Gemütszustand, insbesondere seine Melancholie, in den ersten beiden Akten von Shakespeares Hamlet. Die Analyse basiert auf der elisabethanischen Humoralpathologie und Freuds Konzept der Melancholie. Ziel ist es, die Gründe und Auslöser von Hamlets Melancholie zu ergründen, ihre Manifestation zu beschreiben und ihre Auswirkungen auf Hamlet und sein Umfeld zu beleuchten.
- Hamlets Melancholie als Ausdruck seelischer Konflikte
- Der elisabethanische und der freudsche Melancholiebegriff im Vergleich
- Analyse von Hamlets Stimmungsschwankungen und deren Ursachen
- Die Auswirkungen von Hamlets Melancholie auf sein Handeln und seine Beziehungen
- Die Bedeutung von Hamlets Melancholie für das Verständnis des Stücks
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen, der Manifestation und den Auswirkungen von Hamlets Melancholie in den ersten beiden Akten vor. Sie betont Shakespeares detaillierte Charakterzeichnung und die vielschichtige Psyche Hamlets, der zwischen Depression, Melancholie, Trauer und Rachegelüsten schwankt. Die Arbeit bezieht sich auf die elisabethanische Humoralpathologie und Freuds Konzept der Melancholie als theoretische Grundlagen. Die Begrenzung der Analyse auf die ersten beiden Akte wird aufgrund von zeitlichen Einschränkungen begründet.
2. Der Melancholiebegriff: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Bedeutungen des Melancholiebegriffs im Laufe der Geschichte. Es vergleicht den elisabethanischen Verständnis von Melancholie, das auf der Humoralpathologie basiert, mit Freuds moderner Definition. Der elisabethanische Melancholiebegriff wird detailliert erläutert, wobei die vier Körpersäfte (Blut, gelbe Galle, Schleim und schwarze Galle) und deren Einfluss auf das Temperament des Menschen im Zentrum stehen. Die Bedeutung des Ungleichgewichts der Körpersäfte und deren Verbindung zu Eigenschaften wie Traurigkeit, Misstrauen und Stimmungsschwankungen wird herausgestellt. Der Vergleich mit Freuds Konzept dient als Grundlage für die anschließende Analyse von Hamlets Zustand.
3. Hamlets Melancholie: Dieses Kapitel analysiert Hamlets Melancholie in den ersten beiden Akten des Dramas. Es beginnt mit einer Untersuchung von Hamlets Trauer zu Beginn des Stücks und verfolgt die Entwicklung zu seiner Melancholie. Der Fokus liegt auf der Analyse von Hamlets Stimmungsschwankungen und ihren Ursachen, wobei die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln über den Melancholiebegriff angewendet werden. Die Auswirkungen von Hamlets seelischer Verfassung auf sein Handeln und seine Beziehungen zu anderen Figuren werden untersucht. Konkrete Szenen und Dialoge werden herangezogen, um die Argumentation zu stützen.
Schlüsselwörter
Hamlet, Melancholie, elisabethanische Humoralpathologie, Freud, Trauer, Stimmungsschwankungen, manisch-depressive Verstimmung, Shakespeare, Psychologische Analyse, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Hamlets Melancholie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Hamlets Gemütszustand, insbesondere seine Melancholie, in den ersten beiden Akten von Shakespeares Hamlet. Sie untersucht die Ursachen, die Manifestation und die Auswirkungen seiner Melancholie auf Hamlet und sein Umfeld.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Analyse basiert auf der elisabethanischen Humoralpathologie und Freuds Konzept der Melancholie. Diese beiden Perspektiven werden verglichen und auf Hamlets Zustand angewendet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Melancholiebegriff (mit Unterkapiteln zum elisabethanischen und freudschen Verständnis), ein Kapitel zur Analyse von Hamlets Melancholie (mit Fokus auf Stimmungsschwankungen und deren Ursachen) und abschließende Schlussbetrachtungen. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Was wird im Kapitel "Der Melancholiebegriff" behandelt?
Dieses Kapitel vergleicht den elisabethanischen Melancholiebegriff, basierend auf der Humoralpathologie (vier Körpersäfte und deren Einfluss auf das Temperament), mit Freuds moderner Definition. Es erläutert detailliert das elisabethanische Verständnis und die Bedeutung des Ungleichgewichts der Körpersäfte.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels "Hamlets Melancholie"?
Dieses Kapitel analysiert Hamlets Melancholie anhand konkreter Szenen und Dialoge aus den ersten beiden Akten. Es untersucht die Entwicklung seiner Trauer zu Melancholie, seine Stimmungsschwankungen und deren Ursachen, sowie die Auswirkungen seiner seelischen Verfassung auf sein Handeln und seine Beziehungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hamlet, Melancholie, elisabethanische Humoralpathologie, Freud, Trauer, Stimmungsschwankungen, manisch-depressive Verstimmung, Shakespeare, Psychologische Analyse, Literaturwissenschaft.
Auf welchen Zeitraum konzentriert sich die Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf die ersten beiden Akte von Shakespeares Hamlet, aufgrund von zeitlichen Einschränkungen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Was sind die Ursachen, die Manifestation und die Auswirkungen von Hamlets Melancholie in den ersten beiden Akten?
Welche Aspekte von Hamlets Melancholie werden untersucht?
Untersucht werden Hamlets Melancholie als Ausdruck seelischer Konflikte, der Vergleich des elisabethanischen und freudschen Melancholiebegriffs, seine Stimmungsschwankungen und deren Ursachen, die Auswirkungen seiner Melancholie auf sein Handeln und seine Beziehungen, sowie die Bedeutung seiner Melancholie für das Verständnis des Stücks.
- Quote paper
- Marco Kerlein (Author), 2004, Hamlets Melancholie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/38305