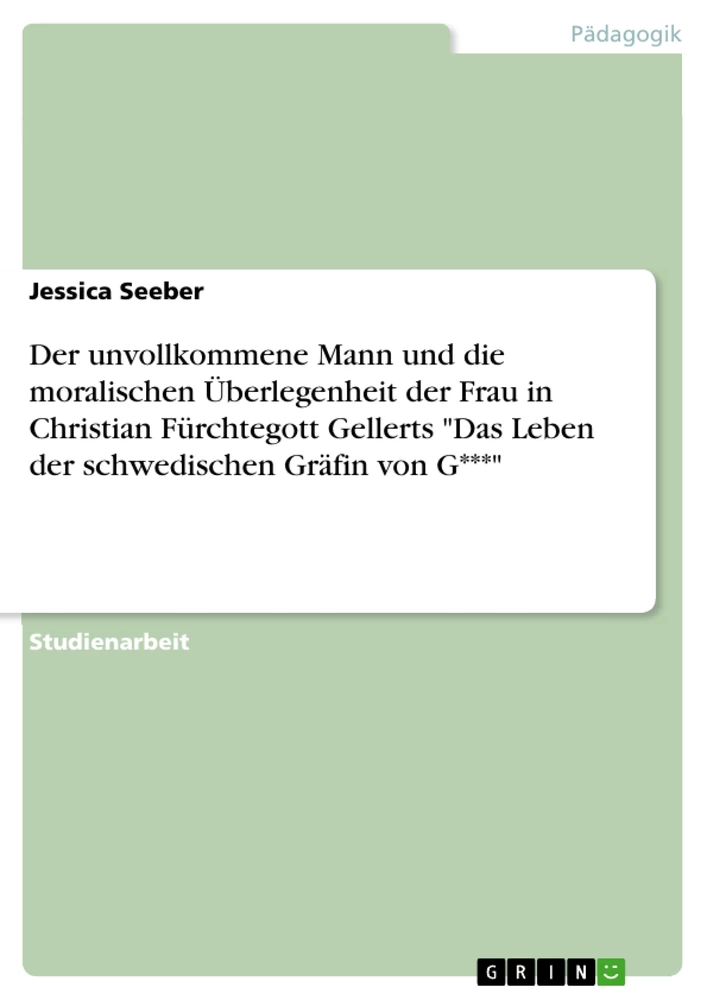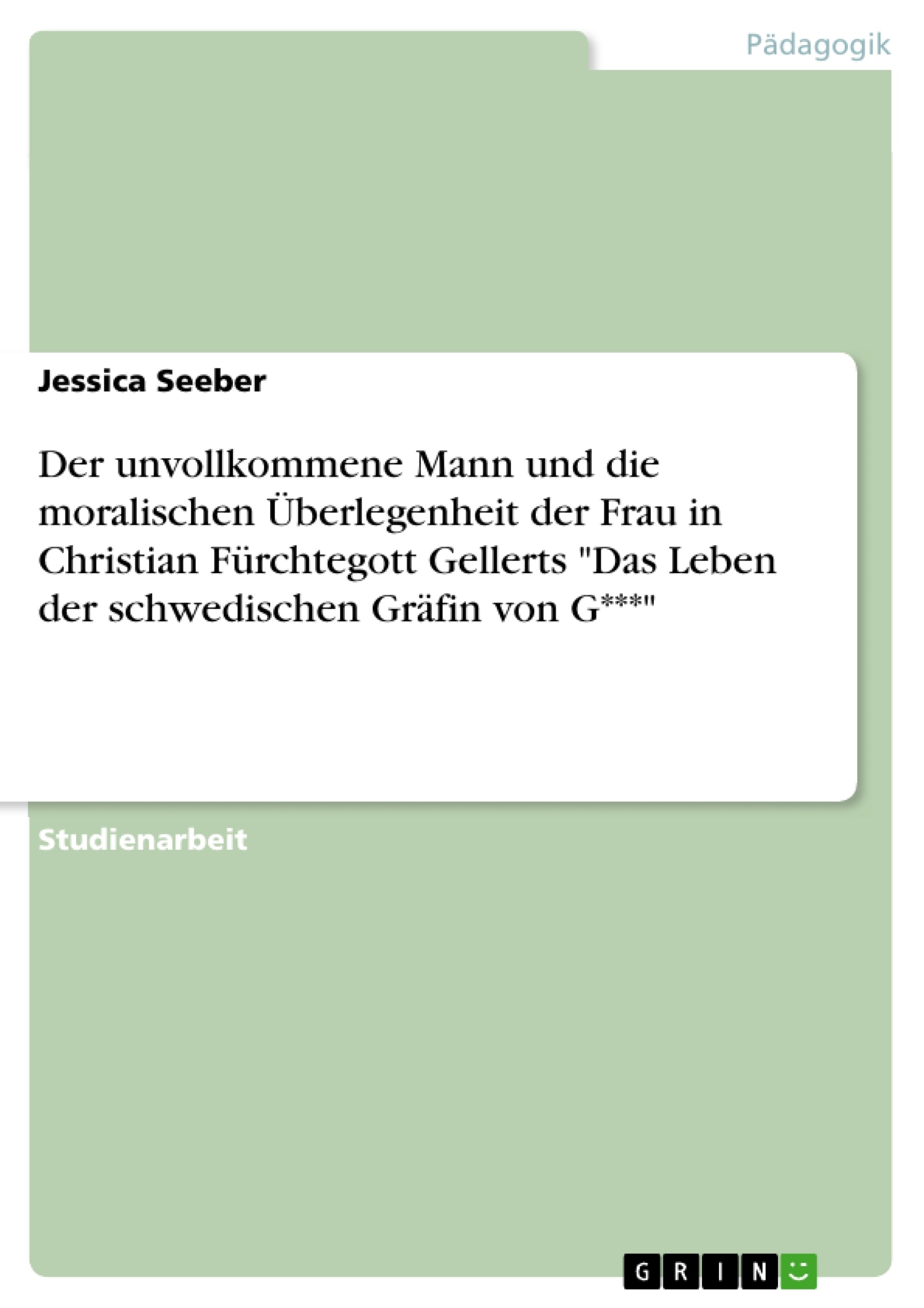Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern literarische Reflexionen einer negativen Andrologie, wie sie der Soziologe Christoph Kucklick in seinem Werk „Das unmoralische Geschlecht“ im Jahre 2008 konstatiert hat, bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts ausgemacht werden können. Den gedanklichen Mittelpunkt der negativen Andrologie bildet dabei die Feststellung über ein allgemeines, gesellschaftliches „Unbehagen an Männlichkeit“, welches mit einem durch und durch negativen Bild des Mannes als eines gefühlskalten und egoistischen Alphatier einhergeht.2 Dessen Ursprung verortet Kucklick in den Jahrzehnten um 1800, weit vor dem in der Moderne aufkeimenden Feminismus. Die grundsätzliche und systematische Kritik an Männlichkeit ließe sich demnach nicht allein als geistiges Kind der Frauenbewegung und des Feminismus ausmachen. Zweifel an einer positiven Männlichkeit sind, nach Kucklick, vor allem von Männern selbst geübt und tradiert worden.3 Exemplarisch soll hier anhand eines der wohl meistgelesenen Autoren dieser Zeit, Christian Fürchtegott Gellert, und seines Romans „Das Leben der schwedischen Gräfin von G***“ (1747/48) die Perspektive von Kucklick eingenommen und kritisch überprüft werden.
Dazu erfolgt zunächst eine kurze Vorstellung des Forschungsgegenstandes der negativen Andrologie. Insbesondere soll hier die Herausstellung der moralischen Überlegenheit der Frau ab der Mitte des 18. Jahrhunderts hervorgehoben werden, wie sie von Kucklick diagnostiziert wurde. Um zu untersuchen, inwieweit die seinen Thesen zugrunde liegende Geschlechtersemantik bereits an der Schwelle zur Moderne von zeitgenössischer Literatur aufgenommen oder ausgeklammert wurde, wird zunächst die Konstruktion eines weiblichen Moralideals in der Zeit der deutschen Empfindsamkeit vorgestellt. Anschließend wird am Beispiel von Gellerts Werk „Das Leben der schwedischen Gräfin von G***“ versucht, die zuvor erarbeiteten Annahmen zu konkretisieren und gegebenenfalls zu widerlegen. Hierbei wird der Text an konkreten Textstellen und nach seinem Handlungsablauf analysiert. Mithilfe des Ergebnisses dieser Analyse kann anschließend die Frage beantwortet werden, auf welche Art und Weise Gellert in seinem Werk Anteil an der Konstruktion eines modernen negativen Bildes von Männlichkeit, wie von Kucklick beschrieben, genommen hat und ob auch hier bereits Reflexionen einer moralischen Überlegenheit der Frau festzustellen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kucklicks negative Andrologie
- 2.1 Von der Ständegesellschaft zur Moderne
- 2.2 Interaktion, Gesellschaft und die moralische Überlegenheit der Frau
- 3. Das weibliche Moralideal in der Epoche der deutschen Empfindsamkeit
- 4. „Das Leben der schwedischen Gräfin von G***“
- 4.1 Der unvollkommene Mann und die Frau als moralisches Vorbild
- 4.2 Aspekte einer negativen Andrologie
- 5. Folgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit literarische Reflexionen einer negativen Andrologie, wie sie Christoph Kucklick beschreibt, bereits Mitte des 18. Jahrhunderts in Gellerts Werk "Das Leben der schwedischen Gräfin von G***" erkennbar sind. Es wird geprüft, ob Gellerts Roman bereits ein negatives Bild von Männlichkeit zeichnet und die moralische Überlegenheit der Frau hervorhebt.
- Negative Andrologie im 18. Jahrhundert
- Das weibliche Moralideal in der Empfindsamkeit
- Analyse von Gellerts "Das Leben der schwedischen Gräfin von G***"
- Männliche und weibliche Charaktere in Gellerts Werk
- Moralische Überlegenheit der Frau in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der negativen Andrologie ein und stellt die Forschungsfrage nach der Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit in Gellerts Werk im Kontext der zeitgenössischen Debatte. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der die Thesen Kucklicks an Gellerts Roman überprüft und die Rolle der Frau in der moralischen Überlegenheit beleuchtet. Die Einleitung etabliert den Kontext und die Methodik der Untersuchung.
2. Kucklicks negative Andrologie: Dieses Kapitel präsentiert die Kernthese von Kucklicks "Das unmoralische Geschlecht", die ein grundsätzliches Unbehagen an Männlichkeit und ein negatives Bild des Mannes beschreibt. Es wird der historische Kontext der negativen Andrologie, ihre Ursprünge vor dem modernen Feminismus und die Kritik an der männlichen Dominanz erörtert. Kucklicks These von Männern, die selbst Zweifel an der positiven Männlichkeit äußern, wird vorgestellt und bildet die Grundlage für die spätere Analyse von Gellerts Werk.
3. Das weibliche Moralideal in der Epoche der deutschen Empfindsamkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem weiblichen Moralideal in der Epoche der Empfindsamkeit. Es untersucht, wie Frauen in dieser Zeit literarisch dargestellt wurden und welche gesellschaftlichen Normen und Erwartungen an sie gestellt wurden. Die Analyse der Literatur der Zeit liefert den Rahmen für das Verständnis von Frauenrollen und ihrer moralischen Position im Vergleich zu Männern.
4. „Das Leben der schwedischen Gräfin von G***“: Diese Kapitel analysiert Gellerts Roman "Das Leben der schwedischen Gräfin von G***" im Hinblick auf die zuvor vorgestellten Thesen. Es untersucht die Charaktere, ihre Handlungen und die moralischen Konflikte, um zu belegen, ob sich darin bereits ein negatives Bild von Männlichkeit und eine moralische Überlegenheit der Frau widerspiegeln. Die Analyse konzentriert sich auf konkrete Textstellen und den Handlungsverlauf.
Schlüsselwörter
Negative Andrologie, Christian Fürchtegott Gellert, Das Leben der schwedischen Gräfin von G***, Empfindsamkeit, Weibliches Moralideal, Geschlechterrollen, Männlichkeit, Weiblichkeit, Moral, Literaturanalyse, 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Leben der schwedischen Gräfin von G***" und negativer Andrologie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob und inwieweit literarische Reflexionen einer negativen Andrologie, wie sie von Christoph Kucklick beschrieben wird, bereits Mitte des 18. Jahrhunderts in Christian Fürchtegott Gellerts Werk "Das Leben der schwedischen Gräfin von G***" erkennbar sind. Konkret wird geprüft, ob Gellerts Roman bereits ein negatives Bild von Männlichkeit zeichnet und die moralische Überlegenheit der Frau hervorhebt.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit negativer Andrologie im 18. Jahrhundert, dem weiblichen Moralideal in der Epoche der Empfindsamkeit, einer detaillierten Analyse von Gellerts "Das Leben der schwedischen Gräfin von G***", den männlichen und weiblichen Charakteren in Gellerts Werk und der Darstellung der moralischen Überlegenheit der Frau in der Literatur.
Was ist negative Andrologie im Kontext dieser Arbeit?
Die Arbeit stützt sich auf Kucklicks Theorie der negativen Andrologie, die ein grundsätzliches Unbehagen an Männlichkeit und ein negatives Bild des Mannes beschreibt. Es wird untersucht, ob diese Sichtweise bereits in Gellerts Roman zu finden ist, der im Kontext der gesellschaftlichen und literarischen Debatten des 18. Jahrhunderts betrachtet wird.
Wie wird Gellerts "Das Leben der schwedischen Gräfin von G***" analysiert?
Die Analyse von Gellerts Roman konzentriert sich auf die Charaktere, ihre Handlungen und moralischen Konflikte. Es wird untersucht, ob der Roman ein negatives Bild von Männlichkeit präsentiert und die moralische Überlegenheit der Frau hervorhebt. Die Analyse stützt sich auf konkrete Textstellen und den Handlungsverlauf des Romans.
Welche Rolle spielt die Epoche der Empfindsamkeit?
Das Kapitel über das weibliche Moralideal in der Empfindsamkeit liefert den Kontext für das Verständnis der Frauenrollen und ihrer moralischen Position im Vergleich zu Männern in Gellerts Roman. Es beleuchtet die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen an Frauen in dieser Epoche und deren literarische Darstellung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen basierend auf der Analyse von Gellerts Roman im Lichte der negativen Andrologie und des weiblichen Moralideals der Empfindsamkeit. Es wird bewertet, inwieweit Gellerts Werk die Thesen Kucklicks bestätigt und wie die Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit im Roman das Verständnis der Geschlechterrollen im 18. Jahrhundert beeinflusst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Negative Andrologie, Christian Fürchtegott Gellert, Das Leben der schwedischen Gräfin von G***, Empfindsamkeit, Weibliches Moralideal, Geschlechterrollen, Männlichkeit, Weiblichkeit, Moral, Literaturanalyse, 18. Jahrhundert.
- Quote paper
- Jessica Seeber (Author), 2017, Der unvollkommene Mann und die moralischen Überlegenheit der Frau in Christian Fürchtegott Gellerts "Das Leben der schwedischen Gräfin von G***", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/381462