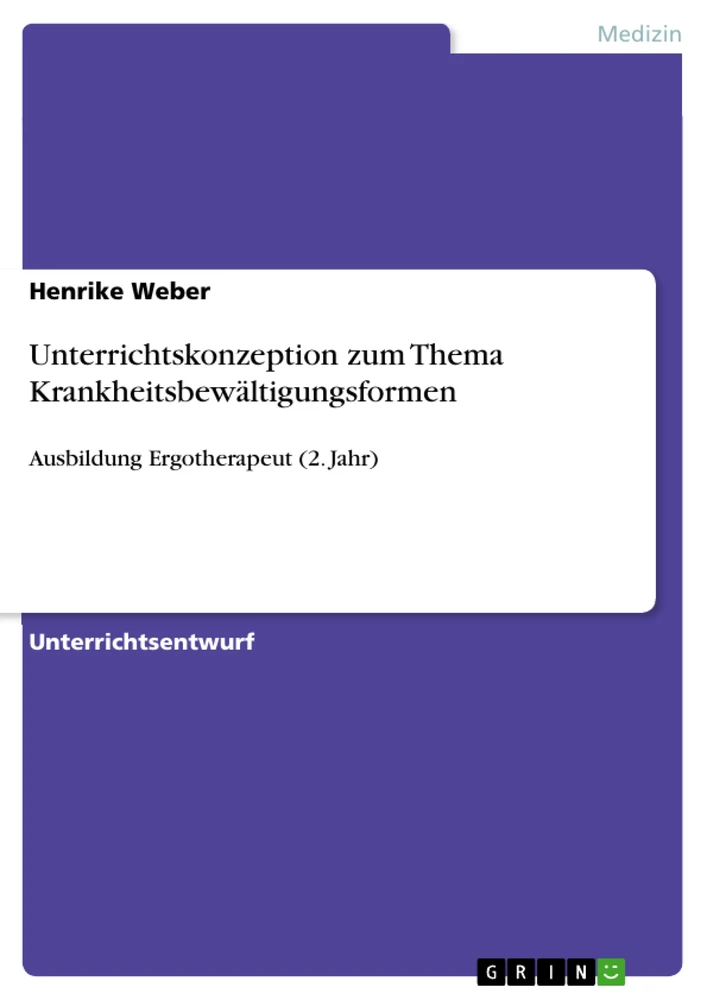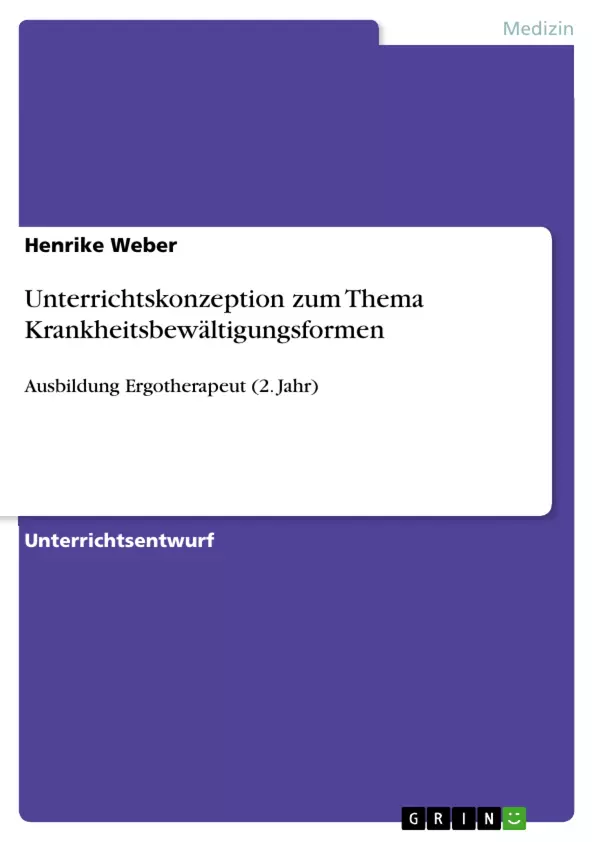Die Aufgabe von Ergotherapeuten ist es, Patienten jeden Alters zu beraten, zu fördern und zu behandeln. Zielgruppe sind Patienten, die durch eine physische oder psychische Erkrankung, eine Behinderung oder eine Entwicklungsverzögerung in ihrer Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit eingeschränkt, beziehungsweise von Einschränkungen bedroht sind. Ergotherapeuten erarbeiten individuelle Behandlungspläne und führen therapeutische und präventive Maßnahmen durch.
Menschen sollen bei der Durchführung von für sie wichtigen Aktivitäten in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit nach verschiedenen Konzepten in ihrer Umwelt gestärkt werden. Hierfür werden spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und Beratung gezielt und ressourcengerecht angewandt. Handlungsfähigkeit im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und Lebensqualität werden verbessert.
Die Funktionen einer (adaptiven, beziehungsweise erfolgreichen) Bewältigungsstrategie ist die gelungene Bewältigung der Krankheit, Reduzierung des Einflusses schädigender Umweltbedingungen und Verbesserung der Aussicht auf Erholung. Sie macht negative Ereignisse oder Umstände erträglicher beziehungsweise passt den Organismus an sie an. Weiterhin sichert sie ein positives Selbstbild und emotionales Gleichgewicht. Adaptive Krankheitsbewältigung ermöglicht außerdem das Fortsetzen befriedigender Beziehungen zu anderen Personen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Bedingungsfeldanalyse
- 1.1 Analyse der Lerngruppe
- 1.2 Lernvoraussetzungen
- 1.3 Informationen zur Ausbildung
- 1.4 Kurzbeschreibung Ergotherapeuten-Beruf
- 1.5 Räumliche Gegebenheiten
- 1.6 Sitzordnung
- 1.7 Das Lehrpersonal
- 1.8 Die Lehrkraft
- 2 Sachanalyse
- 2.1 Transaktionales Stressmodell nach Richard Lazarus
- 2.2 Drei Coping-Strategien
- 2.3 Krankheitsbewältigung
- 2.4 Abwehrmechanismen im Rahmen von Coping
- 3 Didaktische Analyse nach Wolfgang Klafki
- 3.1 Gegenwartsbedeutung
- 3.2 Zukunftsbedeutung
- 3.3 Exemplarische Bedeutung
- 3.4 Strukturanalyse
- 3.5 Bezug zum Bildungsplan
- 3.6 Zugänglichkeit
- 4 Didaktische Reduktion
- 5 Kompetenzen
- 5.1 Kompetenzen tabellarisch
- 5.2 Lehrziele
- 6 Makrosequenz
- 7 Mikrosequenz mit Begründung der Methoden
- 7.1 Einstieg
- 7.1.1 Eingangsfrage
- 7.1.2 Vorstellung der Agenda
- 7.1.3 PowerPoint-Präsentation
- 7.1.4 Vorstellung des transaktionalen Stressmodells
- 7.2 Erarbeitung
- 7.2 Ergebnissicherung
- 7.2.1 Erwartungshorizont
- 7.2.2 Lösungen
- 7.3 Transfer
- 7.4 Stundenschluss
- 8 Verlaufsplan mit Phasierung
- 9 Reflexion der Planung
- 9.1 Erarbeitung des Themengebiets
- 9.2 Überlegungen
- 9.2.1 Überlegungen zum Thema
- 9.2.2 Überlegungen zur Klasse
- 9.2.3 Überlegungen zum Beruf des Ergotherapeuten
- 9.3 Auswahl der Inhalte
- 9.3.1 Das Lazarus-Modell
- 9.3.2 Die Coping-Strategien
- 9.3.3 Allgemeines zum Thema Krankheitsbewältigung
- 9.4 Erstellen des Materials
- 9.4.1 Die Skripte
- 9.4.2 Fallbeispiele und Arbeitsauftrag
- 9.4.3 Die PowerPoint-Präsentation
- 9.4.4 Das Modell auf Metaplan-Karten
- 9.5 Planung des Unterrichtsablaufs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Unterrichtskonzeption zum Thema "Krankheitsbewältigungsformen" zielt darauf ab, Ergotherapeuten-Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr ein fundiertes Verständnis verschiedener Krankheitsbewältigungsstrategien zu vermitteln. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung des erworbenen Wissens im therapeutischen Kontext.
- Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus
- Coping-Strategien und deren Anwendung
- Krankheitsbewältigung im Kontext der Ergotherapie
- Relevanz von Abwehrmechanismen
- Didaktische Konzeption und methodische Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Bedingungsfeldanalyse: Dieses Kapitel analysiert die Lernbedingungen für die Unterrichtskonzeption. Es beschreibt detailliert die Lerngruppe, bestehend aus neun Ergotherapie-Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr, ihre demografischen Daten (Alter, Geschlecht), ihren bisherigen Ausbildungsverlauf inklusive Praktika und Zwischenexamen, und die räumlichen Gegebenheiten des Unterrichtsraumes. Der Fokus liegt auf der Charakterisierung der Lerngruppe und der Schaffung einer Grundlage für die didaktische Planung. Die Beschreibung des Lehrpersonals und die Analyse der Lernvoraussetzungen der Studierenden stellen wichtige Aspekte dieses Kapitels dar, die den weiteren Verlauf der Unterrichtsplanung maßgeblich beeinflussen.
2 Sachanalyse: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Grundlage der Unterrichtskonzeption. Es erläutert das transaktionale Stressmodell nach Lazarus, ein zentrales Modell zum Verständnis von Stress und Bewältigungsstrategien. Es werden verschiedene Coping-Strategien detailliert dargestellt und deren Relevanz für die Krankheitsbewältigung und die Rolle von Abwehrmechanismen in diesem Prozess erläutert. Die Sachanalyse liefert somit das fachliche Fundament für die didaktische Planung und den anschließenden Unterricht.
3 Didaktische Analyse nach Wolfgang Klafki: Dieses Kapitel analysiert das Thema "Krankheitsbewältigungsformen" unter didaktischen Gesichtspunkten nach dem Modell von Wolfgang Klafki. Es untersucht die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Themas im Kontext der Ergotherapie, beleuchtet dessen exemplarische Bedeutung und führt eine Strukturanalyse durch. Die Einbettung in den Bildungsplan und die Zugänglichkeit des Themas für die Lerngruppe werden ebenfalls kritisch betrachtet. Diese Analyse dient als Grundlage für die didaktische Reduktion und die Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte.
4 Didaktische Reduktion: Hier werden die Ergebnisse der didaktischen Analyse konkretisiert und auf die Bedürfnisse der Lerngruppe zugeschnitten. Es erfolgt eine Auswahl und Vereinfachung des Themas, um den Lernstoff für die Auszubildenden übersichtlich und verständlich zu gestalten. Dieser Abschnitt beschreibt die methodische Strukturierung des Lehrstoffs für einen erfolgreichen Unterricht.
5 Kompetenzen: Dieses Kapitel beschreibt die Kompetenzen, die die Studierenden nach dem Unterricht erworben haben sollen. Es wird eine tabellarische Übersicht der Kompetenzen erstellt, gefolgt von einer detaillierten Definition der konkreten Lehrziele, die den Studierenden im Laufe des Unterrichts vermittelt werden sollen.
6 Makrosequenz: Dieses Kapitel beschreibt die gesamte Unterrichtssequenz, die den thematischen Verlauf des Unterrichts darstellt und die einzelnen Unterrichtseinheiten miteinander verbindet.
7 Mikrosequenz mit Begründung der Methoden: Dieses Kapitel beschreibt den detaillierten Ablauf einer einzelnen Unterrichtseinheit. Es wird der Einstieg, die Erarbeitungsphase, die Sicherung und der Transfer des Gelernten beschrieben. Die Auswahl der Methoden wird begründet und die didaktischen Überlegungen hinter den einzelnen Schritten werden transparent gemacht. Die Einbindung von verschiedenen Methoden und Materialien wie PowerPoint-Präsentationen und Metaplankarten wird hierbei erläutert.
8 Verlaufsplan mit Phasierung: Dieses Kapitel enthält einen detaillierten zeitlichen Ablaufplan des gesamten Unterrichts, wobei der Unterrichtsverlauf in einzelne Phasen gegliedert ist.
9 Reflexion der Planung: In diesem Kapitel wird die gesamte Unterrichtsplanung reflektiert und kritisch evaluiert. Die Überlegungen zum Thema, zur Lerngruppe und zum Beruf des Ergotherapeuten werden dargestellt. Die Auswahl der Inhalte wird begründet, und es wird detailliert beschrieben, wie die Unterrichtsmaterialien (Skripte, Fallbeispiele, PowerPoint-Präsentation, Metaplankarten) erstellt wurden und wie der Unterrichtsablauf geplant wurde. Dieser Abschnitt bietet eine umfassende Reflexion des gesamten Planungsprozesses.
Schlüsselwörter
Krankheitsbewältigung, Coping-Strategien, Transaktionales Stressmodell (Lazarus), Abwehrmechanismen, Ergotherapie, Didaktische Analyse (Klafki), Unterrichtsplanung, Kompetenzen, Lehrziele.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtskonzeption "Krankheitsbewältigungsformen"
Was ist der Gegenstand dieser Unterrichtskonzeption?
Die Unterrichtskonzeption behandelt das Thema "Krankheitsbewältigungsformen" für Ergotherapeuten-Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr. Der Fokus liegt auf dem Verständnis und der praktischen Anwendung verschiedener Krankheitsbewältigungsstrategien im therapeutischen Kontext.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind das transaktionale Stressmodell nach Lazarus, verschiedene Coping-Strategien, die Rolle von Abwehrmechanismen bei der Krankheitsbewältigung und die didaktische Konzeption und methodische Umsetzung des Unterrichts.
Welche Kapitel umfasst die Konzeption?
Die Konzeption umfasst neun Kapitel: 1. Bedingungsfeldanalyse, 2. Sachanalyse, 3. Didaktische Analyse nach Wolfgang Klafki, 4. Didaktische Reduktion, 5. Kompetenzen, 6. Makrosequenz, 7. Mikrosequenz mit Begründung der Methoden, 8. Verlaufsplan mit Phasierung und 9. Reflexion der Planung.
Was wird in der Bedingungsfeldanalyse behandelt?
Die Bedingungsfeldanalyse beschreibt die Lerngruppe (neun Ergotherapie-Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr), ihre Lernvoraussetzungen, die Ausbildungsinformationen, den Beruf des Ergotherapeuten, die räumlichen Gegebenheiten, die Sitzordnung, das Lehrpersonal und die Lehrkraft. Sie dient als Grundlage für die didaktische Planung.
Was ist der Inhalt der Sachanalyse?
Die Sachanalyse erläutert das transaktionale Stressmodell nach Lazarus, verschiedene Coping-Strategien und deren Relevanz für die Krankheitsbewältigung, sowie die Rolle von Abwehrmechanismen. Sie bildet das fachliche Fundament für den Unterricht.
Wie wird die didaktische Analyse nach Wolfgang Klafki durchgeführt?
Die didaktische Analyse untersucht die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Themas, seine exemplarische Bedeutung, seine Struktur und seinen Bezug zum Bildungsplan. Die Zugänglichkeit des Themas für die Lerngruppe wird ebenfalls betrachtet.
Was beinhaltet die didaktische Reduktion?
Die didaktische Reduktion konkretisiert die Ergebnisse der didaktischen Analyse und passt den Lernstoff an die Bedürfnisse der Lerngruppe an. Sie vereinfacht und strukturiert den Lehrstoff für einen erfolgreichen Unterricht.
Welche Kompetenzen sollen die Auszubildenden erwerben?
Die Konzeption definiert die Kompetenzen, die die Auszubildenden nach dem Unterricht erworben haben sollen. Es wird eine tabellarische Übersicht der Kompetenzen und eine detaillierte Definition der Lehrziele erstellt.
Wie wird der Unterrichtsablauf beschrieben?
Die Konzeption beschreibt den Unterrichtsablauf in einer Makrosequenz (Gesamtübersicht) und einer Mikrosequenz (detaillierter Ablauf einer Unterrichtseinheit, inklusive Begründung der Methoden). Ein Verlaufsplan mit Phasierung ist ebenfalls enthalten.
Wie wird die Planung reflektiert?
Das letzte Kapitel reflektiert die gesamte Planung kritisch. Es werden Überlegungen zum Thema, zur Lerngruppe, zum Beruf des Ergotherapeuten, zur Auswahl der Inhalte und zur Erstellung der Unterrichtsmaterialien (Skripte, Fallbeispiele, PowerPoint-Präsentation, Metaplankarten) dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Konzeption?
Schlüsselwörter sind: Krankheitsbewältigung, Coping-Strategien, Transaktionales Stressmodell (Lazarus), Abwehrmechanismen, Ergotherapie, Didaktische Analyse (Klafki), Unterrichtsplanung, Kompetenzen, Lehrziele.
- Arbeit zitieren
- Henrike Weber (Autor:in), 2017, Unterrichtskonzeption zum Thema Krankheitsbewältigungsformen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/381449