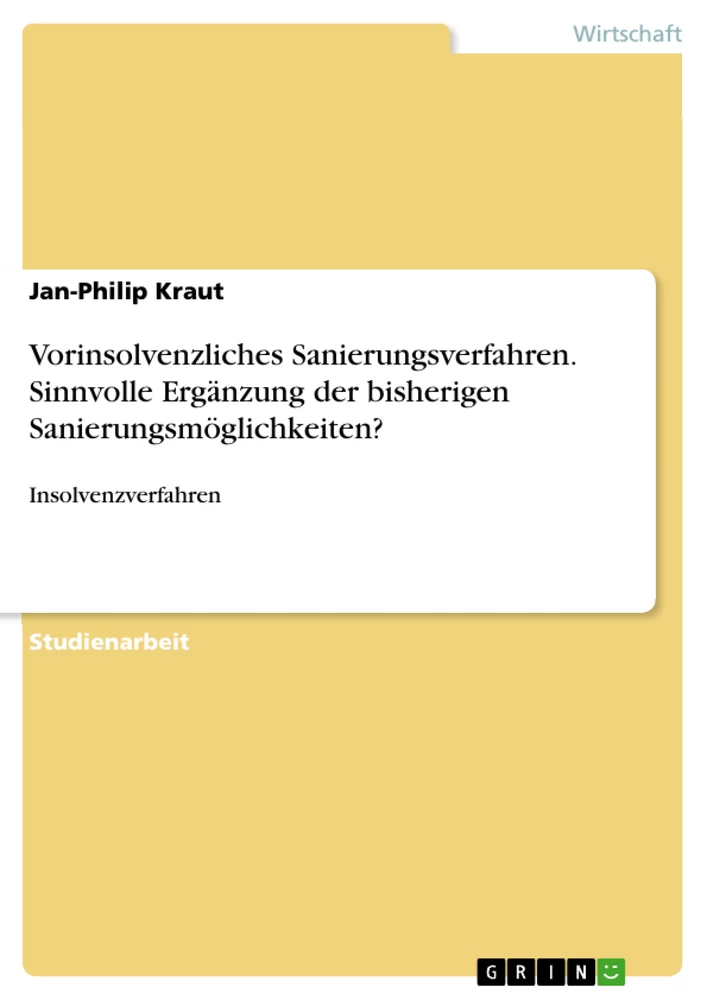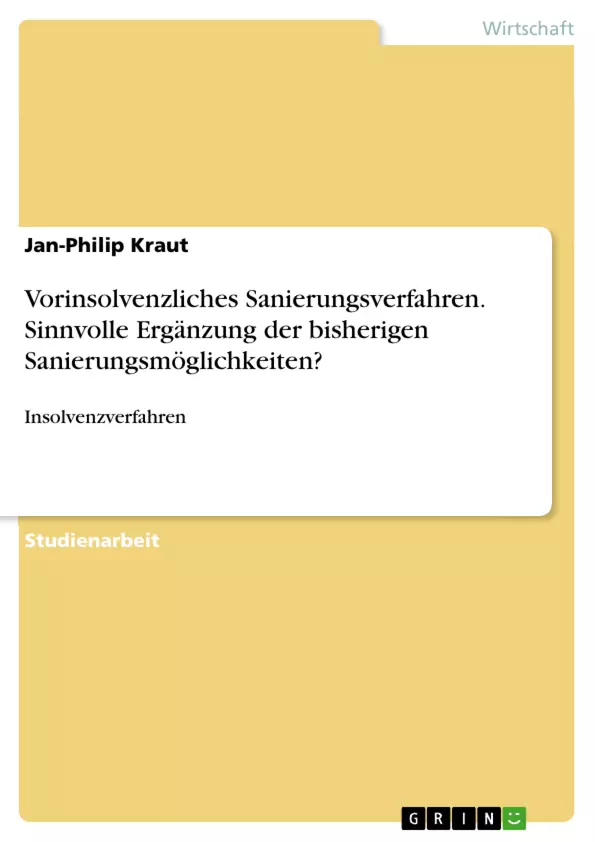Ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren ist keinesfalls ein neues Thema in Deutschland, denn schon bei der Einführung des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (kurz: ESUG) im Jahr 2012 wurde über die Einführung eines gesetzlich geregelten außergerichtlichen Sanierungsverfahren diskutiert. Damals hat man sich allerdings gegen ein solches Verfahren entschieden. Somit fehlt in Deutschland die gesetzliche Regelung für die Sanierung von Unternehmen außerhalb des gerichtlichen Insolvenzverfahrens, was aber durch die Verpflichtung der EU ein Ende hat. Durch den geplanten harmonisierten Insolvenzrahmen in allen Mitgliedstaaten, möchte die EU vor allem ein gutes Geschäftsumfeld schaffen und damit eine Steigerung des Handels und auch von Investitionen bezwecken.
In den letzten Jahren können starke Tendenzen von Unternehmenssanierungen in einem frühen Stadium festgestellt werden, in welchem eine materielle Insolvenz, also eine Zahlungsunfähigkeit (nach § 17 InsO), eine drohende Zahlungsunfähigkeit (nach § 18 InsO) oder eine Überschuldung (nach § 19 InsO), noch nicht vorliegt. Führende Restrukturierungsexperten nutzen diese Situation und wagen erneute Diskussionen über vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren außerhalb einer Insolvenz.
Anders als bei den derzeitigen Sanierungsverfahren, wo eine gesetzliche Antragspflicht mit einer verbundenen Veröffentlichung besteht, soll bei einem vorinsolvenzlichen Verfahren davon abgesehen werden, um vor allem das Unternehmen vor wirtschaftlichen Benachteiligungen und der Stigmatisierung einer Insolvenz zu schützen. Das ein solches Verfahren funktionieren kann, beweisen ähnliche Modelle, wie das englische „Scheme of Arrangement“, mit welchem Firmen wie Tele Columbus, Rodenstrock oder Apcoa durch teilweise herauslösen einzelner Geschäftsbereiche restrukturiert werden konnten. Die Krisen wurden beispielsweise durch Verringerungen von Finanzverbindlichkeiten und gleichzeitiger Zuführung frischer Liquidität, aber auch durch Rangrücktritte erreicht. Die Unternehmen wurden deswegen nicht in Deutschland saniert, da hierzulande solche Maßnahmen nicht gegen den Willen eines betroffenen Kreditgebers umgesetzt werden können. Grund hierfür ist die fehlende Pflicht von Gläubigern zur Mitwirkung einer Sanierung, was von diesen oftmals als strategisches Vetorecht missbräuchlich ausgenutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Gerichtliche Sanierung
- Entwicklung des deutschen Insolvenzrechts
- Typische Krisenstadien in Unternehmen
- Insolvenzeinleitungsgründe
- Rechtlicher Rahmen für die Krisenbewältigung
- Außergerichtliche Sanierung
- Gerichtliche Sanierung
- Regelinsolvenz
- Planinsolvenz
- Vorinsolvenzliches Verfahren
- Relevanz eines vorinsolvenzlichen Verfahrens
- Plädoyer der Praxis für ein vorinsolvenzliches Verfahren
- Resultierende Herausforderungen
- Lösungsempfehlungen der EU-Kommission
- Präventiver Restrukturierungsrahmen
- Restschuldbefreiung
- Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz
- Fazit und Schlussfolgerung/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Sinnhaftigkeit eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens als Ergänzung zu bestehenden Möglichkeiten in Deutschland. Sie analysiert den aktuellen rechtlichen Rahmen, die Herausforderungen und Chancen eines solchen Verfahrens und beleuchtet internationale Vergleichsmodelle.
- Analyse des deutschen Insolvenzrechts und seiner Entwicklung
- Bewertung der Vor- und Nachteile außergerichtlicher Sanierungsverfahren
- Untersuchung der Relevanz und Notwendigkeit eines vorinsolvenzlichen Verfahrens
- Diskussion der Herausforderungen bei der Implementierung eines solchen Verfahrens
- Auswertung von Lösungsempfehlungen der EU-Kommission
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit führt in die Thematik des vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens ein und begründet die Notwendigkeit seiner Untersuchung im Kontext des geplanten harmonisierten Insolvenzrahmens der EU. Sie hebt den Unterschied zu bestehenden Verfahren hervor und verweist auf internationale Beispiele erfolgreicher außergerichtlicher Sanierungen, die die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung in Deutschland unterstreichen.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis des Themas. Es beschreibt die gerichtliche Sanierung, die Entwicklung des deutschen Insolvenzrechts, typische Krisenstadien in Unternehmen und die Insolvenzeinleitungsgründe (drohende Zahlungsunfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung). Es bildet die Basis für die spätere Analyse der Notwendigkeit eines vorinsolvenzlichen Verfahrens.
Rechtlicher Rahmen für die Krisenbewältigung: Dieser Abschnitt beleuchtet den bestehenden rechtlichen Rahmen für die Krisenbewältigung in Unternehmen. Es werden sowohl außergerichtliche als auch gerichtliche Sanierungsverfahren (Regelinsolvenz und Planinsolvenz) detailliert dargestellt und hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile im Vergleich zu einem hypothetischen vorinsolvenzlichen Verfahren analysiert. Die Unterschiede in den Verfahren und deren Auswirkungen auf das Unternehmen werden herausgestellt.
Vorinsolvenzliches Verfahren: Das Herzstück der Arbeit. Es analysiert die Relevanz eines vorinsolvenzlichen Verfahrens, diskutiert die Argumente aus der Praxis für seine Einführung und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Lösungsempfehlungen der EU-Kommission gewidmet, einschließlich des präventiven Restrukturierungsrahmens, der Restschuldbefreiung und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz. Der Fokus liegt auf der Abwägung zwischen dem Schutz des Unternehmens und den Interessen der Gläubiger.
Schlüsselwörter
Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren, Insolvenzrecht, Außergerichtliche Sanierung, EU-Insolvenzrahmen, Restrukturierung, Gläubigerschutz, Unternehmenssanierung, Krisenmanagement, ESUG.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Sinnhaftigkeit eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens als Ergänzung zum bestehenden deutschen Recht. Sie analysiert den aktuellen rechtlichen Rahmen, Herausforderungen und Chancen eines solchen Verfahrens und vergleicht es mit internationalen Modellen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse des deutschen Insolvenzrechts und seiner Entwicklung, die Bewertung von Vor- und Nachteilen außergerichtlicher Sanierungsverfahren, die Untersuchung der Relevanz und Notwendigkeit eines vorinsolvenzlichen Verfahrens, die Diskussion der Herausforderungen bei dessen Implementierung und die Auswertung von Lösungsempfehlungen der EU-Kommission.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Abschnitt zu den theoretischen Grundlagen (gerichtliche Sanierung, Entwicklung des deutschen Insolvenzrechts, Krisenstadien, Insolvenzgründe), einen Abschnitt zum rechtlichen Rahmen der Krisenbewältigung (außergerichtliche und gerichtliche Sanierung), einen Abschnitt zum vorinsolvenzlichen Verfahren (Relevanz, Herausforderungen, Lösungsempfehlungen der EU-Kommission) und abschließend ein Fazit und Ausblick.
Was sind die theoretischen Grundlagen der Arbeit?
Die theoretischen Grundlagen umfassen die gerichtliche Sanierung, die Entwicklung des deutschen Insolvenzrechts, typische Krisenstadien in Unternehmen und die Insolvenzeinleitungsgründe (drohende Zahlungsunfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung). Diese bilden die Basis für die Analyse der Notwendigkeit eines vorinsolvenzlichen Verfahrens.
Wie wird der rechtliche Rahmen für die Krisenbewältigung dargestellt?
Der Abschnitt beleuchtet den bestehenden rechtlichen Rahmen, detailliert außergerichtliche und gerichtliche Sanierungsverfahren (Regelinsolvenz und Planinsolvenz) und analysiert deren Vor- und Nachteile im Vergleich zu einem hypothetischen vorinsolvenzlichen Verfahren. Die Unterschiede und Auswirkungen auf das Unternehmen werden herausgestellt.
Was ist der Kern der Arbeit zum vorinsolvenzlichen Verfahren?
Der Kern der Arbeit analysiert die Relevanz eines solchen Verfahrens, diskutiert praktische Argumente für seine Einführung und beleuchtet die Herausforderungen. Die Lösungsempfehlungen der EU-Kommission (präventiver Restrukturierungsrahmen, Restschuldbefreiung, Effizienzsteigerungsmaßnahmen) werden im Hinblick auf den Ausgleich zwischen Unternehmensschutz und Gläubigerinteressen untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren, Insolvenzrecht, Außergerichtliche Sanierung, EU-Insolvenzrahmen, Restrukturierung, Gläubigerschutz, Unternehmenssanierung, Krisenmanagement, ESUG.
Welche Bedeutung hat der europäische Kontext für die Arbeit?
Die Arbeit betrachtet den geplanten harmonisierten Insolvenzrahmen der EU und untersucht, inwiefern ein vorinsolvenzliches Verfahren in diesem Kontext sinnvoll ist. Internationale Beispiele erfolgreicher außergerichtlicher Sanierungen unterstreichen die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung in Deutschland.
- Quote paper
- Jan-Philip Kraut (Author), 2016, Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren. Sinnvolle Ergänzung der bisherigen Sanierungsmöglichkeiten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/379221