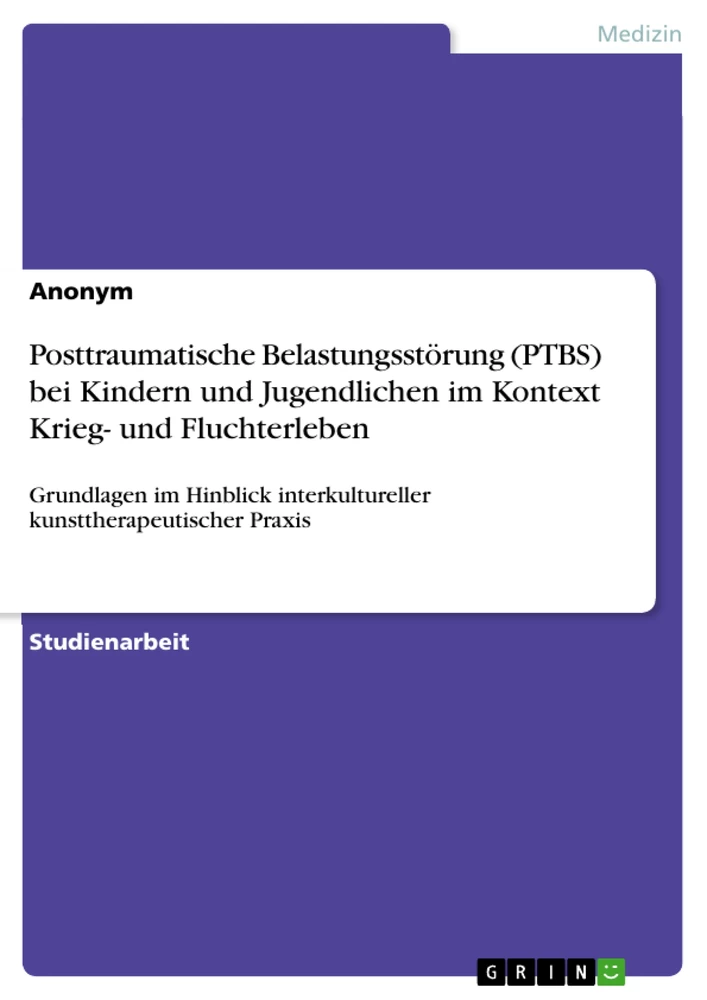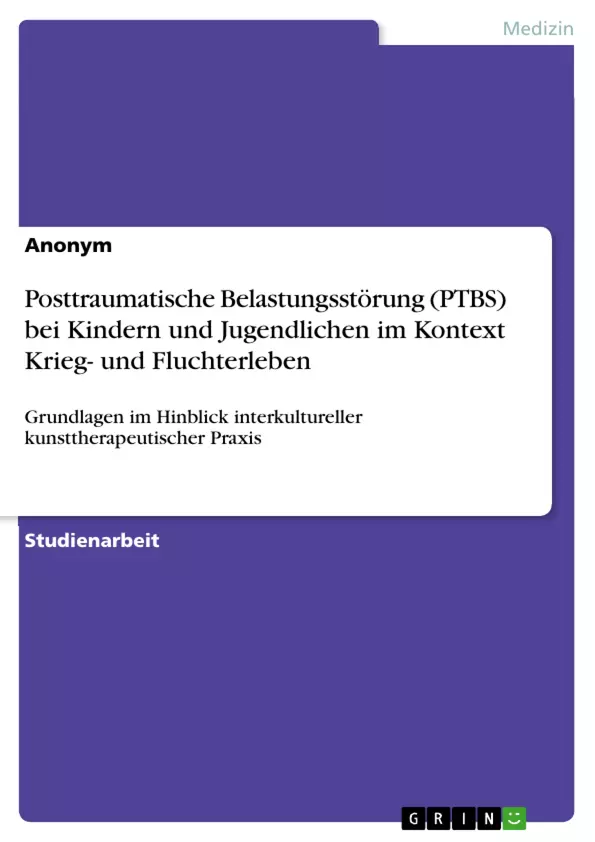Laut UNHCR-Jahresbericht sind knapp 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Kriegen, Konflikten und Verfolgung. Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und Somalia. Die Hälfte der Flüchtlinge sind Minderjährige. Viele werden konfrontiert mit dem Verlust der Eltern und Geschwister, sehen zu wie andere Flüchtlinge sterben, müssen permanent selbst Angst um das eigene Leben haben oder erfahren Gewalt. Endlich im Aufnahmeland vermeintlich in Sicherheit, müssen sie mit dem Gefühl der Isolation und Entwurzelung leben und sich den Herausforderungen der Integration in eine für sie fremde Kultur stellen. Solch traumatische Ereignisse hinterlassen oft tiefe seelische Wunden. Auf der Homepage der Bundes Psychotherapeuten Kammer wird in einem BPtK-Standpunkt darauf hingewiesen, dass Studien, die mit Kindern von Flüchtlingen in Deutschland durchgeführt wurden, belegen, dass nahezu die Hälfte der Kinder deutlich psychisch belastet ist. Sensibilisiert durch mein Studium der Kunsttherapie, fühle ich mich zur Thematik hingezogen. Seit März 2016 unterstütze ich deshalb im Rahmen eines Praxisprojektes einen gemeinnützigen Verein, der humanitäre Hilfe für syrische Flüchtlinge in Bursa (Türkei) leistet. Unter anderem angeregt durch die Veröffentlichung Imagination als heilsame Kraft von Luise Reddemann, biete ich Workshops für Kinder in Form von künstlerischen Interventionen, die über gezielte Themenstellungen stabilisierende Erfahrungen ansprechen. Nicht jedes traumatische Ereignis führt zwangsläufig zu einer Traumafolgestörung. Aber ich stelle mir oft die Frage, wie viele Kinder das oft Unaussprechliche des Erlebten nicht verarbeiten können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Begriff >>Trauma<<
- 2.1 Phänomenologische Definition
- 2.2 Klassifikationsbasierte Definition
- 2.3 Bandbreite traumatisierender Ereignisse nach Leonore Terr
- 3 Diagnosekriterien der PTBS bei Kindern nach DSM-IV-TR
- 4 Pathogenese der PTBS
- 4.1 Wie funktioniert unser Gehirn bei Gefahr?
- 4.2 Wie funktioniert unser Gehirn bei einem traumatischen Ereignis?
- 4.3 Entstehungsmodell der PTBS nach Ehlers und Clark
- 4.3.1 Gedächtnisdefizite
- 4.3.2 Dysfunktionale kognitive Bewertungen
- 4.3.3 Aufrechterhaltung dysfunktionalen Verhaltens
- 4.4 Risikofaktoren zur Entwicklung einer PTBS
- 5 Traumatherapeutische Ansätze
- 5.1 Die drei Phasen der Traumatherapie
- 5.1.1 Stabilisierung
- 5.1.2 Traumabearbeitung (Exposition)
- 5.1.3 Integration
- 5.2 Traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (Tf-KBT)
- 5.3 Narrative Expositionstherapie (KIDNET)
- 5.4 Aspekte interkultureller Kunsttherapie
- 5.4.1 Interkulturelle Fähigkeiten in der Kunsttherapie
- 5.4.2 Zielsetzungen interkultureller kunsttherapeutischer Arbeit
- 5.4.3 Kunsttherapeutische Ansätze
- 6 Schlussbemerkung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, ein theoretisches Verständnis der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) bei Kindern und Jugendlichen im Kontext von Krieg und Flucht zu entwickeln. Sie untersucht den Begriff Trauma, die Diagnosekriterien der PTBS, die Pathogenese und relevante traumatherapeutische Ansätze, insbesondere im interkulturellen Kontext der Kunsttherapie.
- Definition und Verständnis von Trauma
- Diagnose und Pathogenese der PTBS bei Kindern und Jugendlichen
- Traumatherapeutische Ansätze
- Interkulturelle Aspekte der Kunsttherapie bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen
- Relevanz für die Arbeit mit Flüchtlingskindern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Fall von Sara, einem fünfjährigen syrischen Flüchtlingskind, um die Auswirkungen von Krieg und Flucht auf die psychische Gesundheit von Kindern zu veranschaulichen. Sie verweist auf die hohe Anzahl von Flüchtlingskindern weltweit und die hohe Prävalenz psychischer Belastungen, darunter PTBS, in dieser Gruppe. Die Autorin begründet ihre Forschungsfrage mit ihrer eigenen Erfahrung in der Kunsttherapie mit syrischen Flüchtlingskindern in der Türkei und dem Wunsch, ein theoretisches Fundament für die Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingskindern zu schaffen. Die zentralen Forschungsfragen betreffen die Definition von Trauma, die Entwicklung einer PTBS, die damit verbundenen Symptome, begünstigende Faktoren und geeignete therapeutische Ansätze im interkulturellen Kontext.
2 Der Begriff >>Trauma<<: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen des Begriffs „Trauma“. Es wird zwischen einer phänomenologischen Definition, die die existentielle Bedrohung, die Überforderung des Ichs und den Zustand der Ohnmacht betont, und einer klassifikationsbasierten Definition unterschieden. Die Diskussion verschiedener Definitionsansätze legt den Grundstein für das Verständnis der Komplexität traumatischer Erlebnisse und ihrer Auswirkungen. Die Bandbreite traumatisierender Ereignisse wird anhand der Arbeit von Leonore Terr beleuchtet, wodurch die Vielfalt möglicher traumatischer Erfahrungen für Kinder und Jugendliche im Kontext von Krieg und Flucht verdeutlicht wird.
3 Diagnosekriterien der PTBS bei Kindern nach DSM-IV-TR: Dieses Kapitel beschreibt die Diagnosekriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) bei Kindern nach DSM-IV-TR. Es bietet eine detaillierte Darstellung der Kriterien, die für die Diagnose einer PTBS relevant sind, und ermöglicht so eine fundierte Beurteilung des Vorliegens einer PTBS bei Kindern und Jugendlichen. Die Beschreibung der Diagnosekriterien ist essentiell für die spätere Diskussion traumatherapeutischer Ansätze.
4 Pathogenese der PTBS: Das Kapitel erläutert die Entstehung von PTBS. Es beschreibt die Funktionsweise des Gehirns bei Gefahr und bei traumatischen Ereignissen. Das Entstehungsmodell von Ehlers und Clark wird vorgestellt, welches Gedächtnisdefizite, dysfunktionale kognitive Bewertungen und die Aufrechterhaltung dysfunktionalen Verhaltens als zentrale Faktoren identifiziert. Zusätzlich werden Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTBS diskutiert, was das Verständnis der individuellen Vulnerabilität erhöht und die Bedeutung von präventiven Maßnahmen unterstreicht.
5 Traumatherapeutische Ansätze: Dieses Kapitel stellt verschiedene traumatherapeutische Ansätze vor, darunter die drei Phasen der Traumatherapie (Stabilisierung, Traumabearbeitung, Integration), die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (Tf-KBT), die narrative Expositionstherapie (KIDNET) und Aspekte der interkulturellen Kunsttherapie. Die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Methoden bietet ein breites Spektrum an Interventionen für die Behandlung von PTBS bei Kindern und Jugendlichen. Besonderes Augenmerk wird auf die interkulturellen Fähigkeiten und Zielsetzungen in der Kunsttherapie gelegt und verschiedene kunsttherapeutische Ansätze werden präsentiert, um die spezifischen Bedürfnisse traumatisierter Kinder und Jugendlicher im interkulturellen Kontext zu berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Kinder, Jugendliche, Krieg, Flucht, Trauma, Psychotraumatologie, Traumatherapie, Kunsttherapie, interkulturelle Kompetenz, Diagnosekriterien, Pathogenese, Risikofaktoren, Tf-KBT, Narrative Expositionstherapie.
Häufig gestellte Fragen zu: Posttraumatische Belastungsstörung bei Kindern und Jugendlichen im Kontext von Krieg und Flucht
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Kontext von Krieg und Flucht. Es beinhaltet eine Einleitung mit Fallbeispiel, ein Inhaltsverzeichnis, die Definition von Trauma, Diagnosekriterien der PTBS nach DSM-IV-TR, die Pathogenese der PTBS, verschiedene traumatherapeutische Ansätze (inklusive Kunsttherapie mit interkulturellen Aspekten) sowie eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Wie wird der Begriff "Trauma" definiert?
Das Dokument unterscheidet zwischen einer phänomenologischen Definition (existentielle Bedrohung, Überforderung des Ichs, Ohnmacht) und einer klassifikationsbasierten Definition. Die Bandbreite traumatisierender Ereignisse nach Leonore Terr wird ebenfalls beleuchtet, um die Vielfalt möglicher Traumata zu veranschaulichen.
Welche Diagnosekriterien der PTBS bei Kindern werden beschrieben?
Die Diagnosekriterien der PTBS bei Kindern nach DSM-IV-TR werden detailliert dargestellt, um eine fundierte Beurteilung des Vorliegens einer PTBS zu ermöglichen.
Wie wird die Pathogenese der PTBS erklärt?
Die Entstehung von PTBS wird anhand der Funktionsweise des Gehirns bei Gefahr und traumatischen Ereignissen erläutert. Das Entstehungsmodell von Ehlers und Clark (Gedächtnisdefizite, dysfunktionale kognitive Bewertungen, Aufrechterhaltung dysfunktionalen Verhaltens) sowie Risikofaktoren werden diskutiert.
Welche traumatherapeutischen Ansätze werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Ansätze: die drei Phasen der Traumatherapie (Stabilisierung, Traumabearbeitung/Exposition, Integration), die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (Tf-KBT), die narrative Expositionstherapie (KIDNET) und interkulturelle Aspekte der Kunsttherapie (Fähigkeiten, Zielsetzungen, Ansätze). Der Fokus liegt auf der Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse traumatisierter Kinder und Jugendlicher im interkulturellen Kontext.
Welche Rolle spielt die Kunsttherapie?
Die Kunsttherapie wird als wichtiger traumatherapeutischer Ansatz im interkulturellen Kontext vorgestellt. Es werden interkulturelle Fähigkeiten, Zielsetzungen und verschiedene kunsttherapeutische Ansätze beschrieben, um die spezifischen Bedürfnisse traumatisierter Kinder und Jugendlicher zu berücksichtigen.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Fachkräfte im Bereich der Psychotraumatologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kunsttherapie und für alle, die sich mit der Behandlung traumatisierter Kinder und Jugendlicher, insbesondere im Kontext von Krieg und Flucht, befassen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Kinder, Jugendliche, Krieg, Flucht, Trauma, Psychotraumatologie, Traumatherapie, Kunsttherapie, interkulturelle Kompetenz, Diagnosekriterien, Pathogenese, Risikofaktoren, Tf-KBT, Narrative Expositionstherapie.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bei Kindern und Jugendlichen im Kontext Krieg- und Fluchterleben, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/378204