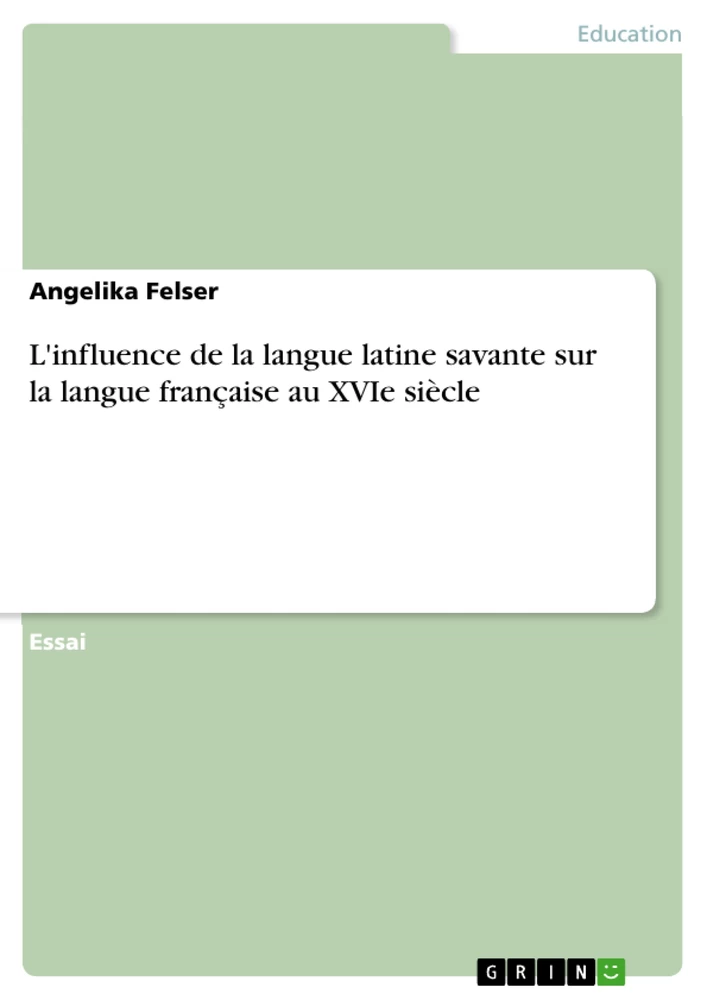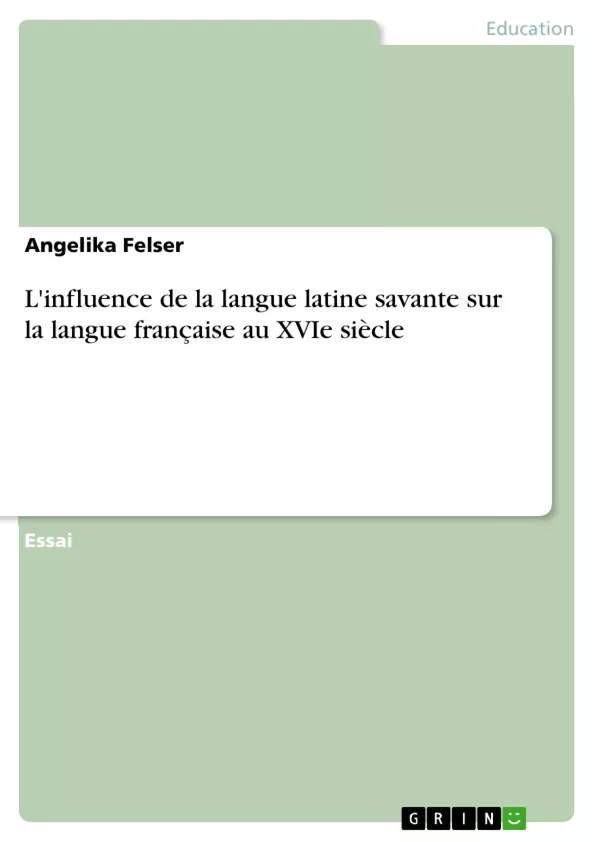Par « influence de la langue latine savante sur la langue française au XVIe siècle » l'on entend l’influence que le latin écrit et le langage technique fixé par écrit ont exercé sur la langue française.
Dès les premiers textes considérés comme français (« Les Serments de Strasbourg » de 842, « Séquence de Sainte Eulalie » de 882/83), les Français empruntent des mots savants à des textes écrits en grec ou en latin. Ainsi des mots tels que « honestet, nobilitet, virginitet » ont été empruntés très tôt (voir la « Séquence de Sainte Eulalie »).
Au XIIe et XIIIe siècle, l’influence de la langue latine savante sur la langue française est considérable et augmente, désormais grâce à l’influence qu’elle exerce dans les domaines du droit, de l’église et des sciences.
L'influence atteint son apogée entre le XIVe et le XVIe siècle, « Renaissance » du XIIe siècle.
Les humanistes essayaient de restituer la langue latine dans sa pureté antique.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Übersetzung antiker Werke und die Erweiterung des französischen Wortschatzes
- 2. Wortschatzentwicklung durch "Mots Savants"
- 3. "Mots Demi-Savants" und Relatinisierungen
- 4. Calques und Derivation als Methoden der Wortschatzerweiterung
- 5. Proteste gegen den Gebrauch von gelehrten lateinischen Wörtern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht den Einfluss der gelehrten lateinischen Sprache auf die französische Sprache im 16. Jahrhundert. Es wird analysiert, wie lateinische Wörter und Ausdrücke die französische Sprache bereicherten und zu ihrer Entwicklung beitrugen.
- Übersetzungen antiker Texte und ihre Auswirkungen auf den französischen Wortschatz
- Die verschiedenen Arten des lateinischen Einflusses (Mots savants, Mots demi-savants, Relatinisierungen)
- Methoden der Wortschatzerweiterung (Calques, Derivation)
- Die Rolle der Humanisten und der Pléiade
- Kontroversen um den Gebrauch lateinischer Lehnwörter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Übersetzung antiker Werke und die Erweiterung des französischen Wortschatzes: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Übersetzung antiker griechischer und lateinischer Texte für die Entwicklung der französischen Sprache im 16. Jahrhundert. Die Übersetzungstätigkeit von Humanisten wie Louis Meigret, Jacques Peletier du Mans, Geoffrey Tory und Jacques Lefèvre d'Etaples wird hervorgehoben, wobei deren Übersetzungen klassischer Werke wie der Aristoteles' "Traité du monde", Homers "Odyssee" und der Bibel den französischen Wortschatz bereicherten. Der Mangel an adäquaten Ausdrücken im Französischen für die Wiedergabe antiker Konzepte wird als Haupttreiber für die direkte Übernahme lateinischer Wörter identifiziert. Das Kapitel unterstreicht die zentrale Rolle der Übersetzung im Prozess des sprachlichen Wandels und der Erweiterung des französischen Vokabulars, um die komplexen und nuancierten Bedeutungen der antiken Texte adäquat wiedergeben zu können. Die zunehmend große Bedeutung und das Prestige der französischen Sprache werden im Kontext des lateinischen Einflusses erörtert.
2. Wortschatzentwicklung durch "Mots Savants": Dieses Kapitel analysiert die direkte Übernahme lateinischer Wörter ("Mots savants") in die französische Sprache. Es werden Beispiele wie "client," "culture," "famille," "question," und "sujet" genannt, die ihre ursprüngliche lateinische Form weitgehend beibehielten. Die Funktionen dieser Lehnwörter werden detailliert beschrieben: Sie dienten dazu, lexikalische Lücken zu schließen, die Mehrdeutigkeit bestehender Wörter zu reduzieren und den wissenschaftlichen Diskurs zu präzisieren. Der Abschnitt behandelt auch die Frage, ob die Einführung gelehrter Wörter den Wortschatz bereicherte oder ob sie zu einer Fragmentierung bestehender Wortfamilien führte. Die statistische Verteilung der "Mots savants" (z.B. der hohe Anteil an Substantiven) wird ebenfalls betrachtet, um das Ausmaß und die Charakteristika dieser sprachlichen Entwicklung zu belegen.
3. "Mots Demi-Savants" und Relatinisierungen: Das Kapitel widmet sich den "Mots demi-savants", Wörtern mit volkstümlicher Herkunft, die jedoch nicht alle phonetischen und semantischen Veränderungen durchlaufen haben, sowie den Relatinisierungen. Es wird zwischen externer Relatinisierung (Rückbesinnung auf die lateinische Wortform) und interner Relatinisierung (Anpassung der Bedeutung an das lateinische Vorbild) unterschieden. Beispiele wie "l'esprit" (von "spiritus") und "utile" (von "utilem") veranschaulichen die "Mots demi-savants". Die Relatinisierungen werden an Beispielen wie "la vérité" (von "veritas") und "histoire" (von "historia") erläutert, wobei die verschiedenen Funktionen dieser Prozesse – die Schließung lexikalischer Lücken, die stilistische Aufwertung und die Beseitigung von Homonymien – im Detail dargestellt werden. Die Bedeutung der Relatinisierungen für die Vermeidung von Mehrdeutigkeiten und die Schaffung sprachlicher Präzision wird ebenfalls hervorgehoben.
4. Calques und Derivation als Methoden der Wortschatzerweiterung: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von "Calques" (Lehnübersetzungen) und Derivation auf die Erweiterung des französischen Wortschatzes. Es werden Beispiele aus den Werken der Pléiade genannt, wie "chèvre-pied" oder "pied-vin", die dem Griechischen entlehnt sind. Die Derivation wird als Methode beschrieben, bei der einheimische Wortstämme mit lateinischen oder griechischen Affixen kombiniert werden, oder gelehrte Wortstämme mit volkstümlichen Affixen. Die Bildung von Adjektiven wie "initiatif" und Verben wie "familiariser" wird als Beispiel genannt. Die Entstehung von zusammengesetzten Wörtern und die Neubildung von Wörtern, die in den antiken Sprachen nicht existierten (wie "gigantal" bei Rabelais), wird erklärt, um die Kreativität und Innovation im Umgang mit dem lateinischen Erbe zu verdeutlichen. Es wird aufgezeigt, wie durch Kombination unterschiedlicher sprachlicher Elemente neue Wörter entstanden.
5. Proteste gegen den Gebrauch von gelehrten lateinischen Wörtern: Der letzte Abschnitt thematisiert die Kritik an der starken lateinischen Präsenz in der französischen Sprache des 16. Jahrhunderts. Die Proteste von Linguisten wie Abel Mathieu und Jacques Davy Du Perron werden vorgestellt, die den Gebrauch von Latinismen durch französische Ausdrücke ersetzen wollten. Beispiele für Mathieus Vorschläge werden gegeben ("avantchambre" statt "antichambre"). Das Kapitel schliesst mit der Feststellung, dass die meisten dieser Proteste keinen nachhaltigen Einfluss hatten und viele lateinische Wörter in doppelter Form (volkstümlich und gelehrt) in die Sprache eingingen. Es zeigt somit die Kontroverse und den komplexen Prozess der sprachlichen Entwicklung auf.
Schlüsselwörter
Lateinischer Einfluss, Französische Sprache, 16. Jahrhundert, Humanismus, Übersetzung, Wortschatzerweiterung, Mots savants, Mots demi-savants, Relatinisierung, Calques, Derivation, Pléiade, Sprachkritik, Latinismen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Einfluss des Lateinischen auf die französische Sprache im 16. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Dieser Text untersucht umfassend den Einfluss der lateinischen Sprache auf die Entwicklung des französischen Wortschatzes im 16. Jahrhundert. Er analysiert verschiedene Methoden der Wortschatzerweiterung und die damit verbundenen Kontroversen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Die Übersetzung antiker Werke und die Erweiterung des französischen Wortschatzes; 2. Wortschatzentwicklung durch "Mots Savants"; 3. "Mots Demi-Savants" und Relatinisierungen; 4. Calques und Derivation als Methoden der Wortschatzerweiterung; 5. Proteste gegen den Gebrauch von gelehrten lateinischen Wörtern.
Welche Rolle spielten Übersetzungen antiker Texte?
Kapitel 1 betont die entscheidende Rolle von Übersetzungen antiker griechischer und lateinischer Texte für die Erweiterung des französischen Wortschatzes. Der Mangel an adäquaten französischen Entsprechungen für komplexe antike Konzepte führte zur direkten Übernahme lateinischer Wörter. Die Übersetzungen von Humanisten wie Louis Meigret, Jacques Peletier du Mans, Geoffrey Tory und Jacques Lefèvre d'Etaples werden als besonders wichtig hervorgehoben.
Was sind "Mots Savants" und wie wirkten sie sich aus?
Kapitel 2 analysiert die direkten Entlehnungen lateinischer Wörter ("Mots savants") wie "client," "culture," "famille," "question," und "sujet". Diese Wörter schlossen lexikalische Lücken, reduzierten Mehrdeutigkeiten und präzisierten den wissenschaftlichen Diskurs. Der Text diskutiert auch mögliche negative Auswirkungen, wie eine Fragmentierung bestehender Wortfamilien.
Was sind "Mots Demi-Savants" und Relatinisierungen?
Kapitel 3 behandelt "Mots demi-savants", Wörter volkstümlicher Herkunft mit teilweise erhaltener lateinischer Form, und Relatinisierungen (externe: Rückbesinnung auf die lateinische Form; interne: Anpassung der Bedeutung an das lateinische Vorbild). Beispiele wie "l'esprit" und "utile" veranschaulichen "Mots demi-savants", während "la vérité" und "histoire" die Relatinisierungen illustrieren. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Mehrdeutigkeiten und der Schaffung sprachlicher Präzision.
Welche weiteren Methoden der Wortschatzerweiterung werden behandelt?
Kapitel 4 untersucht "Calques" (Lehnübersetzungen) und Derivation. "Calques" wie "chèvre-pied" oder "pied-vin" werden anhand von Beispielen aus den Werken der Pléiade erläutert. Die Derivation beschreibt die Kombination einheimischer Wortstämme mit lateinischen/griechischen Affixen oder umgekehrt. Die Bildung von Wörtern wie "initiatif" und "familiariser" wird als Beispiel genannt.
Gab es Kritik am lateinischen Einfluss?
Kapitel 5 beschreibt die Proteste gegen die starke lateinische Präsenz im 16. Jahrhundert. Linguisten wie Abel Mathieu und Jacques Davy Du Perron plädierten für den Ersatz von Latinismen durch französische Ausdrücke. Obwohl diese Proteste teilweise erfolglos blieben, beleuchten sie die Kontroverse und den komplexen Prozess der sprachlichen Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Lateinischer Einfluss, Französische Sprache, 16. Jahrhundert, Humanismus, Übersetzung, Wortschatzerweiterung, Mots savants, Mots demi-savants, Relatinisierung, Calques, Derivation, Pléiade, Sprachkritik, Latinismen.
- Quote paper
- Angelika Felser (Author), 1998, L'influence de la langue latine savante sur la langue française au XVIe siècle, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/377998