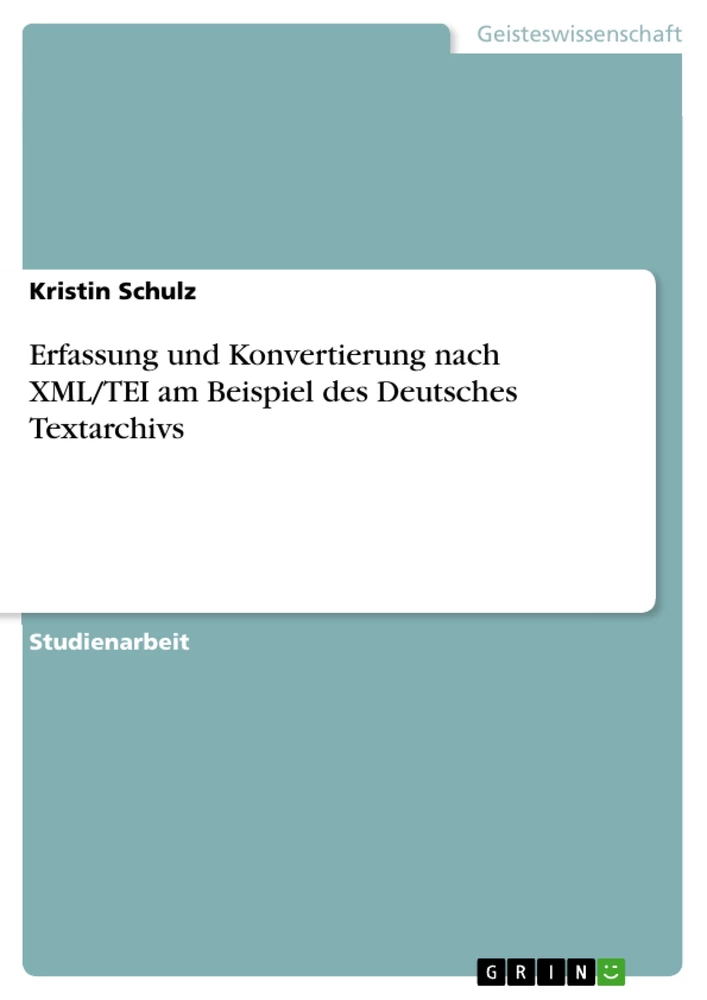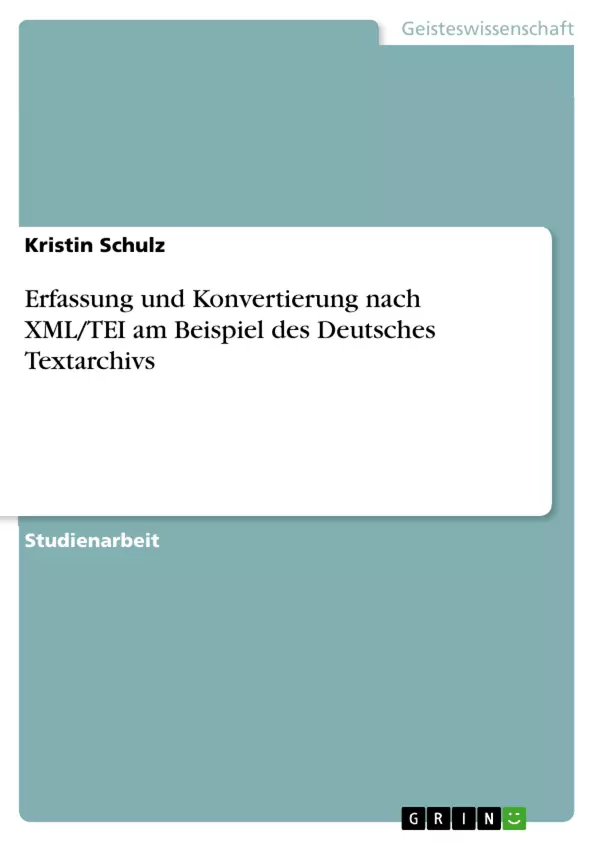Die Bestandserhaltung von kulturellem Erbe (durch Schonung von kostbaren und fragilen Originalen) und der Wunsch nach Forschung an direkten Quellen ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Durch Brände (Anna Amalia Bibliothek in Weimar), Einsturz von Gebäuden (Stadtarchiv in Köln), aber auch schlecht belüftete Magazine und Archive, Wassereinbrüche und viele andere Ursachen, wird immer wieder deutlich, wie wichtig die Sicherung von kulturellem Gut ist.
Andererseits lässt die Digitalisierung sämtlicher Bestände aus Bibliotheken, Archiven und Museen eine neue Infrastruktur entstehen, die das Internet zu einem Forschungsraum für eine zunehmende digital ausgerichtete Forschung macht. Das Ziel der Digitalisierung ist also nicht nur das Bereitstellen, sondern das Vernetzen von unterschiedlichen Ressourcen im Netz, um eine virtuelle Forschungsinfrastruktur entsteht zu lassen.
Das Digitalisierungsprojekt „Deutsches Textarchiv“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen disziplinen- und gattungsübergreifenden Grundbestand deutschsprachiger Texte aus dem Zeitraum von ca. 1600 bis 1900 nach den Erstausgaben zu digitalisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie geht die Digitalisierung von statten?
- DAS Deutsche Textarchiv
- Scannen
- Vorstrukturierung
- Nachbearbeitung
- Beispiel einer Konvertierung nach XML P5
- Überprüfung der Seitenzahlen
- Strukturierung der Titelblätter
- Interaktive Vorkorrektur
- Fehlerbehebung
- Überprüfen der Sonderzeichen/Transkriptionsfehler
- Runde s in Antiqua
- Falsche Schachtelung der d-Ebenen (Hierarchien)
- Validierung
- Qualitätskontrolle
- DTAQ-Qualitätssicherung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Digitalisierung von Texten im Kontext des Deutschen Textarchivs (DTA). Sie beleuchtet die verschiedenen Schritte und Herausforderungen bei der Konvertierung von Texten nach XML/TEI, wobei das DTA-Projekt als Fallbeispiel dient.
- Bestandserhaltung und Sicherung von kulturellem Gut
- Digitalisierung als Grundlage für eine virtuelle Forschungsinfrastruktur
- Die Rolle von XML/TEI bei der Volltextdigitalisierung
- Die Bedeutung von Metadaten für Auffindbarkeit und Nutzbarkeit digitaler Ressourcen
- Das DTA-Projekt: Ziele, Methoden und Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung befasst sich mit den aktuellen Herausforderungen der Bestandserhaltung und der Bedeutung der Digitalisierung für die Forschung. Sie betont die Vorteile der Digitalisierung für die Forschung, wie zum Beispiel die verbesserte Zugänglichkeit und Vernetzung von Ressourcen.
- Wie geht die Digitalisierung von statten?: Dieses Kapitel erklärt die verschiedenen Schritte der Digitalisierung, von der Image-Digitalisierung bis zur Volltextdigitalisierung. Es beleuchtet die Bedeutung von Metadaten und die Vorteile der TEI-Standards für die Volltextdigitalisierung.
- DAS Deutsche Textarchiv: Dieses Kapitel stellt das DTA-Projekt vor und erläutert die Ziele und die Vorgehensweise bei der Digitalisierung eines disziplinen- und gattungsübergreifenden Grundbestands deutschsprachiger Texte.
- Scannen: Der Abschnitt beleuchtet die Kooperationspartner des DTA-Projekts und die Rolle der Bibliotheken bei der Bereitstellung der Textvorlagen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Digitalisierung von Texten, dem Deutschen Textarchiv (DTA), XML/TEI, Metadaten, Volltextdigitalisierung, Bestandserhaltung, Forschungsinfrastruktur, TEI-Standards, Retrodigitalisierung.
- Arbeit zitieren
- Kristin Schulz (Autor:in), 2016, Erfassung und Konvertierung nach XML/TEI am Beispiel des Deutsches Textarchivs, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/377692