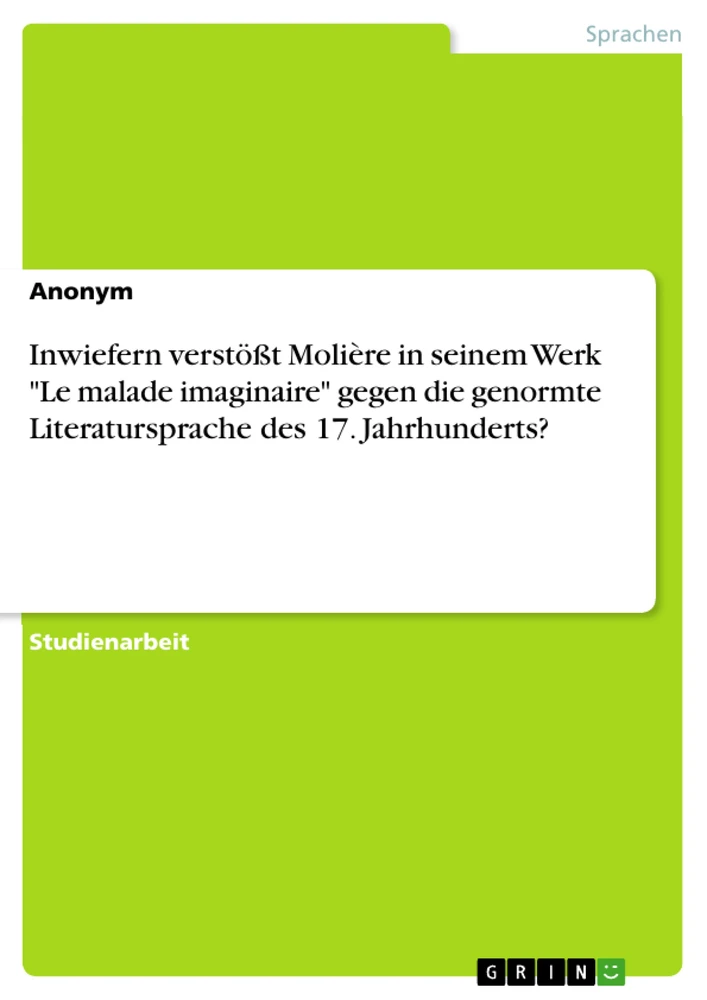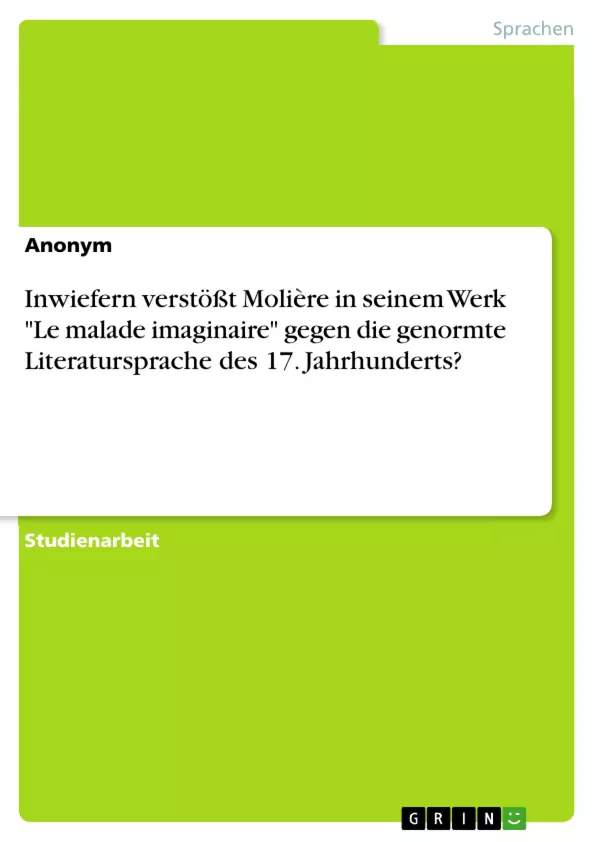In dieser Hausarbeit befasse ich mich mit folgender Fragestellung: Inwiefern verstößt Molière in seinem Werk Le malade imaginaire gegen die genormte Literatursprache des 17. Jahrhunderts? Um diese Frage beantworten zu können, stelle ich zunächst Molière als Person vor. Einen besonderen Fokus möchte ich auf seine Entwicklung zum Theatermenschen und seine Beziehung zu Louis XIV. legen.
Danach gehe ich auf sein Werk "Le malade imaginaire" ein, wobei ich dieses zunächst inhaltlich darstellen möchte, um anschließend auch einen kurzen Abriss der Aufführungs- und Editionsgeschichte zu geben. Gleichzeitig werde ich versuchen in diesem Abschnitt auch mögliche historische Gründe für die Editionsgeschichte anzugeben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Molière und sein Theater
- III. Le malade imaginaire
- III.1. Aufbau und Inhalt
- III.2. Editionsgeschichte
- IV. Sprachnormierung
- V. Analyse: Inwiefern verstößt Molière in seinem Werk Le malade imaginaire gegen die genormte Literatursprache des 17. Jahrhunderts?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, inwiefern Molières "Le malade imaginaire" von den literarischen Sprachnormen des 17. Jahrhunderts abweicht. Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in Molières Leben und Wirken, besonders seiner Beziehung zum Theater und zu Ludwig XIV. Anschließend wird "Le malade imaginaire" hinsichtlich seines Inhalts und seiner Editionsgeschichte beleuchtet. Die Sprachnormierung des 17. Jahrhunderts, inklusive der Ansätze von Malherbe und Vaugelas, sowie die Rolle der Académie française, wird erläutert. Schließlich analysiert die Arbeit, wie "Le malade imaginaire" sich zu diesen Normen verhält, wobei der Fokus auf Malherbes Sprachpurismus und der "Doctrine classique" liegt.
- Molières Leben und Karriere
- Inhalt und Editionsgeschichte von "Le malade imaginaire"
- Sprachnormierung im 17. Jahrhundert (Malherbe, Vaugelas, Académie française)
- Analyse der sprachlichen Abweichungen in "Le malade imaginaire"
- Zusammenhang zwischen Molières Werk und dem gesellschaftlichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung präsentiert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Inwiefern weicht Molières "Le malade imaginaire" von der normierten Literatursprache des 17. Jahrhunderts ab? Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Untersuchung von Molières Leben, dem Werk "Le malade imaginaire", der Sprachnormierung des 17. Jahrhunderts und einer anschließenden Analyse umfasst. Die Einleitung betont den punktuellen Charakter der Analyse, die sich auf exemplarische Textstellen konzentriert, anstatt auf Vollständigkeit zu abzielen. Die Arbeit kündigt den teilweise fließenden Übergang zwischen Theorie und Analyse an.
II. Molière und sein Theater: Dieses Kapitel beleuchtet Molières Leben und Karriere, beginnend mit seiner Geburt in Paris als Sohn eines wohlhabenden Hoftapezierers. Es beschreibt seine Ausbildung, die Gründung der Schauspielgruppe "L'Illustre théâtre" und die Annahme des Künstlernamens Molière. Das Kapitel thematisiert die finanziellen Schwierigkeiten der Gruppe, die darauffolgende Zeit des Wandertheaters und die Bedeutung der Begegnung mit der "Comédie italienne". Es betont die Entwicklung von Molières eigenem Stil und seine Fähigkeit, diverse Publikumsschichten anzusprechen. Der Aufstieg Molières durch die Gunst Ludwig XIV. und die Gründung der "troupe du roi" werden detailliert beschrieben, ebenso wie der spätere Niedergang und Molières Tod kurz nach der Uraufführung des "Le malade imaginaire".
III. Le malade imaginaire: Dieses Kapitel widmet sich Molières Komödie "Le malade imaginaire". Der Aufbau und Inhalt der dreiaktigen Ballettkomödie werden vorgestellt, einschließlich der "Intermèdes". Das Kapitel beschreibt die Hauptfiguren Argan, Purgon, Fleurent, Béline, Angélique und Cléante und ihre Interaktionen. Es betont die thematische Auseinandersetzung mit Scheinheiligkeit, Ausbeutung und der Liebe. Die Rolle von Toinette und Béralde bei der Enthüllung der Intrigen und Argans letztendliche "Promotion" zum Arzt wird ebenfalls behandelt. Das Kapitel deutet auf weitere Konflikte im Bereich der Medizin hin, ohne diese detailliert zu analysieren.
Schlüsselwörter
Molière, Le malade imaginaire, Sprachnormierung, 17. Jahrhundert, Literatursprache, Sprachpurismus, Malherbe, Vaugelas, Doctrine classique, Académie française, Theater, Komödie, Ballettkomödie, Gesellschaftlicher Kontext, Louis XIV.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Molières "Le malade imaginaire" im Hinblick auf die Sprachnormierung des 17. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht, inwieweit Molières Komödie "Le malade imaginaire" von den literarischen Sprachnormen des 17. Jahrhunderts abweicht. Die Analyse konzentriert sich auf die Abweichungen von der normierten Literatursprache und setzt diese in den Kontext von Molières Leben, dem Werk selbst und der Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Molières Leben und Karriere, den Inhalt und die Editionsgeschichte von "Le malade imaginaire", die Sprachnormierung im 17. Jahrhundert (mit Fokus auf Malherbe, Vaugelas und der Académie française), eine detaillierte Analyse der sprachlichen Abweichungen in "Le malade imaginaire" und den Zusammenhang zwischen Molières Werk und dem gesellschaftlichen Kontext der Zeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Molière und seinem Theater, ein Kapitel zu "Le malade imaginaire" (Aufbau, Inhalt und Editionsgeschichte), ein Kapitel zur Sprachnormierung des 17. Jahrhunderts und schließlich die Analyse der sprachlichen Abweichungen in "Le malade imaginaire" im Vergleich zu den etablierten Normen.
Wie wird die Sprachnormierung des 17. Jahrhunderts behandelt?
Die Arbeit erläutert die Sprachnormierung des 17. Jahrhunderts, inklusive der Ansätze von Malherbe und Vaugelas und der Rolle der Académie française. Der Fokus liegt auf dem Sprachpurismus von Malherbe und der "Doctrine classique".
Wie wird "Le malade imaginaire" analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf exemplarische Textstellen, um aufzuzeigen, inwiefern Molière von den Normen der klassischen französischen Literatursprache abweicht. Die Analyse ist punktuell und strebt nicht nach Vollständigkeit, sondern nach einer repräsentativen Darstellung der sprachlichen Besonderheiten des Stückes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Molière, Le malade imaginaire, Sprachnormierung, 17. Jahrhundert, Literatursprache, Sprachpurismus, Malherbe, Vaugelas, Doctrine classique, Académie française, Theater, Komödie, Ballettkomödie, Gesellschaftlicher Kontext, Louis XIV.
Welche methodischen Aspekte werden hervorgehoben?
Die Arbeit betont den teilweise fließenden Übergang zwischen Theorie (Sprachnormierung) und Analyse (Molières Werk). Der methodische Ansatz umfasst die Untersuchung von Molières Biografie, dem Stück "Le malade imaginaire", der Sprachnormierung des 17. Jahrhunderts und einer darauf aufbauenden Analyse der sprachlichen Besonderheiten des Stückes.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern weicht Molières "Le malade imaginaire" von der normierten Literatursprache des 17. Jahrhunderts ab?
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Inwiefern verstößt Molière in seinem Werk "Le malade imaginaire" gegen die genormte Literatursprache des 17. Jahrhunderts?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/375957