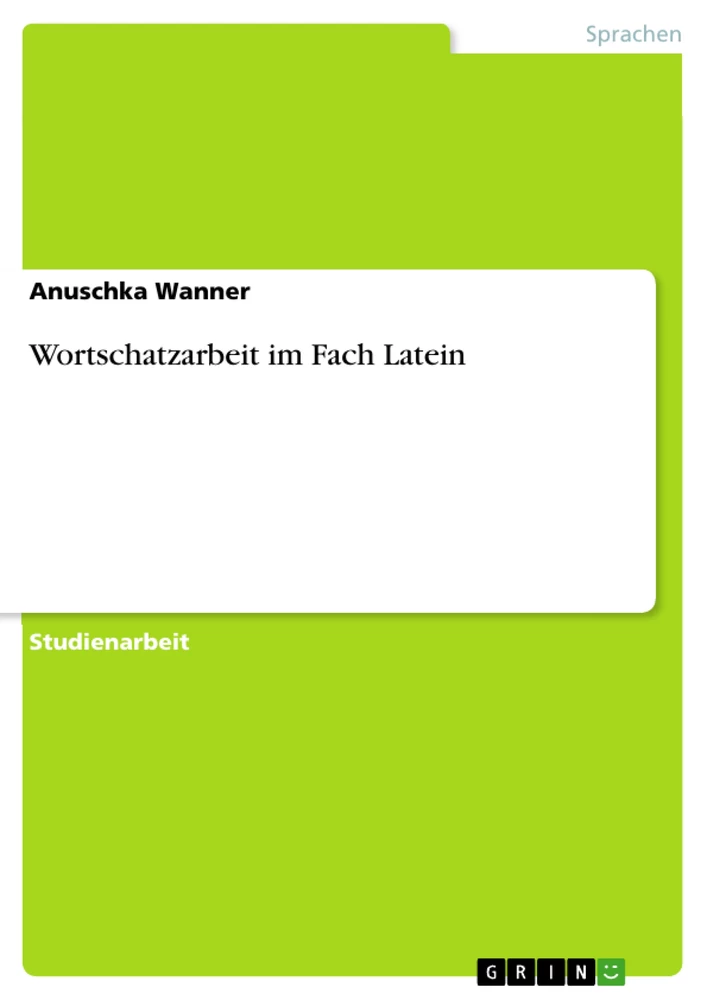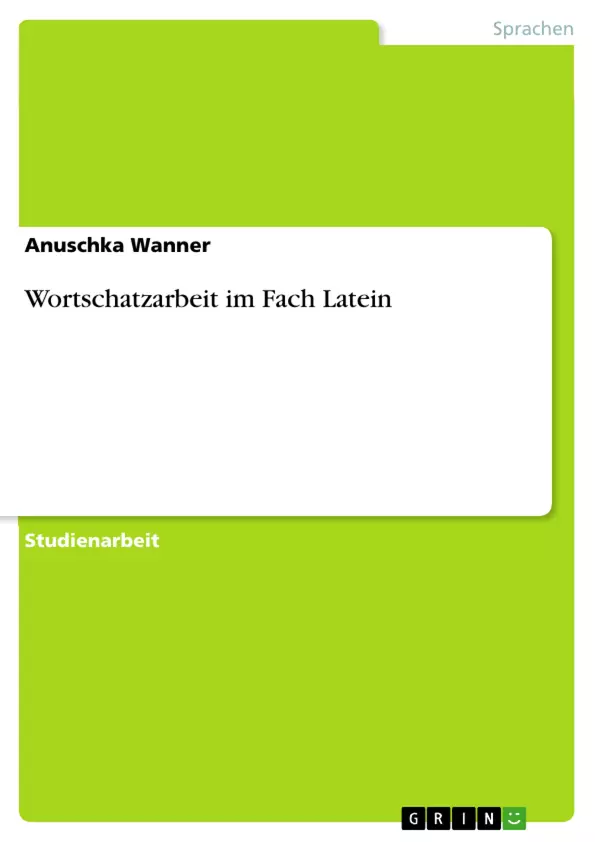In dieser Arbeit soll, im Anschluss an den Vortrag von Asmus Kurig beim DAV-Kongress in Berlin, das Thema Wortschatzarbeit besonderes Augenmerk erhalten. Dabei soll zunächst auf das mentale Lexikon eingegangen werden, das für die Speicherung der Wörter im Kopf verantwortlich ist. Ein Großteil der Arbeit wird jedoch der Wortschatzarbeit im Unterricht gewidmet sein, die verschiedene Phasen von der Einführung neuer Vokabeln über das Speichern und Wiederholen bis hin zum Überprüfen und Abfragen umfasst.
Ein eigener Aspekt erhält die Wortschatzarbeit in der Lektürephase, die sowohl für den Lehrenden als auch für den Lernenden eine Herausforderung darstellt. Abschließend soll das Beispiel der Vokabelkartei die individuelle Wortschatzarbeit des Schülers beleuchten, da diese selbständige und eigenverantwortliche (Schüler-)Arbeit für einen erfolgreichen Lateinunterricht unabdingbar ist.
Das Beherrschen von Vokabeln auf Seiten der Schüler ist unerlässlich für das Erlernen und Verstehen einer Fremdsprache. Mit der Bedeutung von Wörtern fällt das Verstehen und Übersetzen eines Textes. Dies gilt für die modernen Fremdsprachen ebenso wie für das Fach Latein. Jedoch fällt es den Schülern oft schwerer lateinische Vokabeln im Gedächtnis zu behalten, da diese nicht wie bei einer modernen Fremdsprache „imitativ erarbeitet und in einem kommunikativen Austausch ständig umgewälzt“ werden. Dies stellt erhöhte Ansprüche an den Lateinlehrer dar. Er muss die Wortschatzarbeit in seinem Unterricht besonders berücksichtigen und durch ständiges Wiederholen zur Speicherung der Vokabeln im Langzeitgedächtnis beitragen.
Dabei darf nie vergessen werden, dass Vokabellernen mehr als nur das stupide Auswendiglernen von Bedeutungen umfasst. Die Schüler müssen „mit den Vokabeln [.] auch ihre grammatikalischen Eigenschaften [wie] Wortart, Genus, Stammbildung und Stammformen sowie die Valenz“ erlernen. Einige Vokabeln wie virtus oder res publica vermitteln zudem „kulturelles und historisches Wissen“ und tragen zur Erweiterung der allgemeinen Bildung der Schüler bei.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das mentale Lexikon
- 3 Wortschatzarbeit im Unterricht
- 3.1 Einführung neuer Vokabeln
- 3.2 Speichern und Wiederholen
- 3.3 Überprüfen und Abfragen
- 3.4 Wortschatzarbeit in der Lektürephase
- 4 Individuelle Wortschatzarbeit des Schülers
- 5 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung effektiver Wortschatzarbeit im Lateinunterricht. Sie beleuchtet die psychologischen Grundlagen des Vokabellernens, indem sie das mentale Lexikon und seine Rolle bei der Speicherung und dem Abruf von Wörtern analysiert. Ein Schwerpunkt liegt auf verschiedenen Methoden zur Einführung, Wiederholung und Überprüfung von Vokabeln im Unterricht, inklusive der Herausforderungen der Lektürephase. Abschließend wird die Bedeutung individueller Wortschatzarbeit der Schüler hervorgehoben.
- Das mentale Lexikon und seine Funktion beim Vokabellernen
- Methoden der Wortschatzarbeit im Lateinunterricht
- Einführung neuer Vokabeln im Kontext
- Wiederholung und Überprüfung von Vokabeln
- Individuelle Wortschatzarbeit des Schülers
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung betont die zentrale Rolle des Vokabelschatzbeherrschens für das Verständnis von Fremdsprachen, insbesondere Latein. Sie hebt die Herausforderungen beim Behalten lateinischer Vokabeln im Vergleich zu modernen Fremdsprachen hervor und unterstreicht die Verantwortung des Lehrers für effektive Wortschatzarbeit. Der Text kündigt die Schwerpunkte der Arbeit an: das mentale Lexikon, die Wortschatzarbeit im Unterricht (Einführung, Speicherung, Wiederholung, Überprüfung und Arbeit in der Lektürephase) und die individuelle Wortschatzarbeit des Schülers.
2 Das mentale Lexikon: Dieses Kapitel befasst sich mit dem mentalen Lexikon als lernpsychologischer Grundlage der Wortschatzarbeit. Es beschreibt das mentale Lexikon anhand von Aitchisons Werk "Words in the Mind" als komplexen, menschlichen Wortspeicher mit fließenden Bedeutungsbeziehungen zwischen Wörtern, die in semantischen Feldern organisiert sind. Die "Spinnennetztheorie" wird erwähnt, um die Verknüpfungen zwischen Wörtern zu verdeutlichen. Das Kapitel beleuchtet auch den Prozess der Wortspeicherung, die Bildung von Lemmata und die Verknüpfung des mentalen Lexikons bei mehrsprachigen Lernenden.
3 Wortschatzarbeit im Unterricht: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die praktische Umsetzung der Wortschatzarbeit im Unterricht. Es beginnt mit der Problematik der Abgrenzung des zu lernenden Wortschatzes und bezieht sich auf Bildungspläne und den Landesbildungsserver Baden-Württemberg als Referenzpunkte für den Umfang des Grundwortschatzes. Es diskutiert verschiedene Methoden der Vokabeln-Einführung, die Vor- und Nachteile der präventiven Vokabelarbeit im Vergleich zur kontextbezogenen Einführung werden abgewägt. Der Text beschreibt verschiedene Techniken zur Einführung neuer Vokabeln im Unterricht, wie die induktive Einführung, Vorabsemantisierung und diverse kreative Methoden wie Paraphrasen, Synonyme, Antonyme, Wortfelder und Etymologie.
Schlüsselwörter
Mentales Lexikon, Wortschatzarbeit, Lateinunterricht, Vokabeln, Vokabellernen, Lektürephase, Methoden, Grundwortschatz, Bildungsplan, Sprachdidaktik, kognitive Prozesse.
Häufig gestellte Fragen zu: Effektive Wortschatzarbeit im Lateinunterricht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit effektiver Wortschatzarbeit im Lateinunterricht. Sie behandelt die psychologischen Grundlagen des Vokabellernens (mentales Lexikon), verschiedene Methoden zur Einführung, Wiederholung und Überprüfung von Vokabeln im Unterricht, die Herausforderungen der Lektürephase und die Bedeutung individueller Wortschatzarbeit der Schüler. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was ist das mentale Lexikon und welche Rolle spielt es beim Vokabellernen?
Das mentale Lexikon wird als komplexer, menschlicher Wortspeicher beschrieben, in dem Wörter mit fließenden Bedeutungsbeziehungen in semantischen Feldern organisiert sind. Es ist die lernpsychologische Grundlage der Wortschatzarbeit. Die Arbeit erläutert, wie Wörter gespeichert werden, Lemmata gebildet werden und wie das mentale Lexikon bei mehrsprachigen Lernenden funktioniert. Die "Spinnennetztheorie" wird als Metapher für die Verknüpfungen zwischen Wörtern verwendet.
Welche Methoden der Wortschatzarbeit im Lateinunterricht werden behandelt?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Methoden zur Einführung neuer Vokabeln, wie die induktive Einführung und Vorabsemantisierung. Sie vergleicht präventive Vokabelarbeit mit kontextbezogener Einführung und beschreibt kreative Methoden wie Paraphrasen, Synonyme, Antonyme, Wortfelder und Etymologie. Weiterhin werden Techniken zur Wiederholung und Überprüfung von Vokabeln im Unterricht behandelt, inklusive der Herausforderungen in der Lektürephase.
Wie wird die Bedeutung individueller Wortschatzarbeit des Schülers hervorgehoben?
Die Arbeit betont die Wichtigkeit der individuellen Wortschatzarbeit der Schüler, ohne jedoch konkrete Methoden oder Strategien hierfür detailliert zu beschreiben. Der Fokus liegt auf der Erkenntnis, dass effektives Vokabellernen nicht allein auf den Unterricht beschränkt ist, sondern auch die Eigeninitiative der Schüler erfordert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das mentale Lexikon, Wortschatzarbeit im Unterricht (mit Unterkapiteln zu Einführung neuer Vokabeln, Speichern und Wiederholen, Überprüfen und Abfragen, sowie Wortschatzarbeit in der Lektürephase), Individuelle Wortschatzarbeit des Schülers und Schlusswort.
Welche Herausforderungen werden in Bezug auf die Wortschatzarbeit im Lateinunterricht angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen beim Behalten lateinischer Vokabeln im Vergleich zu modernen Fremdsprachen und die Problematik der Abgrenzung des zu lernenden Wortschatzes. Sie bezieht sich auf Bildungspläne und den Landesbildungsserver Baden-Württemberg als Referenzpunkte für den Umfang des Grundwortschatzes. Die Lektürephase wird als besonders herausfordernde Phase der Wortschatzarbeit im Unterricht identifiziert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Mentales Lexikon, Wortschatzarbeit, Lateinunterricht, Vokabeln, Vokabellernen, Lektürephase, Methoden, Grundwortschatz, Bildungsplan, Sprachdidaktik, kognitive Prozesse.
- Quote paper
- Anuschka Wanner (Author), 2016, Wortschatzarbeit im Fach Latein, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/375556