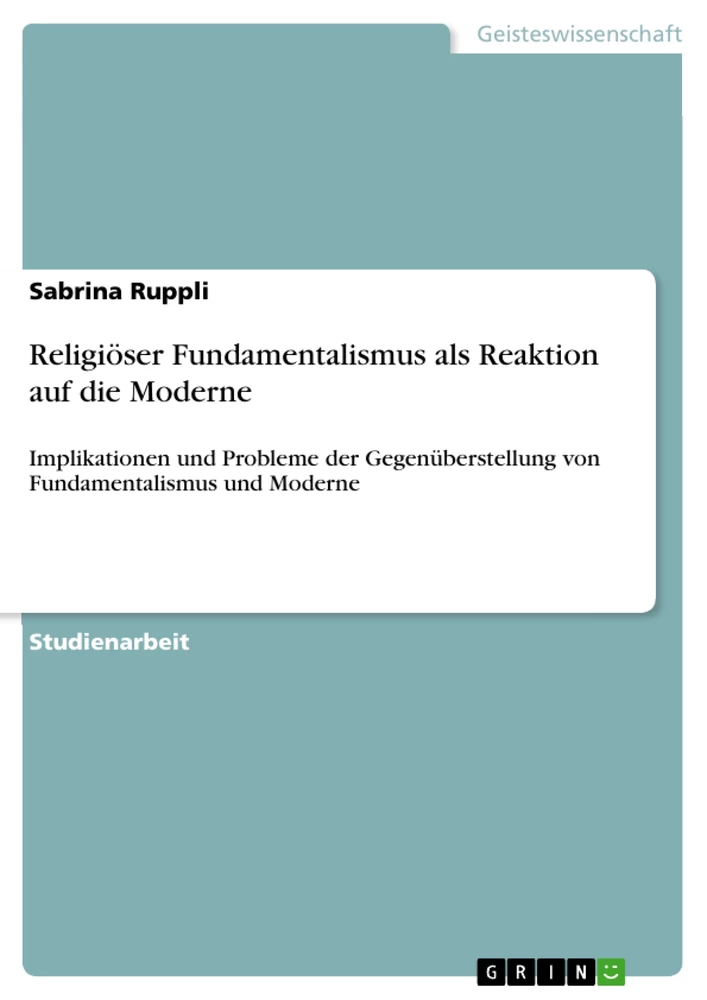Religiöser Fundamentalismus ist spätestens seit dem 11.September 2001 ein Schlagwort in der medialen und politischen Debatte. Vor allem im islamischen Kontext wird Fundamentalismus in Politik und Medien oftmals mit Gefahr und Rückwärtsgewandtheit assoziiert und als Gegensatz zu einer aufgeklärten, „modernen“ und westlichen Weltanschauung kontrastiert. Doch nicht nur Journalisten und Politiker, sondern auch Wissenschaftler setzen sich mit dem Phänomen des Fundamentalismus auseinander, wobei der Begriff gerade unter Wissenschaftlern umstritten ist.
Sehr verschiedene Bewegungen werden gemeinhin als fundamentalistisch bezeichnet. Verfechter des Fundamentalismuskonzeptes, u.a. der Soziologe Martin Riesebrodt, Sivan, Tibi oder Marty/Appleby sind sich darin einig, dass all diese Bewegungen eine Gemeinsamkeit aufweisen; sie stellen eine Reaktion auf die Moderne dar. Wenn diese Reaktion auf die Moderne aber als einziges Kriterium genommen wird, so können viele Phänomene in diese Kategorie fallen, die schwer miteinander vergleichbar sind. Beispiele dafür sind die Ablehnung der Priesterweihe der Frau, die Muslimbrüder in Ägypten, die iranische Revolution unter Khomeini oder das Tragen des Kopftuches in Westeuropa. Auch nichtreligiöse Bewegungen, wie Widerstände gegen demokratische Mehrheitsentscheidungen in Fragen von Werten und Normen oder Kritik an konkreten Missständen des kapitalistischen Wirtschaftssystems oder müssten mitgezählt werden. Ob der Fundamentalismusbegriff dann noch als wissenschaftliche Abgrenzungskategorie taugt, sei dahingestellt.
Diese Seminararbeit will ganz allgemein hinterfragen, was für ein Modernisierungsverständnis den Theorien zugrunde liegt, welche Fundamentalismus als Reaktion auf die Moderne bezeichnen. Des Weiteren soll betrachtet werden, welche Implikationen und Probleme eine Gegenüberstellung von Fundamentalismus und Moderne mit sich bringt. Besonderes Augenmerk soll dabei auf den „islamischen Fundamentalismus“ gelegt werden, da dieser in der allgemeinen Debatte oftmals nicht nur als Reaktion auf die Moderne, sondern explizit als Reaktion auf den Westen charakterisiert wird. In einem ersten Schritt wird die Entwicklung des Fundamentalismus-Begriffes umrissen. In einem zweiten Schritt werden dann das Konzept der westlichen Moderne und die Theorie des Clash of Civilizations erläutert, um in einem dritten Schritt festzustellen, inwieweit Fundamentalismus als Reaktion auf die Moderne betrachtet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 ENTWICKLUNG DES FUNDAMENTALISMUS-BEGRIFFES
- 3 VORÜBERLEGUNGEN
- 3.1 DENKEN IN GEGENSÄTZEN
- 3.2 FREMDGRUPPENHOMOGENITÄT
- 4 DIE MODERNE: EIN EUROZENTRISMUS?
- 5 THE CLASH OF CIVILIZATIONS
- 5.1 HUNTINGTONS THEORIE
- 5.2 KRITIK
- 5.2.1 KULTURRELATIVISMUS
- 5.2.2 REIN WESTLICHE MODERNE
- 5.2.3 RELIGIOn als KonflikTFAKTOR
- 6 FUNDAMENTALISMUS ALS ANTIMODERNE
- 6.1 FUNDAMENTALISMUS VS. WERTE DER AUFKLÄRUNG
- 6.2 ISLAMISCHER FUNDAMENTALISMUS VS. DEN WESTEN
- 6.3 DER GEBRAUCH MODERNER TECHNIK
- 7 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, welches Modernisierungsverständnis den Theorien zugrunde liegt, welche Fundamentalismus als Reaktion auf die Moderne bezeichnen. Sie untersucht zudem die Implikationen und Probleme, die mit einer Gegenüberstellung von Fundamentalismus und Moderne einhergehen. Der Fokus liegt dabei auf dem ,,islamischen Fundamentalismus“, der in der öffentlichen Debatte häufig als Reaktion auf den Westen charakterisiert wird.
- Entwicklung des Fundamentalismus-Begriffs
- Das Konzept der westlichen Moderne
- Die Theorie des Clash of Civilizations
- Fundamentalismus als Reaktion auf die Moderne
- Der ,,islamische Fundamentalismus“ im Kontext der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Begriff des religiösen Fundamentalismus ist seit den Ereignissen vom 11. September 2001 ein zentraler Begriff in medialen und politischen Debatten. Vor allem im islamischen Kontext wird Fundamentalismus oft mit Gefahr und Rückwärtsgewandtheit assoziiert und als Gegenentwurf zu einer „aufgeklärten“, „modernen“ und „westlichen“ Weltanschauung verstanden.
Entwicklung des Fundamentalismus-Begriffes: Der Begriff des religiösen Fundamentalismus entstammt dem amerikanischen Protestantismus der Jahrhundertwende. Die „Fundamentals“ stellten eine Reaktion auf die Modernisierung der christlichen Bibelwissenschaft dar, die sich zu stark an die Anforderungen der modernen Naturwissenschaften angepasst hatte.
Vorüberlegungen: Der Text betrachtet zunächst die Denkweise in Gegensätzen, die oft bei der Analyse von Fundamentalismus zu beobachten ist, sowie das Phänomen der „Fremdgruppenhomogenität“, die dazu führt, dass andere Kulturen und Religionen als homogen und einheitlich wahrgenommen werden.
Die Moderne: Ein Eurozentrismus?: Das Kapitel beleuchtet die Frage, ob die Moderne ein eurozentrisches Konzept ist, und stellt die These auf, dass die westliche Moderne nicht als universelles Modell betrachtet werden sollte.
The Clash of Civilizations: Der Text behandelt die Theorie des „Clash of Civilizations“ von Samuel Huntington, die den Konflikt zwischen westlichen und islamischen Kulturen als Haupttreiber von Konflikten im 21. Jahrhundert betrachtet.
Fundamentalismus als Antimoderne: Der letzte Abschnitt des Textes behandelt den Fundamentalismus als Reaktion auf die Moderne. Er analysiert die Kritik des Fundamentalismus an den Werten der Aufklärung und untersucht die Frage, ob der „islamische Fundamentalismus“ als Reaktion auf den Westen verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Religiöser Fundamentalismus, Moderne, Islamischer Fundamentalismus, Clash of Civilizations, The Fundamentals, Antimoderne, Kulturrelativismus, Westliche Moderne, Wertekampf, Aufklärung, Globalisierung.
- Quote paper
- Sabrina Ruppli (Author), 2013, Religiöser Fundamentalismus als Reaktion auf die Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/373558