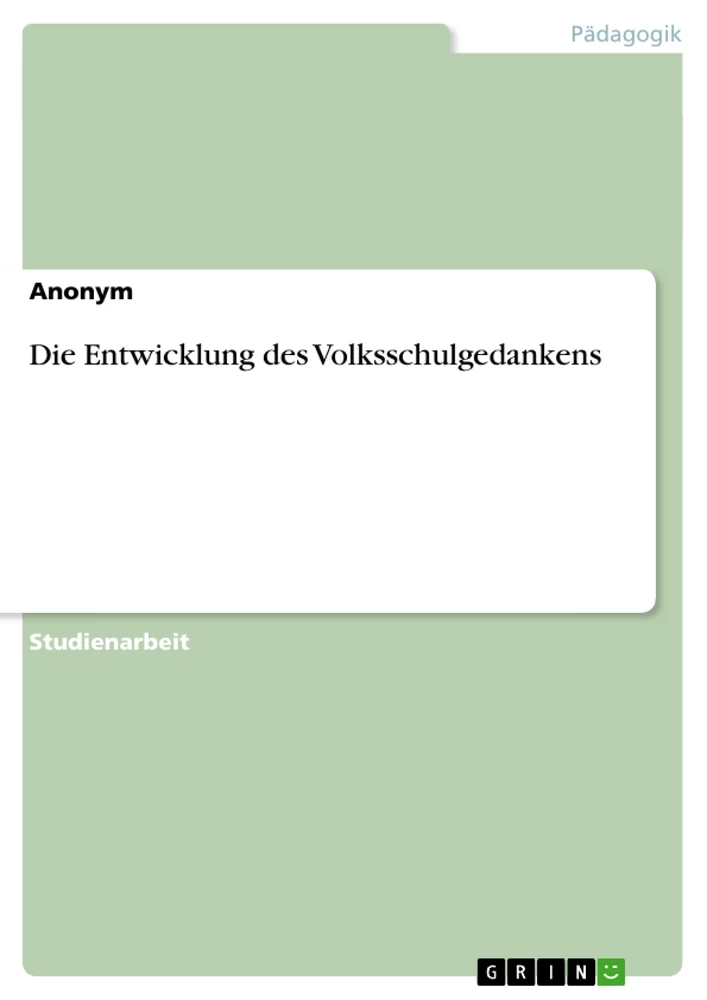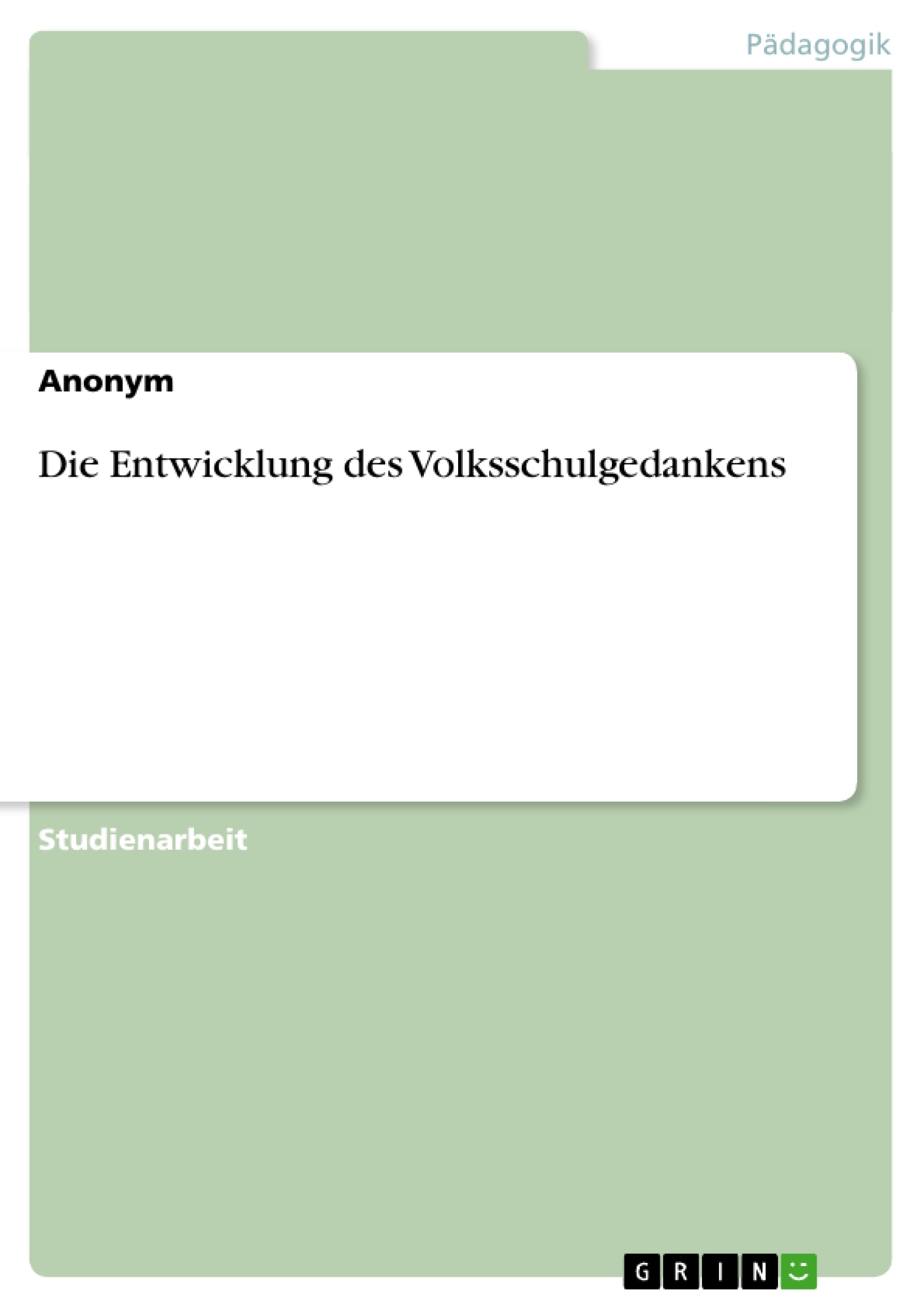Die Anfänge der Erziehung und Bildung „Schwachsinniger“ – Eine Einleitung
Wenn man die Geschichte der Lernbehindertenpädagogik betrachten möchte, so sollte man diese von der Geschichte der Geistigbehindertenpädagogik abgrenzen, was jedoch nicht so ganz einfach ist, da in den Anfängen ihrer Geschichte keine konkrete Abgrenzung zwischen Lernbehinderten und Geistigbehinderten vorgenommen wurde. Man hat fast bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts innerhalb der allgemein als lernbehindert Bezeichneten nicht zwischen geistig Behinderten und schlechten Schülern unterschieden. Begriffe wie „schwachsinnig“ oder „idiotisch“ wurden sowohl für schwer Geistigbehinderte als auch für weniger schwer intelligenzgeschädigte Kinder synonym verwendet. So greift die Geschichte der Lernbehindertenpädagogik sowohl in den Bereich der Geistigbehindertenpädagogik als auch in den Bereich der Volksschulpädagogik ein, denn ihre eigentliche Geschichte beginnt erst mit der Etablierung des Volksschulwesens. Dies wird sich im Verlauf der folgenden Arbeit auch feststellen lassen. Aber selbst innerhalb der Volksschule ist man nur bedingt in der Lage zwischen schlechten Schülern und Lernbehinderten zu unterscheiden, auch diese Grenze ist unscharf. Dem Problem der Diagnostik nimmt sich dann aber am Schluß meiner Arbeit Vinzenz Eduard Milde besonders an. Innerhalb meiner Arbeit werde ich auch allgemeine historische Rahmenbedingungen nicht außer Acht lassen, wie man im Inhaltsverzeichnis schon sehen konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Die Anfänge der Erziehung und Bildung „Schwachsinniger“ – Eine Einleitung
- Das Zeitalter der Renaissance und des Humanismus (13. Jahrhundert bis 1600)
- Der Einfluß der Reformation auf die Entwicklung der Volksschule
- Die,,Deutsche Schule“ und Peter Jordan aus Mainz
- Das Zeitalter des Barock (17. Jahrhundert) – Intelligenzschwache Kinder und Jugendliche in der frühen Volksschulpädagogik bei Comenius (1592-1670)
- Das Zeitalter des Pietismus (1675-1740) und der Aufklärung (18. Jahrhundert)
- Johann Ignaz von Felbiger (1724-1788)
- Vinzenz Eduard Milde (1777-1859)
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung des Volksschulgedankens und ersten schulischen Einrichtungen für (Lern-)Behinderte im Kontext der Geschichte der Behindertenpädagogik. Sie untersucht die Entstehung des Konzepts der Integration von (Lern-)Behinderten in das Einheitsschulsystem und beleuchtet die Rolle von bedeutenden Pädagogen wie Comenius in diesem Prozess.
- Die Anfänge der Erziehung und Bildung von Menschen mit geistigen und Lernbehinderungen
- Der Einfluss der Reformation und des Humanismus auf die Entwicklung der Volksschule
- Die Integration von (Lern-)Behinderten in das Einheitsschulsystem im Kontext der frühen Volksschulpädagogik
- Die Rolle bedeutender Pädagogen wie Comenius und die Herausforderungen der Diagnostik von Lernbehinderungen
- Die Entwicklung von Fürsorgekonzepten für Menschen mit Behinderungen im Wandel der historischen Epochen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Anfänge der Erziehung und Bildung „Schwachsinniger“ – Eine Einleitung: Das Kapitel stellt die Herausforderungen der Abgrenzung zwischen Geistigbehindertenpädagogik und Lernbehindertenpädagogik in der Frühzeit dar. Es wird deutlich, dass eine klare Unterscheidung zwischen Lernbehinderten und Geistigbehinderten erst mit der Etablierung des Volksschulwesens möglich wurde.
- Das Zeitalter der Renaissance und des Humanismus (13. Jahrhundert bis 1600): Dieses Kapitel beleuchtet die Erneuerungsbewegungen in Kunst, Literatur und Philosophie der Renaissance und deren Auswirkungen auf die Bildung. Es werden die Abkehr vom religiös-scholastischen Weltbild und die Hinwendung zum Daseinsgenuss sowie die Entwicklung von Nationalbegriffen und nationalen Schriftsprachen beschrieben. Der Humanismus fokussierte auf das Individuum und seine Selbstdarstellung, jedoch lassen sich in dieser Zeit kaum Ansätze zur Integration von Menschen mit Behinderungen erkennen.
- Der Einfluß der Reformation auf die Entwicklung der Volksschule: Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Bewusstseins persönlicher Verantwortlichkeit und subjektiver religiöser Entschiedenheit innerhalb der Reformation. Die Kirche als Heilinstitution wird in Frage gestellt und die Gleichheit der Gläubigen betont. Es entsteht ein Bedürfnis nach allgemeiner Volksbildung in deutscher Sprache und die individuelle Persönlichkeitsentfaltung gewinnt an Bedeutung. Die Arbeit wird als Berufung und Bewährung im diesseitigen Dasein gesehen, und dieser Ansatz findet auch bei Menschen mit Behinderungen Anwendung. Diese werden in Verwahranstalten zur Arbeit angewiesen, was einen Wandel in der Fürsorge darstellt.
- Die,,Deutsche Schule“ und Peter Jordan aus Mainz: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Peter Jordan und seinen Beitrag zur Entwicklung der "Deutschen Schule" und ihrer Bedeutung für die Bildung in deutscher Sprache. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Volksschule im Kontext des volkssprachlichen Unterrichts und der Bildung für alle.
- Das Zeitalter des Barock (17. Jahrhundert) – Intelligenzschwache Kinder und Jugendliche in der frühen Volksschulpädagogik bei Comenius (1592-1670): Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Comenius und seine Ansätze zur Integration von "intelligenzschwachen" Kindern und Jugendlichen in die Volksschule. Es werden seine pädagogischen Konzepte und die Bedeutung seiner Schriften für die Entwicklung der Behindertenpädagogik vorgestellt.
- Das Zeitalter des Pietismus (1675-1740) und der Aufklärung (18. Jahrhundert): Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Johann Ignaz von Felbiger und Vinzenz Eduard Milde im Kontext der Entwicklung von Fürsorge- und Bildungskonzepten für Menschen mit Behinderungen. Es werden die Ansätze dieser Pädagogen zur Integration und Förderung von Menschen mit Behinderungen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des Volksschulgedankens, die Integration von (Lern-)Behinderten in das Einheitsschulsystem, die Rolle von Comenius in der frühen Volksschulpädagogik, die Geschichte der Behindertenpädagogik, die Abgrenzung zwischen Geistigbehindertenpädagogik und Lernbehindertenpädagogik, die Bedeutung der Reformation und des Humanismus für die Bildung, die Herausforderungen der Diagnostik von Lernbehinderungen und die Entwicklung von Fürsorgekonzepten für Menschen mit Behinderungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2003, Die Entwicklung des Volksschulgedankens, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/37271