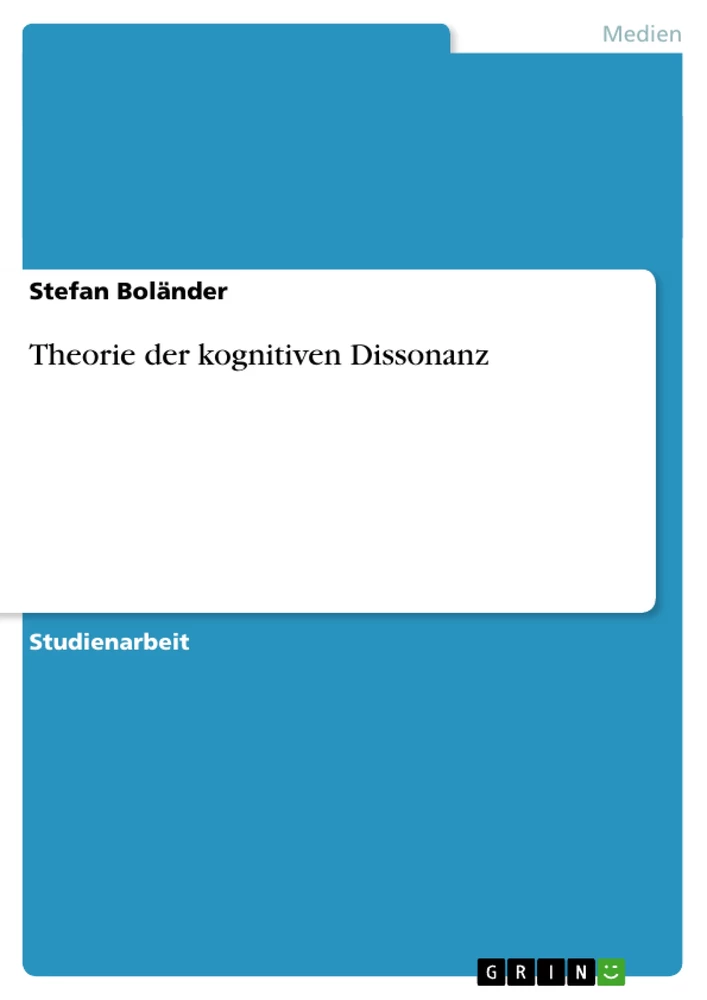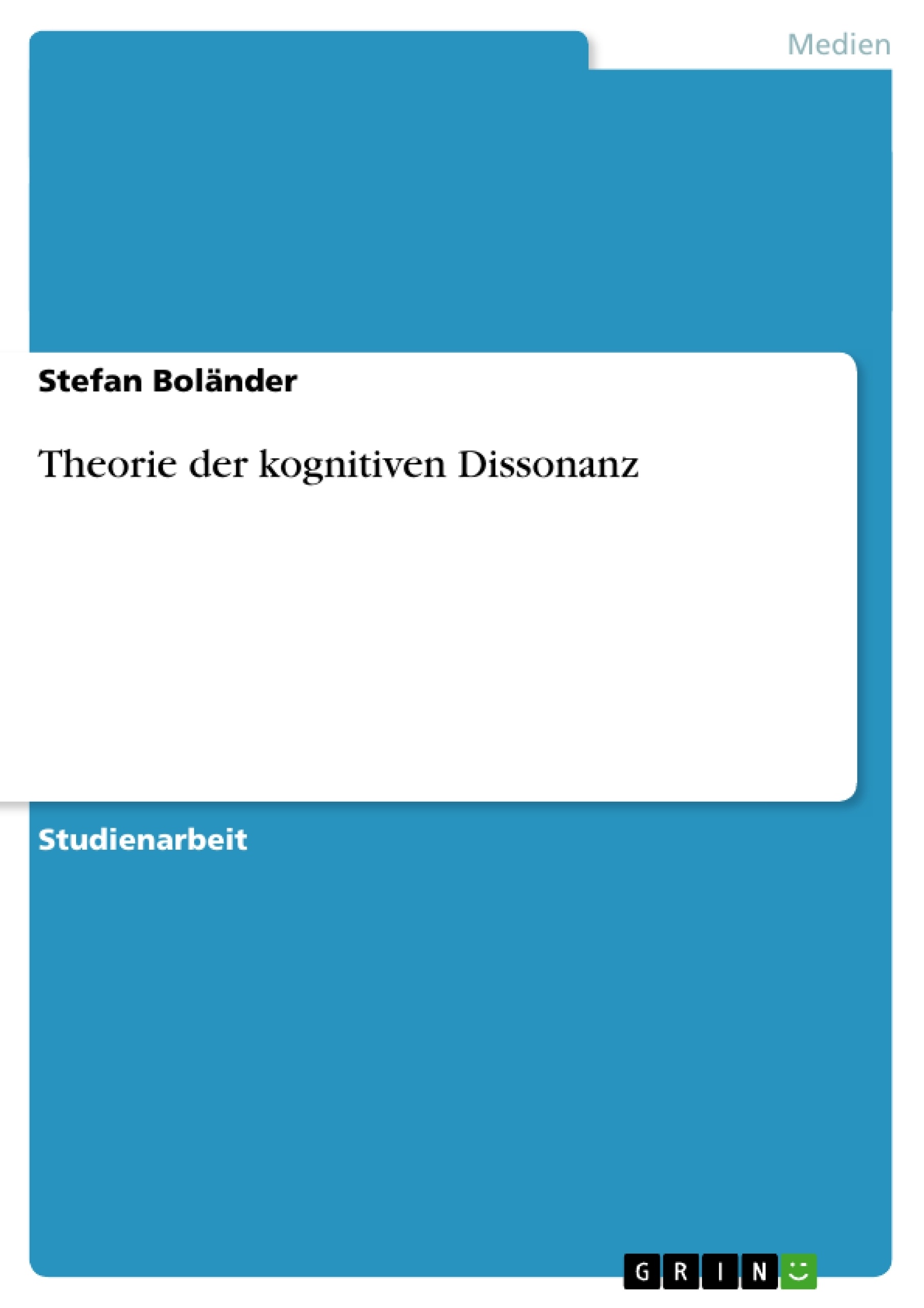[...] Die unterschiedlichen Vorgänge, die diese Fülle von Einflüssen in jedem von uns auslösen sind für uns so vertraut geworden, dass wir sie nicht mehr wirklich hinterfragen. Dies scheint auch allzu selbstverständlich, da man sich wohl eher mit dem Besonderen als mit dem Normalen beschäftigt. Jeden Tag nehmen wir ganz bewusst und auch unbewusst unzählige Informationen auf, die uns über eine große Zahl von Medien gesendet werden. Daraus selektiert jeder für sich die Nachrichten die ihn interessieren von den für ihn uninteressanten Informationen. Die Richtung der Selektion richtet sich ganz nach den Interessen des Rezipienten der Nachricht. Von Zeit zu Zeit suchen wir auch gezielt Informationen, die ein bestimmtes Interesse stillen sollen. Als Konsumenten von Nachrichten bzw. Informationen sind wir zum Teil auch dem direkten Einfluss der Medien ausgesetzt. Sie versuchen unterbewusst unsere Entscheidungen zu manipulieren und so unser Verhalten, vor allem unser Konsumverhalten, in bestimmten Situationen in bestimmte Bahnen zu lenken. Die Medienwirkungsforschung untersucht genau diese Erscheinung des Medienzeitalters und seine Auswirkungen bei den Konsumenten. Man versucht herauszufinden durch welche Medien sich die meisten Konsumenten informieren und auf welche Weise hier eine Wirkung erzielt werden kann. Konsumenten bedienen sich den Medien aus unterschiedlichen Gründen und auf vielfältige Weise. Entscheidend ist, dass die Medien das Verhalten der Rezipienten beeinflussen können. Je nachdem aus welchem Grund sich der Rezipient einem Massenmedium zuwendet, erzielt die mediale Nachricht einen bestimmten Effekt bei ihm. Diese Wirkung ist von Konsument zu Konsument verschieden. Eine Theorie in der Kommunikationswissenschaft, die diesen Verhaltenshintergrund erklärt, ist die „Theorie der kognitiven Dissonanz“ von Leon Festinger. Im Folgenden möchte ich Professor Festingers Theorie nachvollziehbar erörtern. Ich werde seine Hypothesen und Grundannahmen vorstellen, die Auswirkungen und die Anwendung der Theorie darstellen. Die Theorie der kognitiven Dissonanz ist für die Kommunikationsforschung in ihrer Entwicklung wohl zu einer der wichtigsten Theorien geworden, da sie explizit Aussagen über das Informationsverhalten macht.1 1 Vgl. Schenk, Michael (2002). Kommunikationstheorien. In: E. Noelle-Neumann, W. Schulz & J. Wilke (Hrsg.). Fischer Lexikon Publizistik, Massenkommunikation. (6. aktualisierte Auflage), Frankfurt a.M.: Fischer. S. 171-187. S. 178.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie der Kognitiven Dissonanz
- Definition der Grundbegriffe
- Entstehung von kognitiver Dissonanz
- Stärke kognitiver Dissonanz
- Reduktion von kognitiver Dissonanz
- Reduktion durch Veränderung kognitiver Elemente
- Widerstand gegen die Reduktion kognitiver Dissonanz
- Vermeidung von kognitiver Dissonanz
- Anwendung der Theorie der kognitiven Dissonanz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit stellt die Theorie der kognitiven Dissonanz von Leon Festinger vor und erläutert deren Bedeutung für die Kommunikationswissenschaft. Dabei werden die Grundbegriffe, Entstehung, Stärke und Reduktion kognitiver Dissonanz sowie die Anwendung der Theorie in verschiedenen Bereichen beleuchtet.
- Definition und Bedeutung kognitiver Dissonanz
- Mechanismen der Entstehung und Reduktion kognitiver Dissonanz
- Anwendung der Theorie in der Kommunikationsforschung
- Zusammenhang zwischen kognitiver Dissonanz und Medienwirkung
- Bedeutung der Theorie für das Verständnis von Informationsverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Medienwirkung und die Theorie der kognitiven Dissonanz ein. Sie betont die Bedeutung der Medien im täglichen Leben und deren Einfluss auf das Informationsverhalten und die Entscheidungen der Rezipienten.
Die Theorie der Kognitiven Dissonanz
Dieser Abschnitt erläutert die Grundbegriffe der Theorie, wie Kognition, Konsonanz, Dissonanz und Irrelevanz. Er beleuchtet außerdem die Entstehung von kognitiver Dissonanz in Abhängigkeit von Entscheidungsfreiheit und Verantwortungsgefühl. Ein Beispiel aus einer Studie von Festinger und Carlsmith illustriert die Entstehung und Reduktion von Dissonanz.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie der kognitiven Dissonanz, einem zentralen Konzept der Kommunikationswissenschaft. Sie beleuchtet die Entstehung und Reduktion von Dissonanz, sowie die Anwendung der Theorie in der Medienwirkungsforschung und ihre Bedeutung für das Verständnis von Informationsverhalten. Weitere wichtige Schlagwörter sind Kognition, Konsonanz, Dissonanz, Irrelevanz, Entscheidungsfreiheit, Verantwortungsgefühl und Medienwirkung.
- Quote paper
- Stefan Boländer (Author), 2005, Theorie der kognitiven Dissonanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/37117