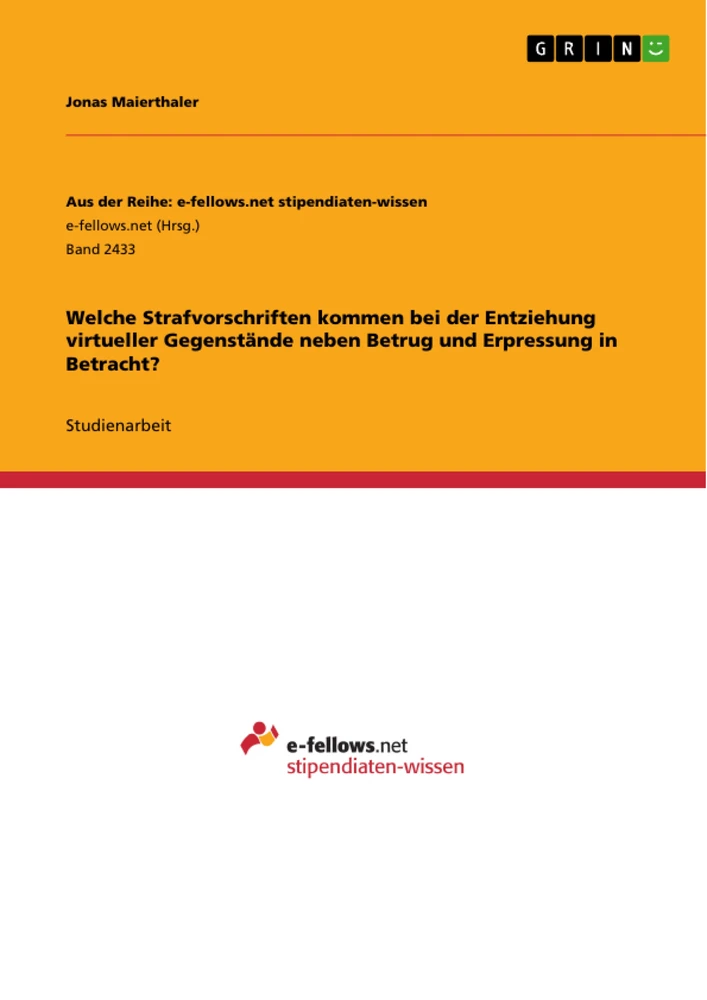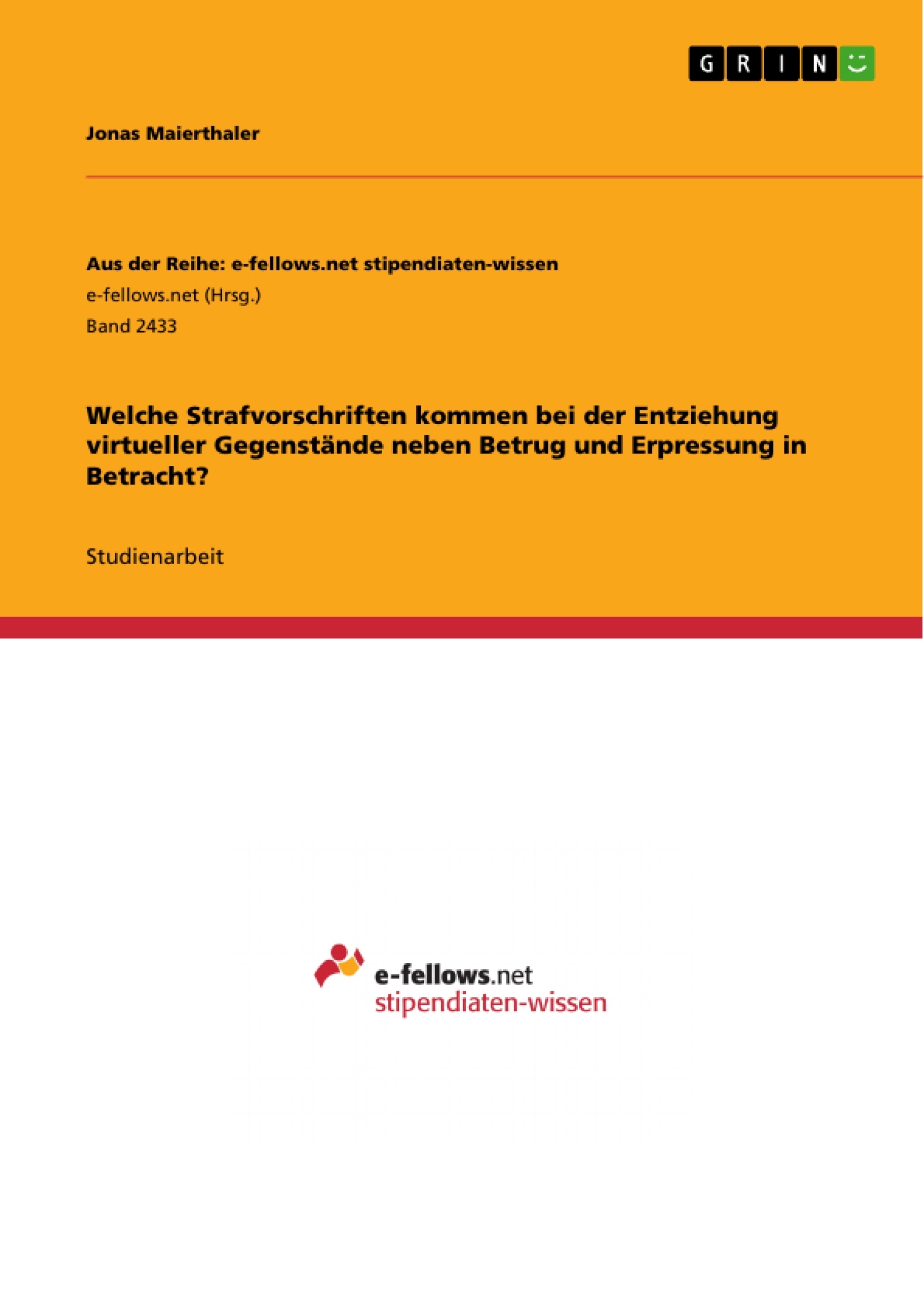Dies ist eine Seminararbeit aus dem Bereich IT-Strafrecht und behandelt die Frage, wie mit einem "Diebstahl" von Items in Onlinespielen strafrechtlich umgegangen werden soll. Neben der Behandlung der einschlägigen Normen aus dem StGB, findet auch eine kurze Urteilsanmerkung statt.
In der heutigen Zeit hat sich das Leben von der realen Welt immer weiter in die virtuelle Welt verschoben. Vor allem findet die Kommunikation zu einem großen Teil online, mittels Smartphones und sozialen Netzwerken, statt. Auch die Arbeitsweisen in der Berufswelt haben sich schon längst digitalisiert. Nicht verwunderlich ist daher, dass es auch eine Vielzahl von Freizeitbeschäftigungen in der virtuellen Welt gibt. Einige der beliebtesten Angebote sind dabei die Onlinespiele. Besonderes Ansehen genießen die sogenannten MMORPGs, also massively multiplayer online role-playing games. Allein etwa in World of Warcraft tummelten sich im Jahre 2015 über fünf Millionen Spieler und 2010 sogar zwölf Millionen Spieler. Insgesamt gab es im Jahr 2014 in Deutschland 16 Millionen Nutzer von Online- oder Browserspielen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Gegenstand der Untersuchung
- C. Diebstahl - § 242 StGB.
- I. Items als Sache..
- 1. Technische Herangehensweise.......
- 2. Abstrakte Herangehensweise
- 3. Erweiterte Auslegung des Sachbegriffes…………………..\n
- II. Ergebnis zu § 242 StGB.
- D. Datenveränderung - § 303a StGB
- I. Virtuelle Gegenstände als Daten.
- II. Einschränkung des Tatbestandes.....
- 1. Zu weite Fassung des Tatbestandes
- 2. Kriterien zur Einschränkung
- 3. Geschütztes Rechtsgut als Grundlage der Einschränkung .\n
- a) Vermögensschutz.
- b) Interesse an der unversehrten Verwendbarkeit von Daten.......
- c) Verfügungsbefugnis...\n
- d) Zwischenergebnis
- 4. Verfügungsbefugnis in Bezug auf virtuelle Gegenstände…....\n
- a) Eigentum am Datenträger..\n
- b)Skripturakt bzw. Vornahme der Speicherung .\n
- c) Relative, abgeleitete Nutzungsrechte sowie Besitzrechte.\n
- d) Zwischenergebnis..\n
- 5. Tatsächliche Herrschaftsmacht
- a) Zuordnung an den Betreiber.............
- b) Zuordnung an die Spieler ......
- 6. Ergebnis........
- III. Tathandlung..\n
- 1. Übersicht
- 2. Eingriff in die tatsächliche Herrschaftsmacht der Spieler.\n
- a) Tatmodalität
- b) Tatbestandausschließendes Einverständnis............\n
- 3. Eingriff in die tatsächliche Herrschaftsmacht des Betreibers
- IV. Sonstige Voraussetzungen...\n
- V. Ergebnis zu § 303a StGB
- E. Computersabotage - § 303b StGB..\n
- I. Datenverarbeitung..\n
- 1. Datenverarbeitung bei Privatpersonen.
- 2. Datenverarbeitung bei den Betreibern...........
- II. Wesentliche Bedeutung.......
- 1. Der Wesentlichkeitsbegriff in Bezug auf Private.....
- 2. Der Wesentlichkeitsbegriff in Bezug auf die Betreiber
- III. Erhebliche Störung .....
- IV. Ergebnis zu § 303b StGB\n
- F. Urkundenunterdrückung - § 274 StGB
- I. Beweiserhebliche Daten
- 1. Daten nach § 202a II StGB
- 2. Daten i.S.d. § 269 StGB
- 3. Entscheidung und Auswirkungen.........
- II. Ergebnis zu § 274 StGB
- G. Ausspähen von Daten - § 202a StGB....\n
- I. Daten i.S.d. § 202a II StGB...\n
- II. Nicht für den Täter bestimmt
- III. Besondere Sicherung gegen unberechtigten Zugang.\n
- IV. Sich Zugang zu den Daten unter Überwindung der Zugangssicherung verschaffen 25
- V. Weitere Tatbestandsvoraussetzungen
- VI. Ergebnis zu § 202a I StGB.\n
- H. Vorbereitungsstraftaten.....\n
- I. Fazit und Urteilsanmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Frage, welche Strafvorschriften neben Erpressung und Betrug bei der Entziehung virtueller Gegenstände in Betracht kommen. Die Arbeit fokussiert dabei auf die Anwendung des Strafrechts auf die besonderen Herausforderungen, die sich durch die Digitalisierung und die Entwicklung von virtuellen Welten ergeben.
- Die Rechtsnatur virtueller Gegenstände im Kontext des Strafrechts
- Die Anwendbarkeit des Diebstahlsdelikts (§ 242 StGB) auf virtuelle Gegenstände
- Die Frage der Datenveränderung (§ 303a StGB) und die Einschränkung des Tatbestands durch Rechtsgutsschutz
- Die Relevanz von Computersabotage (§ 303b StGB) im Zusammenhang mit virtuellen Welten
- Die Anwendung des § 274 StGB (Urkundenunterdrückung) auf virtuelle Gegenstände
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext der Digitalisierung und des Strafrechts. Kapitel C behandelt die Anwendbarkeit des Diebstahlsdelikts (§ 242 StGB) auf virtuelle Gegenstände. Dabei werden die Herausforderungen der Einordnung virtueller Gegenstände als "Sache" im Strafrecht diskutiert. Kapitel D befasst sich mit der Datenveränderung (§ 303a StGB) und der Einschränkung des Tatbestands durch Rechtsgutsschutz. Die Anwendung des Computersabotage-Delikts (§ 303b StGB) auf virtuelle Welten wird in Kapitel E untersucht. Kapitel F analysiert die Frage, ob virtuelle Gegenstände als Urkunden im Sinne des § 274 StGB (Urkundenunterdrückung) eingestuft werden können.
Schlüsselwörter
Virtuelle Gegenstände, Strafrecht, Diebstahl, Datenveränderung, Computersabotage, Urkundenunterdrückung, Rechtsgutsschutz, Digitalisierung, Rechtsnatur, Daten, Datenverarbeitung, Besitzrechte, Verfügungsbefugnis, Tatbestandsvoraussetzungen, Tathandlung, Einverständnis
- Quote paper
- Jonas Maierthaler (Author), 2017, Welche Strafvorschriften kommen bei der Entziehung virtueller Gegenstände neben Betrug und Erpressung in Betracht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/370189