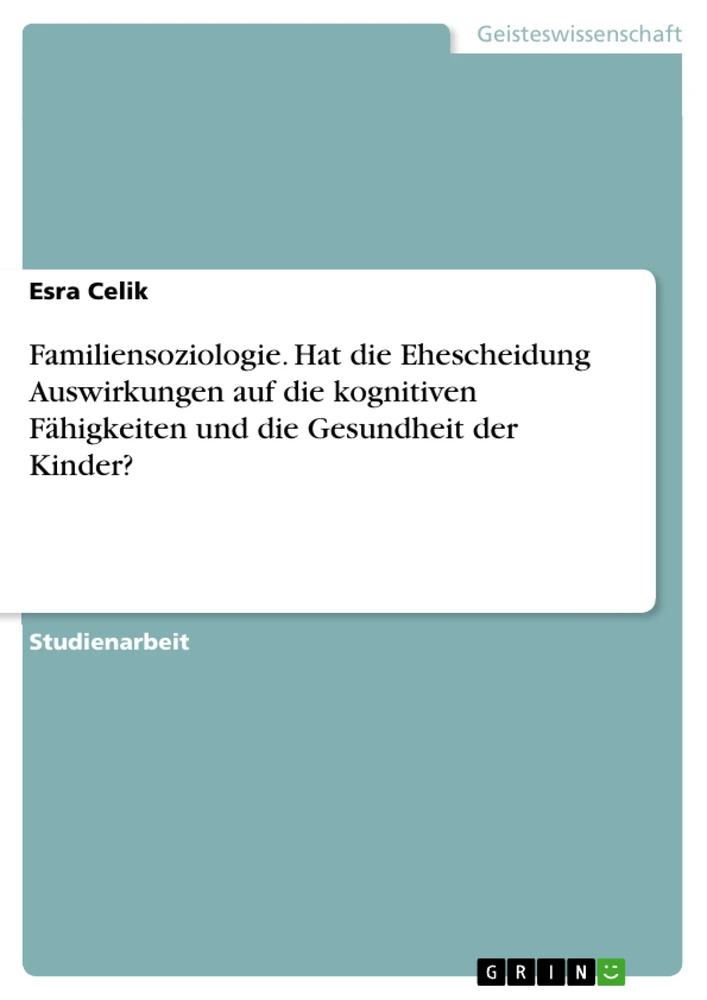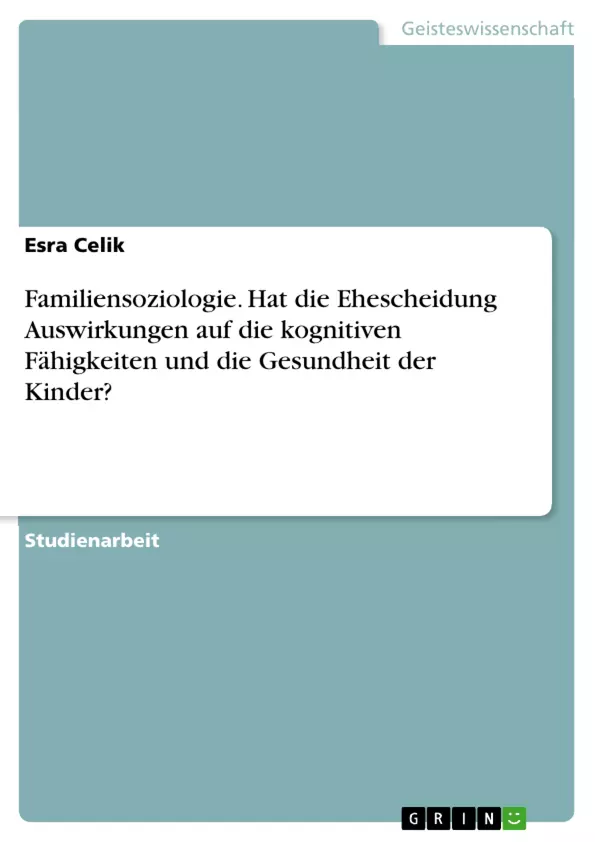Mit dieser Arbeit wir das Ziel verfolgt, die Folgen der Ehescheidung auf die kindliche Entwicklung zu identifizieren sowie herauszufinden, welche möglichen Langzeitfolgen bei betroffenen Kindern entstehen können. Der Fokus der Hausarbeit liegt auf den psychischen Störungen sowie den kognitiven Fähigkeiten des Kindes. Als Methodik verwendet die Hausarbeit ein Vergleich von relevanten Studien, die sich mit dieser Thematik im beschäftigt haben. Des Weiteren soll herausgefunden werden, ob eine Scheidung nicht nur negative Aspekte beinhaltet, sondern auch positive Auswirkungen auf das Kind besitzt.
Als letztes Ziel dieser Arbeit werden beide Geschlechter differenziert betrachtet, um Unterschiede in der Wirkungsweise der Geschlechter herauszuarbeiten. Im letzten Abschnitt werden die wesentlichen Resultate Arbeit präsentiert und die einleitenden Fragestellungen beantwortet. Ein Ausblick gibt zudem Anregungen über ungeklärte Fragen und weiteren Untersuchungen.
Inhaltsverzeichnis
- Relevanz des Themas
- Theoretischer Ansatz
- Betrachtung der Scheidung als Prozess
- ,,Selection perspective" und „divorce-stress-adjustment"
- Scheidung als Ergebnis von Konsequenzen
- Vorstellung und Auswertung empirischer Studien
- Studie von Wauterickx et al. (2006)
- Studie von Feldhaus und Timm (2015)
- Studie von Bernardi und Radl (2014)
- Studie von Hyun Sik Kim (2011)
- Studie von Thomas und Högnäs (2015)
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen von Ehescheidungen auf die kognitiven Fähigkeiten und die Gesundheit von Kindern. Ziel ist es, die Folgen der Scheidung auf die kindliche Entwicklung zu identifizieren und herauszufinden, welche möglichen Langzeitfolgen bei betroffenen Kindern entstehen können. Dabei liegt der Fokus auf psychischen Störungen sowie den kognitiven Fähigkeiten des Kindes. Die Arbeit untersucht, ob eine Scheidung neben negativen auch positive Auswirkungen auf das Kind haben kann und betrachtet beide Geschlechter differenziert, um Unterschiede in der Wirkungsweise herauszuarbeiten.
- Auswirkungen der Scheidung auf die kindliche Entwicklung
- Mögliche Langzeitfolgen von Ehescheidungen auf Kinder
- Einfluss von Scheidungen auf psychische Störungen bei Kindern
- Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten von Kindern
- Differenzierte Betrachtung der Auswirkungen auf Mädchen und Jungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Relevanz des Themas: Dieses Kapitel beleuchtet die steigende Scheidungsrate und die daraus resultierenden Auswirkungen auf Kinder, insbesondere im Hinblick auf ihre emotionale Verfassung und ihre kognitiven Fähigkeiten. Die Arbeit befasst sich mit der Veränderung von Familienstrukturen und den Herausforderungen, denen Kinder in diesem Kontext gegenüberstehen.
- Theoretischer Ansatz: In diesem Kapitel werden zwei wichtige Theorien vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit im Kontext der Auswirkungen von Scheidungen auf Kinder analysiert. Zum einen wird die Scheidung als Prozess betrachtet, der nicht mit dem Trennungsdatum beginnt und endet, sondern eine lange Zeitspanne umfasst. Zum anderen werden die "Selection perspective" und "divorce-stress-adjustment" erläutert, die verschiedene Perspektiven auf die Ursachen und Folgen von Scheidungen bieten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Auswirkungen von Ehescheidungen auf die kognitiven Fähigkeiten und die Gesundheit von Kindern. Zentrale Themen sind die kindliche Entwicklung, psychische Störungen, familiäre Übergänge, elterliche Unterstützung, "selection perspective", "divorce-stress-adjustment", sowie die Differenzierung von Geschlechterrollen und deren Einfluss auf die Auswirkungen der Scheidung.
- Quote paper
- Esra Celik (Author), 2016, Familiensoziologie. Hat die Ehescheidung Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten und die Gesundheit der Kinder?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/368911