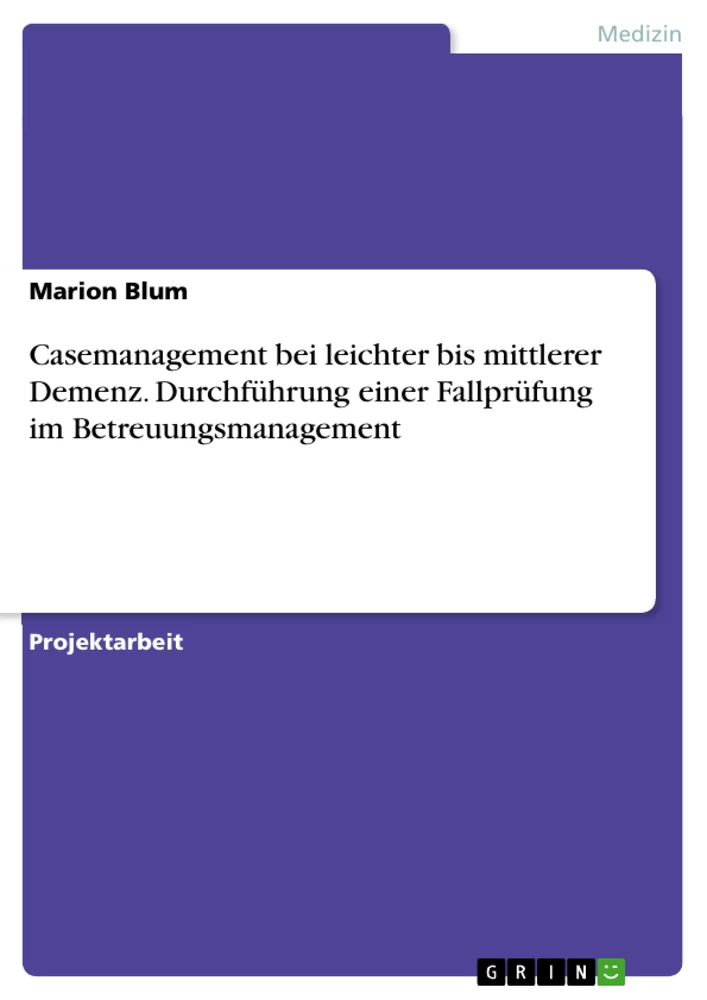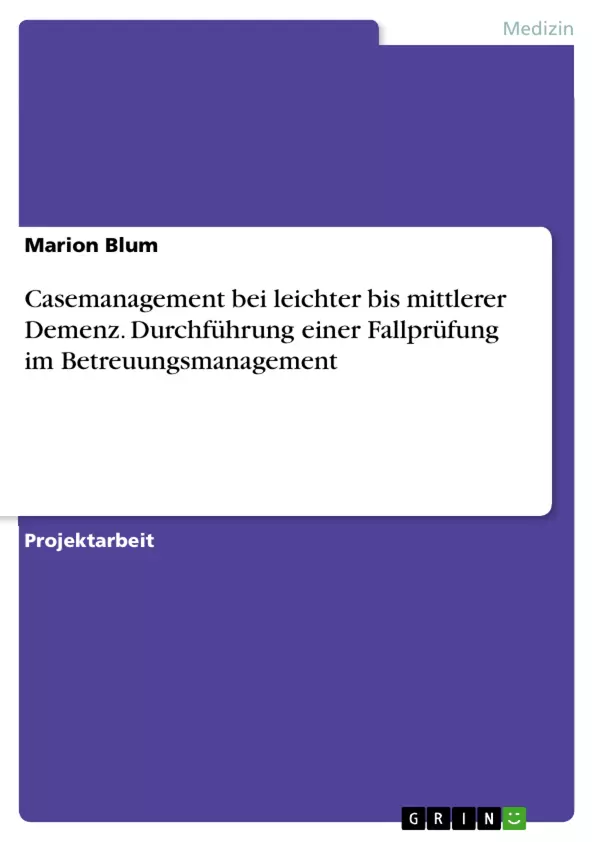In dieser Facharbeit zur Fachweiterbildung Casemanagement (DGCC zertifiziert) und Pflegeberatung § 7a SGB XI wird die Durchführung einer Fallprüfung im Betreuungsmanagement beschrieben. Es handelt sich um ein Einzelfall Casemanagement bei einer älteren zu Betreuenden mit leichter bis mittlerer Demenz.
Im dargestellten Fall reicht im Nachhinein das persönliche Netzwerk (Angehörige, persönliches Umfeld) nicht mehr aus, um eine Vermeidung eines Pflegeheimeinzuges der zu Betreuenden endgültig abzuwenden. Die Schwierigkeit des Falls liegt in der aktuellen und zukünftigen Versorgungssituation bei Demenz und deren zukünftigen Verschlechterungen des Gesundheitszustandes sowie die Vereinbarkeit der Angehörigenarbeit mit der persönlichen Betreuungsarbeit an der zu Betreuenden.
Hierbei mussten einige Bereiche u. a. nach den ADL inkl. Barthel Index bearbeitet werden, um so die Versorgung und den Verbleib der zu Betreuenden im häuslichen Umfeld zu sichern und halten zu können. Es handelt sich um eine Betreuung gesetzlich sowie auch persönlich von längerem, ggf. dauerhaftem Vorgehen. Neben der realen Falldarstellung werden die Einzel gegliederten Prozessschritten des Case Managements beschrieben und in das eingebrachte Fallbeispiel eingebunden. Zudem wird durch den wissenschaftlicher Bezug die zu rechtfertigenden und untermauernden Vorgehensweisen dargelegt und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmung
- 2.1 Grundzüge des Case Management
- 2.2 Rechtliche Betreuung
- 2.3 Demenz
- 2.3.1 Demenz vom Alzheimer-Typ
- 2.3.2 Vaskuläre Demenz
- 2.3.3 Frontotemporale Demenz
- 2.3.4 Demenz mit Lewy-Körperchen
- 3 Fallbeispiel: Vorstellung der Person
- 4 Betrachtung der Versorgungs- und Betreuungsproblematik
- 4.1 Identifikation/ Klärungsphase
- 4.1.1 Kriterien
- 5 Konzeptentwicklung Casemanagement
- 5.1 Assessment
- 5.1.1 Bedürfnisse und Bedarf
- 5.1.2 Barthel Index
- 5.2 Defizite und Stärken
- 5.3.1 Fallanalyse
- 5.3.2 Fallbeispiel
- 6 Hilfeplanerstellung
- 6.1 Zielfindung
- 6.1.1 Fallbeispiel
- 6.2 Bedarfsklärung
- 6.2.1 Fallbeispiel
- 7 Linking
- 7.1 Fallbeispiel
- 8 Monitoring
- 8.1 Fallbeispiel
- 9 Evaluation
- 9.1 Fallbeispiel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt die Durchführung einer Fallprüfung im Betreuungsmanagement als Einzelfall-Casemanagement bei einer älteren Person mit leichter bis mittelschwerer Demenz. Ziel ist es, die Anwendung des Case-Management-Handlungskonzeptes im Kontext der gesetzlichen Betreuung und den Herausforderungen der Demenzversorgung zu illustrieren. Die Arbeit analysiert den Verlauf des Case Managements anhand eines konkreten Fallbeispiels und reflektiert das Vorgehen kritisch.
- Case Management in der gesetzlichen Betreuung
- Herausforderungen der Demenzversorgung
- Analyse eines konkreten Fallbeispiels
- Reflexion des Vorgehens im Einzelfall-Casemanagement
- Bedürfnis- und Bedarfsermittlung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den steigenden Bedarf an umfassender Unterstützung älterer Menschen, insbesondere im Kontext des demografischen Wandels und der zunehmenden Zahl von Demenzerkrankungen. Sie hebt die Bedeutung qualifizierter Betreuungsleistungen für die Selbstbestimmung und Teilhabe Betroffener hervor und führt in das Fallbeispiel einer 79-jährigen Frau mit beginnender Demenz ein, deren Fall im weiteren Verlauf detailliert analysiert wird.
2 Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Case Management, rechtliche Betreuung und Demenz. Es skizziert die Grundzüge des Case Managements als ganzheitlichen und kooperativen Versorgungsprozess und erläutert die Rolle des Case Managers als Vermittler zwischen den verschiedenen Beteiligten.
3 Fallbeispiel: Vorstellung der Person: Dieses Kapitel präsentiert die 79-jährige Betroffene mit ihrer konkreten Situation, einschließlich des Todes ihres Lebensgefährten, dem Beginn ihrer Demenzsymptome und dem Antrag auf gesetzliche Betreuung durch ihre Angehörigen. Der Wunsch der Betroffenen, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben und langfristig von ihrem Sohn betreut zu werden, wird ebenfalls dargestellt.
4 Betrachtung der Versorgungs- und Betreuungsproblematik: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen der Versorgungssituation der Betroffenen, unter Berücksichtigung der sich verschlechternden Gesundheit und der Vereinbarkeit der Angehörigenarbeit mit der persönlichen Betreuungsarbeit. Es werden die individuellen Bedürfnisse und der Bedarf der Betroffenen im Detail beleuchtet.
5 Konzeptentwicklung Casemanagement: Hier wird die Anwendung des Case-Management-Konzeptes auf den Fall der 79-jährigen Frau beschrieben, einschließlich der Assessment-Phase, der Bedarfsermittlung (u.a. mittels Barthel-Index) und der Analyse von Defiziten und Stärken. Es wird aufgezeigt, wie das Case Management dazu beitragen kann, die Versorgung und den Verbleib der Betroffenen im häuslichen Umfeld zu sichern.
6 Hilfeplanerstellung: In diesem Kapitel wird die Erstellung des Hilfeplanes im Detail erörtert, unter Berücksichtigung der Zielfindung und der Bedarfsklärung. Der Prozess der Planung und die beteiligten Akteure werden erläutert.
7 Linking: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess des "Linking", also die Vernetzung der verschiedenen Akteure und Dienstleistungen, die an der Versorgung der Betroffenen beteiligt sind, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten.
8 Monitoring: Hier wird der kontinuierliche Monitoring-Prozess beschrieben, der die regelmäßige Überprüfung des Hilfeplanes und die Anpassung an die sich verändernden Bedürfnisse der Betroffenen beinhaltet. Es wird dargestellt, wie der Erfolg der Maßnahmen überwacht wird.
Schlüsselwörter
Case Management, rechtliche Betreuung, Demenz, Demenzversorgung, Betreuungsmanagement, Hilfeplanung, Assessment, Barthel-Index, ADL, Angehörigenarbeit, Selbstbestimmung, Versorgungssicherung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Case Management bei Demenz
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Fallstudie zum Thema Case Management bei einer älteren Person mit leichter bis mittelschwerer Demenz. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die Arbeit beschreibt detailliert den Prozess des Case Managements, von der Bedarfsermittlung bis zur Evaluation, anhand eines konkreten Fallbeispiels einer 79-jährigen Frau.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt zentrale Aspekte des Case Managements im Kontext der gesetzlichen Betreuung und der Demenzversorgung. Es umfasst die Begriffsbestimmung von Case Management, rechtlicher Betreuung und Demenz, die Analyse der Versorgungs- und Betreuungsproblematik, die Konzeptentwicklung des Case Managements (inkl. Assessment und Barthel-Index), die Hilfeplanerstellung, Linking, Monitoring und Evaluation. Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Anwendung des Case Managements anhand eines konkreten Fallbeispiels.
Wer ist die Hauptperson im Fallbeispiel?
Die Hauptperson ist eine 79-jährige Frau mit leichter bis mittelschwerer Demenz. Ihr Lebensgefährte ist verstorben, und ihre Angehörigen haben einen Antrag auf gesetzliche Betreuung gestellt. Sie wünscht sich, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben und von ihrem Sohn betreut zu werden.
Welche Methoden werden im Case Management angewendet?
Das Dokument beschreibt die Anwendung verschiedener Methoden des Case Managements, darunter die Bedarfsermittlung mithilfe des Barthel-Index, die Analyse von Defiziten und Stärken, die Hilfeplanerstellung, das Linking (Vernetzung der Akteure), das Monitoring und die Evaluation. Der Prozess wird Schritt für Schritt anhand des Fallbeispiels erläutert.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der Demenzversorgung beschrieben?
Das Dokument beschreibt die Herausforderungen der Demenzversorgung im Kontext der gesetzlichen Betreuung und der Vereinbarkeit von Angehörigenarbeit und persönlicher Betreuungsarbeit. Es werden die individuellen Bedürfnisse und der Bedarf der betroffenen Person detailliert beleuchtet, und die Schwierigkeiten bei der Sicherstellung einer optimalen Versorgung werden diskutiert.
Welche Ziele werden mit dem Case Management verfolgt?
Das Hauptziel des Case Managements in diesem Fall ist es, die Versorgung der 79-jährigen Frau zu sichern und ihren Wunsch nach einem Verbleib im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Es geht darum, eine ganzheitliche und kooperative Versorgung zu gewährleisten und die Selbstbestimmung der Betroffenen zu unterstützen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Case Management, rechtliche Betreuung, Demenz, Demenzversorgung, Betreuungsmanagement, Hilfeplanung, Assessment, Barthel-Index, ADL, Angehörigenarbeit, Selbstbestimmung, Versorgungssicherung.
- Arbeit zitieren
- Diplom Pflegewirtin (FH), MHA (Uni) Marion Blum (Autor:in), 2016, Casemanagement bei leichter bis mittlerer Demenz. Durchführung einer Fallprüfung im Betreuungsmanagement, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/368468