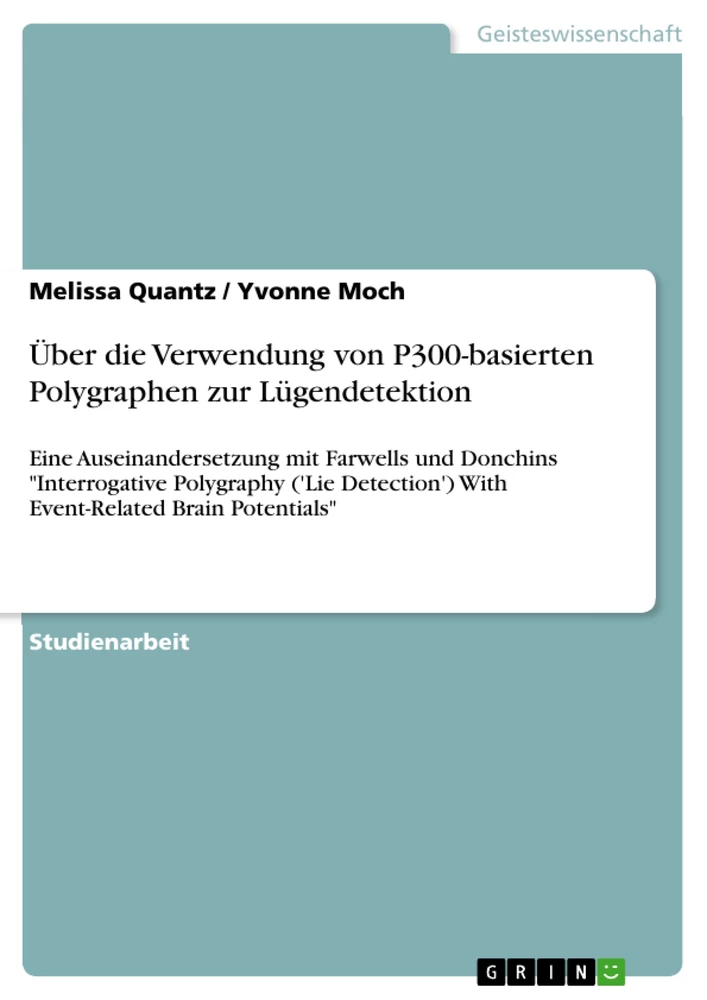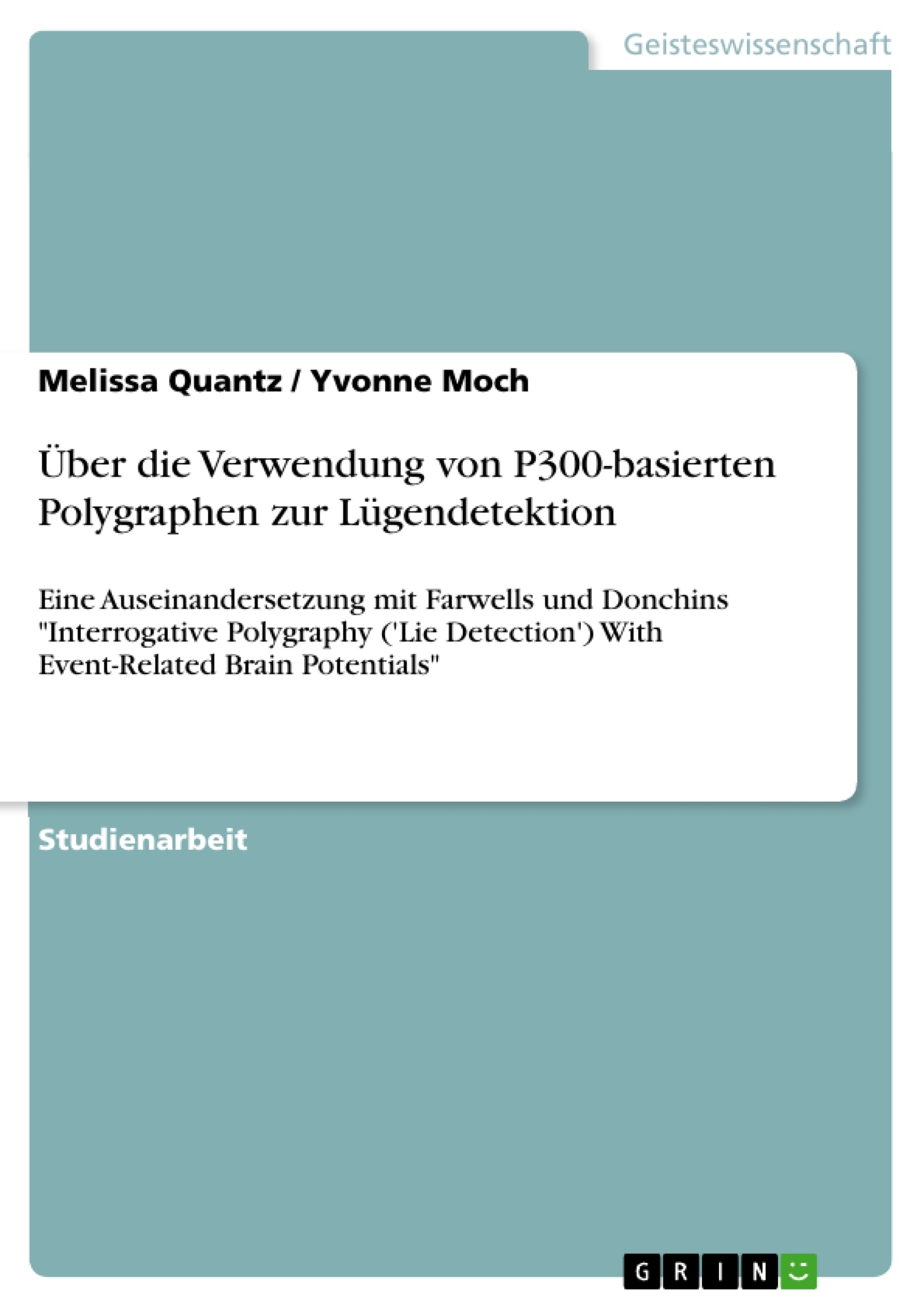Wie kann man Lügen enttarnen? Lügendetektoren können anhand der erhobenen körperlichen Reaktionen nicht immer eine verlässliche Entscheidungshilfe bieten. Was aber wäre, wenn es einen Polygraphen gäbe, der mit unbeeinflussbaren körperlichen Reaktionen, wie der elektrischen Aktivität des Gehirns, arbeiten würde?
In der nachfolgend vorgestellten Studie von Farwell und Donchin (1991) wurde erstmals ein solches Verfahren zur Detektion von sogenanntem Schuldwissen (Guilty Knowledge) getestet, das mittels einer EEG-Aufzeichnung und der anschließenden Auswertung der P300-Komponente im ERP (Event Related Potential) arbeitet.
Bevor diese Studie jedoch ausführlich beschrieben wird, werden im ersten Teil dieser Arbeit die theoretischen Grundlagen zum Thema Lügendetektion dargestellt. Dabei werden die Polygraphie, das klassische Oddball-Paradigma sowie der Guilty-Knowledge-Test beleuchtet. Anschließend folgt eine detailliertere Darstellung der Studie, welche die Beschreibung der Hypothesen, der Vorgehensweise sowohl bei der Datenerhebung als auch die der späteren Auswertung sowie der Ergebnisse umfasst. Im letzten Teil dieser Arbeit stehen die kritische Würdigung und Diskussion der Studienerkenntnisse, die auch mit neueren Studien in Bezug gesetzt werden. Daneben werden auch Implikationen für die Praxis vorgeschlagen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Polygraphie
- 2.2. Oddball-Paradigma
- 2.3. Guilty Knowledge Test
- 3. Zielsetzung
- 4. Methodisches Vorgehen
- 4.1. Experiment 1
- 4.2. Experiment 2
- 4.3. Theoriebezogene Hypothesen
- 4.4. Datenakquise
- 4.5. Datenvorbereitung
- 4.6. Experimentbezogene Hypothesen
- 5. Ergebnisse
- 5.1. Experiment 1
- 5.2. Experiment 2
- 6. Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Studie von Farwell und Donchin (1991) zur Lügendetektion mittels P300-Komponente im ERP. Ziel ist die detaillierte Darstellung und Bewertung des Verfahrens hinsichtlich seiner Einsetzbarkeit. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen und die Methodik der Studie.
- Lügendetektion mit Hilfe von Gehirnströmen (P300)
- Das Oddball-Paradigma und seine Anwendung in der Lügendetektion
- Der Guilty Knowledge Test und seine Validität
- Bewertung der Ergebnisse der Studie von Farwell und Donchin (1991)
- Implikationen für die Praxis der Lügendetektion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Lügendetektion ein und beleuchtet die Herausforderungen traditioneller Methoden wie dem Polygraphen. Sie stellt die Studie von Farwell und Donchin (1991) vor, die einen neuartigen Ansatz mittels EEG-Aufzeichnung und P300-Komponente des ERPs zur Detektion von Schuldwissen verwendet. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der die theoretischen Grundlagen, die Methodik und die Ergebnisse der Studie umfasst, gefolgt von einer Diskussion und einem Ausblick.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen der Studie. Es werden die Polygraphie, das Oddball-Paradigma und der Guilty Knowledge Test detailliert beschrieben und ihre Relevanz für das Verständnis der Studie von Farwell und Donchin (1991) herausgestellt. Besonders wird auf die Grenzen traditioneller Polygraphiemethoden und die Vorteile der P300-basierten Methode eingegangen.
Schlüsselwörter
Lügendetektion, P300, ERP, Event-Related Potentials, Oddball-Paradigma, Guilty Knowledge Test, Polygraphie, EEG, Schuldwissen, Gehirnströme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Lügendetektion mittels P300-Komponente im ERP
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Studie von Farwell und Donchin (1991) zur Lügendetektion mittels der P300-Komponente im ereigniskorrelierten Potential (ERP). Sie untersucht die Methodik, die theoretischen Grundlagen und die Ergebnisse dieser Studie, um deren Einsetzbarkeit zu bewerten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Lügendetektion mit Hilfe von Gehirnströmen (P300), das Oddball-Paradigma und dessen Anwendung in der Lügendetektion, den Guilty Knowledge Test und seine Validität, die Bewertung der Ergebnisse der Studie von Farwell und Donchin (1991) und die Implikationen für die Praxis der Lügendetektion.
Welche theoretischen Grundlagen werden erläutert?
Die Arbeit erläutert die theoretischen Grundlagen der Polygraphie, des Oddball-Paradigmas und des Guilty Knowledge Tests. Sie vergleicht die traditionellen Polygraphiemethoden mit der P300-basierten Methode und hebt deren Vorteile hervor.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretische Grundlagen (Polygraphie, Oddball-Paradigma, Guilty Knowledge Test), Zielsetzung, Methodisches Vorgehen (inkl. Beschreibung der Experimente 1 & 2, Datenakquise und -vorbereitung, Hypothesen), Ergebnisse (für Experiment 1 & 2), Diskussion und Ausblick.
Welche Methoden wurden in der Studie von Farwell und Donchin (1991) verwendet?
Die Studie von Farwell und Donchin (1991) verwendet EEG-Aufzeichnungen und analysiert die P300-Komponente des ERPs, um Schuldwissen zu detektieren. Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik dieser Studie, inklusive der Experimente.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse von zwei Experimenten, die im Rahmen der Studie von Farwell und Donchin (1991) durchgeführt wurden. Eine detaillierte Auswertung und Interpretation dieser Ergebnisse findet in der Diskussion statt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit diskutiert die Ergebnisse und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Einsetzbarkeit der P300-basierten Lügendetektion. Ein Ausblick auf zukünftige Forschung und die Implikationen für die Praxis der Lügendetektion werden ebenfalls gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Lügendetektion, P300, ERP, Event-Related Potentials, Oddball-Paradigma, Guilty Knowledge Test, Polygraphie, EEG, Schuldwissen, Gehirnströme.
- Quote paper
- Melissa Quantz (Author), Yvonne Moch (Author), 2017, Über die Verwendung von P300-basierten Polygraphen zur Lügendetektion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/366928