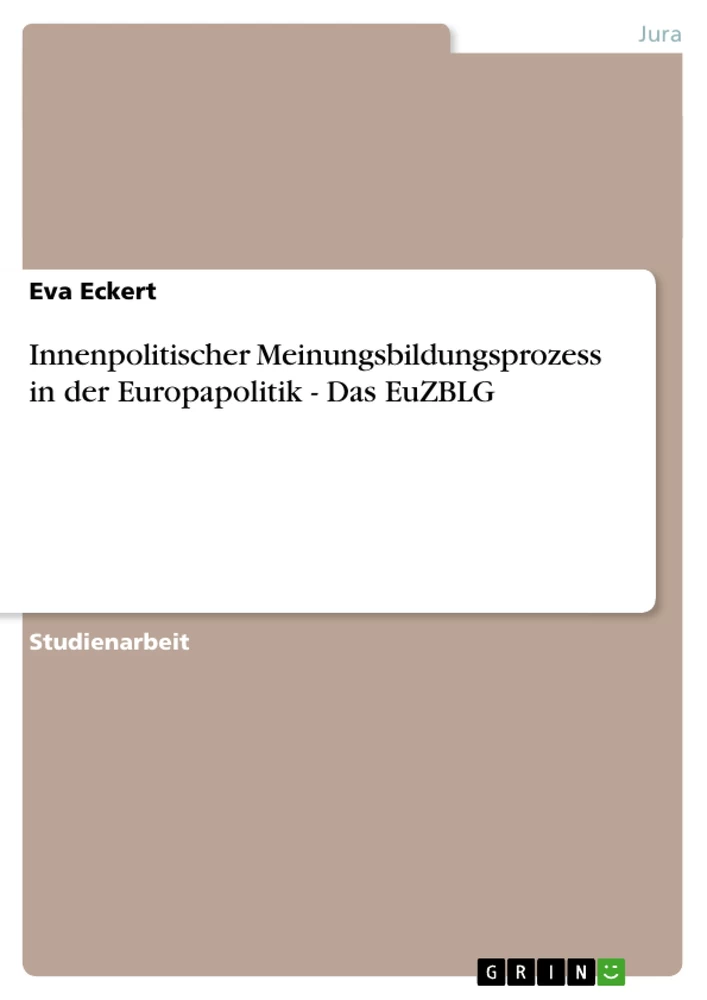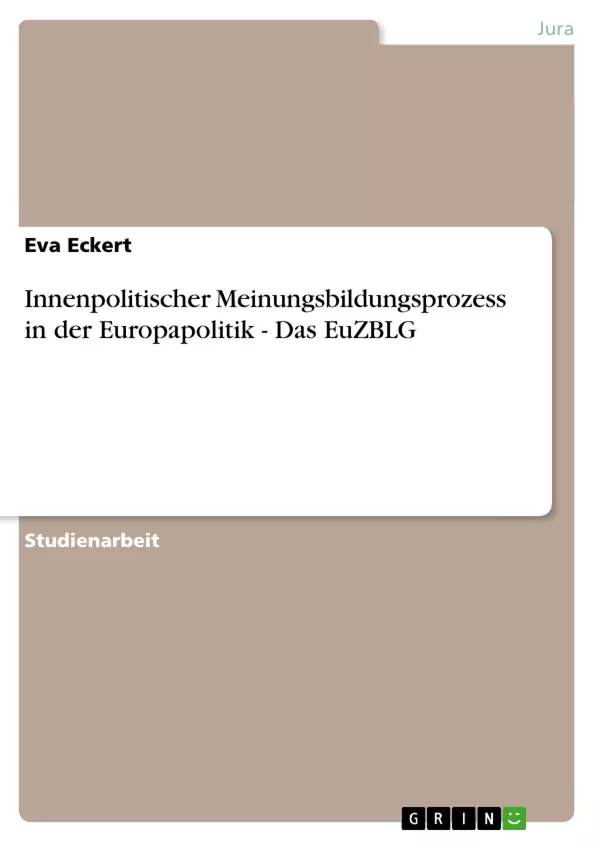Einleitung
Durch die Entwicklungen der europäischen Integration kam es dazu, daß die BRD immer mehr Hoheitsrechte auf eine zusehends erstarkende supranationale Ebene übertragen hat, was gravierende Rückwirkungen für die innerstaatliche Balance des Verfassungsgefüges hat.1 Insbesondere die für die föderalistische Struktur der Bundesrepublik brachte dies politische und rechtliche Probleme mit sich, da zusehends auch Bereiche tangiert waren, die verfassungsrechtlich den Ländern zufallen und so die vertikale Gewaltenteilung2 gestört wird. Zwar funktioniert die europäische Integration über völkerrechtliche Verträge, die der Außenpolitik zuzuordnen sind und damit zu den ureigensten Bundeszuständigkeiten gehört. Jedoch wurden und werden in diesen Verträgen immer mehr Bereiche geregelt, die innenrechtlich in die Zuständigkeit der Länder fallen, so daß eine verfassungspolitische und verfassungsrechtliche Lösung gefunden werden mußte. Heute ist sogar schon fast jeder zweite Rechtsakt europäischen Ursprungs.3
-------------
1 Ossenbühl, DVBl 1993, 635
2 Breuer, 425
3 Böhm in BayVBl 1993, S. 545 ff (545)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsgeschichte
- Innerstaatliche Mitwirkungsbefugnisse des Bundesrates
- Bundeskompetenzen
- Länderkompetenzen
- Weitergehende Integration/ Art. 308 EG
- Mitwirkung auf EU-Ebene
- Praxis
- Europakammer
- Selbstkoordination der Länder
- Kritik und Probleme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Praxis der Europapolitik im Auswärtigen Amt und untersucht die Auswirkungen der europäischen Integration auf die innerstaatliche Balance des Verfassungsgefüges der Bundesrepublik Deutschland. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle des Bundesrates und seiner Mitwirkungsbefugnisse im europäischen Entscheidungsfindungsprozess.
- Entwicklungen der europäischen Integration und deren Auswirkungen auf die BRD
- Vertikale Gewaltenteilung im Kontext der EU-Mitgliedschaft
- Mitwirkungsbefugnisse des Bundesrates im EUZBLG
- Kritik und Probleme der deutschen Europapolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beleuchtet die Herausforderungen, die sich durch die zunehmende europäische Integration für die innerstaatliche Balance der BRD ergeben. Insbesondere die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im europäischen Kontext steht im Fokus.
Entstehungsgeschichte
Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung der Ländermitwirkung im EU-Integrationsprozess. Es beschreibt die verschiedenen Regelungsversuche, die von dem ursprünglichen Zuleitungsverfahren bis zum Bundesratsverfahren führten. Die Bedeutung des Bundesrates als Integrationshebel und die Notwendigkeit der Verfassungsänderung werden diskutiert.
Innerstaatliche Mitwirkungsbefugnisse des Bundesrates
Dieses Kapitel analysiert die neuen Regelungen im Grundgesetz und im EUZBLG, die die Mitwirkung der Länder im EU-Entscheidungsprozess regeln. Es werden die verschiedenen Formen der Ländermitwirkung und die Bedeutung der frühzeitigen Information des Bundesrates vorgestellt.
Mitwirkung auf EU-Ebene
Dieses Kapitel befasst sich mit der Praxis der Ländermitwirkung auf EU-Ebene. Es werden verschiedene Koordinationsmechanismen und die Zusammenarbeit der Länder mit der Bundesregierung beleuchtet.
Praxis
Dieses Kapitel beleuchtet die konkreten Beispiele für die Zusammenarbeit der Länder in der EU-Politik, z.B. durch die Europakammer und die Selbstkoordination der Länder.
Kritik und Probleme
Dieses Kapitel analysiert die Kritik und Probleme, die mit der deutschen Europapolitik verbunden sind. Es beleuchtet sowohl innerstaatliche Konflikte als auch Kritik aus dem Ausland.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Bundesrat, Ländermitwirkung, EUZBLG, Kompetenzverteilung, Vertikale Gewaltenteilung, EU-Entscheidungsprozess, Kritik an der Europapolitik.
- Quote paper
- Eva Eckert (Author), 2002, Innenpolitischer Meinungsbildungsprozess in der Europapolitik - Das EuZBLG, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/36364