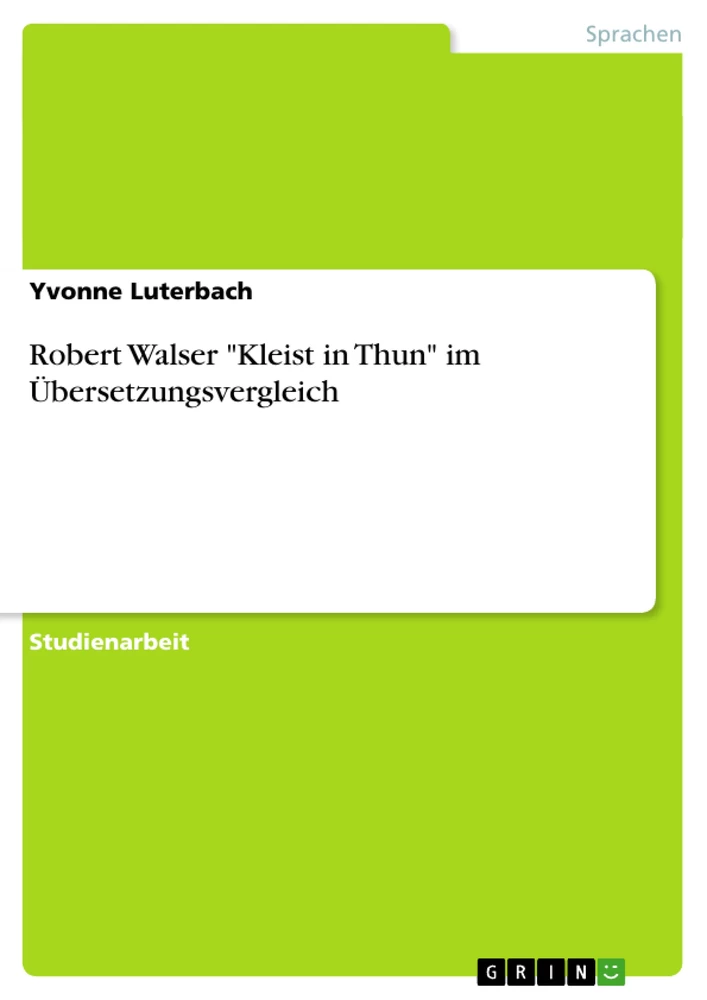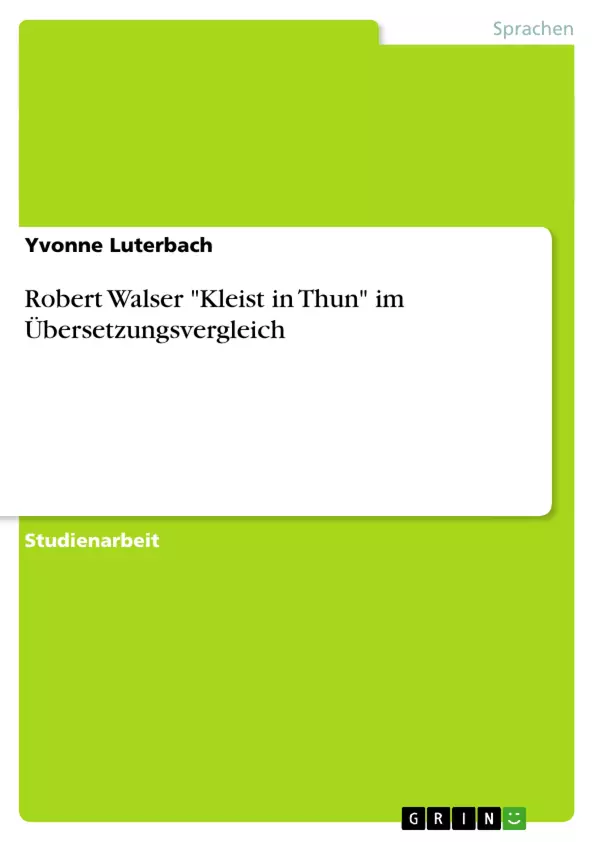Das Fremde bei Walsers Kleist in Thun
Walsers Kleist in Thun kann dem Leser bei einem ersten und oberflächlichen Lesen als eine Teilbiographie Kleists erscheinen. Tatsächlich gleicht Walsers Kleist-Figur dem historischen Kleist. Walser baut die biographischen Einzelheiten von Kleists Aufenthalt in Thun und wenige Briefzitate nur in verfremdeter Form in seinen Text ein. Die grosse Distanz des Erzählers zu Kleist am Anfang und am Ende der Prosa ist durch den zeitlichen Abstand, aber auch gesellschaftlich abgegrenzt, der Erzähler ist Aktienbierbrauereiangestellter und Kleist ist Schriftsteller aus einem gehobenen Bürgertum. Beides hebt trotz der zeitweiligen Quasi- Verschmelzung von Erzähler, Kleist und Walser selbst, die Fremdartigkeit des Textes hervor.
Im literarischen Diskurs wurde versucht, den Fremdheitscharakter des Kleist in Thun genauer zu analysieren, was dazu führte, dass verschiedene Theorien dazu entwickelt wurden. Aber gerade in Kleist in Thun kann diese Fremdheit, die den Text prägt, nicht eindeutig auf den Punkt gebracht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Das Fremde bei Walsers Kleist in Thun
- 1.2 Meine Arbeitshypothese
- 1.3 Eingrenzung des Themas
- 2. Robert Walsers Leben
- 3. Zur Geschichte des Prosastücks Kleist in Thun
- 3.1 Walsers Beziehung zu Kleist
- 3.2 Walsers Motivation zu Kleist in Thun
- 3.3 Geschichte der Übersetzungen
- 4. Vergleich der Übersetzungen mit dem Original
- 4.1 Sprachliche Ebene
- 4.2 Rhythmus
- 4.3 Perspektivenführung
- 4.4 Dialekt
- 4.5 Figur Kleist
- 5. Schlusfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die verschiedenen Übersetzungen von Robert Walsers "Kleist in Thun" und analysiert deren Umgang mit der im Originaltext vorhandenen Fremdheit. Ziel ist es, die Unterschiede zwischen den Übersetzungen und dem Originaltext aufzuzeigen und diese als Indikatoren für die Schwierigkeiten der Übersetzung von kulturellen und sprachlichen Nuancen zu interpretieren. Die Arbeit konzentriert sich auf den Vergleich der fünf französischen Übersetzungen mit dem Originaltext von 1907.
- Der Fremdheitscharakter in Walsers "Kleist in Thun"
- Der Einfluss von kulturellen und historischen Kontexten auf die Übersetzung
- Die Herausforderungen der Übersetzung von sprachlichen Nuancen und Mehrdeutigkeiten
- Vergleichende Analyse der französischen Übersetzungen
- Die Darstellung der Figur Kleist in den verschiedenen Textfassungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung stellt die Arbeit vor und skizziert die zentrale Fragestellung: Wie gehen die Übersetzungen von Robert Walsers "Kleist in Thun" mit der im Originaltext präsenten Fremdheit um? Es wird die These aufgestellt, dass die Übersetzungen den Fremdheitscharakter des Originals durch die Distanz zwischen Ausgangs- und Zieltexten verlieren. Die methodische Vorgehensweise, ein Vergleich der fünf französischen Übersetzungen mit dem Originaltext, wird erläutert. Der Text wird als komplexes Gefüge aus biografischen Elementen und literarischen Gestaltungsmitteln vorgestellt, wobei die Fremdheit als zentrales Merkmal hervorgehoben wird, das sich nicht eindeutig definieren lässt. Die Arbeitshypothese postuliert, dass sich diese Fremdheit in den Übersetzungen transformiert und somit neue Interpretationsebenen eröffnet.
2. Robert Walsers Leben: Dieses Kapitel bietet einen biographischen Abriss von Robert Walsers Leben, der seine vielseitigen Tätigkeiten und sein schriftstellerisches Schaffen beleuchtet. Es hebt die verschiedenen Phasen seines Lebens hervor, von seinen Anfängen im Theater bis hin zu seinem Wirken als Bibliothekar und seinem späteren Aufenthalt in der Nervenheilanstalt. Die Darstellung seines Lebens wird verknüpft mit dem Entstehen seiner Werke, insbesondere "Kleist in Thun", um den Kontext seines Schaffens zu verdeutlichen und seine künstlerische Entwicklung zu nachzuvollziehen. Der Lebenslauf Walsers zeigt die Widersprüchlichkeiten seines Daseins und den Einfluss seines Erlebens auf seine einzigartige schriftstellerische Stimme.
3. Zur Geschichte des Prosastücks Kleist in Thun: Dieser Abschnitt untersucht die Entstehungsgeschichte von "Kleist in Thun", beleuchtet Walsers Beziehung zu Heinrich von Kleist und seine Motivation, dieses Prosastück zu schreiben. Die Analyse der Geschichte der Übersetzungen unterstreicht die Rezeption des Textes in unterschiedlichen kulturellen Kontexten und die damit verbundenen Herausforderungen für Übersetzer. Der Fokus liegt auf der Betrachtung der unterschiedlichen Perspektiven auf Walsers Text im Laufe der Zeit und der Bedeutung dieser verschiedenen Interpretationen für das Verständnis des Werkes. Die Untersuchung der Übersetzungen dient als Grundlage für den darauffolgenden Vergleich.
4. Vergleich der Übersetzungen mit dem Original: In diesem Kapitel werden die fünf französischen Übersetzungen von "Kleist in Thun" mit dem Originaltext verglichen. Die Analyse konzentriert sich auf verschiedene Aspekte wie sprachliche Ebene, Rhythmus, Perspektivenführung, Dialekt und die Darstellung der Figur Kleist. Der Vergleich soll die Differenzen zwischen den Übersetzungen und dem Originaltext hervorheben und diese als „Dunkelzonen des Fremden“ interpretieren. Die Analyse deckt auf, wie die Übersetzer mit der im Original vorhandenen Fremdheit umgehen und welche Veränderungen oder Verluste dabei entstehen. Der Vergleich verdeutlicht, wie die Übersetzung die Interpretation des Textes beeinflusst.
Schlüsselwörter
Robert Walser, Kleist in Thun, Übersetzung, Fremdheit, Alienität, interkulturelle Kommunikation, sprachliche Nuancen, Vergleichende Literaturwissenschaft, französische Übersetzungen, kulturelle Distanz, historische Kontextualisierung.
Häufig gestellte Fragen zu Robert Walsers "Kleist in Thun"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert verschiedene französische Übersetzungen von Robert Walsers "Kleist in Thun" und untersucht, wie diese Übersetzungen mit der im Originaltext vorhandenen Fremdheit umgehen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Übersetzungen untereinander und mit dem Originaltext von 1907, um die Herausforderungen der Übersetzung kultureller und sprachlicher Nuancen aufzuzeigen.
Welche Aspekte werden im Vergleich der Übersetzungen untersucht?
Der Vergleich der fünf französischen Übersetzungen mit dem Originaltext konzentriert sich auf verschiedene Ebenen: die sprachliche Ebene, den Rhythmus, die Perspektivenführung, den Dialekt und die Darstellung der Figur Kleist. Die Unterschiede werden als Indikatoren für die Schwierigkeiten der Übersetzung und als "Dunkelzonen des Fremden" interpretiert.
Welche zentrale These wird in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit vertritt die These, dass die Übersetzungen den Fremdheitscharakter des Originals durch die Distanz zwischen Ausgangs- und Zieltexten verlieren. Die Übersetzungsprozesse transformieren die Fremdheit und eröffnen neue Interpretationsebenen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung, 2. Robert Walsers Leben, 3. Zur Geschichte des Prosastücks "Kleist in Thun", 4. Vergleich der Übersetzungen mit dem Original und 5. Schlusfolgerungen. Die Einführung stellt die Fragestellung und die Methode vor. Kapitel 2 bietet einen biografischen Abriss Walsers. Kapitel 3 untersucht die Entstehungsgeschichte und die Rezeptionsgeschichte von "Kleist in Thun". Kapitel 4 führt den detaillierten Vergleich der Übersetzungen durch. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Der Fremdheitscharakter in Walsers "Kleist in Thun", der Einfluss von kulturellen und historischen Kontexten auf die Übersetzung, die Herausforderungen der Übersetzung von sprachlichen Nuancen und Mehrdeutigkeiten, die vergleichende Analyse der französischen Übersetzungen und die Darstellung der Figur Kleist in den verschiedenen Textfassungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Robert Walser, Kleist in Thun, Übersetzung, Fremdheit, Alienität, interkulturelle Kommunikation, sprachliche Nuancen, Vergleichende Literaturwissenschaft, französische Übersetzungen, kulturelle Distanz, historische Kontextualisierung.
Wie wird die Methode der Arbeit beschrieben?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Methode. Fünf französische Übersetzungen von "Kleist in Thun" werden mit dem Originaltext von 1907 verglichen, um die Veränderungen und Verluste bei der Übersetzung aufzuzeigen und die Schwierigkeiten der Übersetzung von kulturellen und sprachlichen Nuancen zu analysieren.
Welche Bedeutung hat die Biografie Robert Walsers für die Arbeit?
Die Biografie Robert Walsers wird herangezogen, um den Kontext des Entstehens von "Kleist in Thun" zu beleuchten und das Verständnis des Werkes zu vertiefen. Sie zeigt die Widersprüchlichkeiten seines Lebens und den Einfluss seines Erlebens auf seine schriftstellerische Stimme.
Wie wird die Entstehungsgeschichte von "Kleist in Thun" behandelt?
Die Entstehungsgeschichte von "Kleist in Thun" wird untersucht, um Walsers Beziehung zu Heinrich von Kleist und seine Motivation für das Schreiben des Prosastücks zu verstehen. Die Analyse der Geschichte der Übersetzungen beleuchtet die Rezeption des Textes in verschiedenen kulturellen Kontexten und die damit verbundenen Herausforderungen für Übersetzer.
- Arbeit zitieren
- Yvonne Luterbach (Autor:in), 2005, Robert Walser "Kleist in Thun" im Übersetzungsvergleich, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/36234