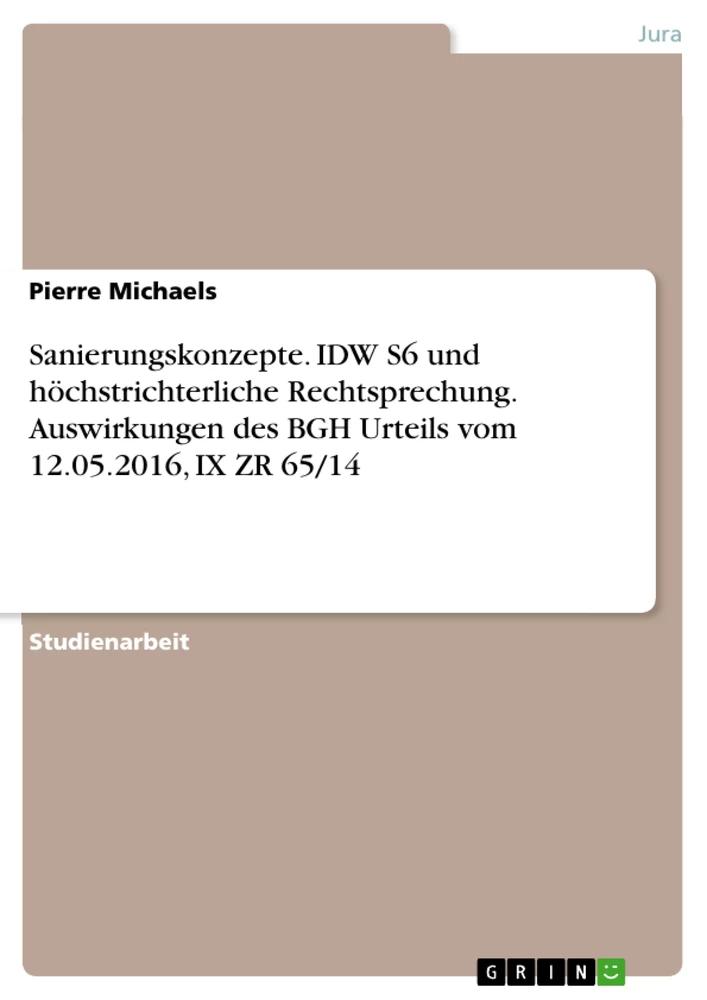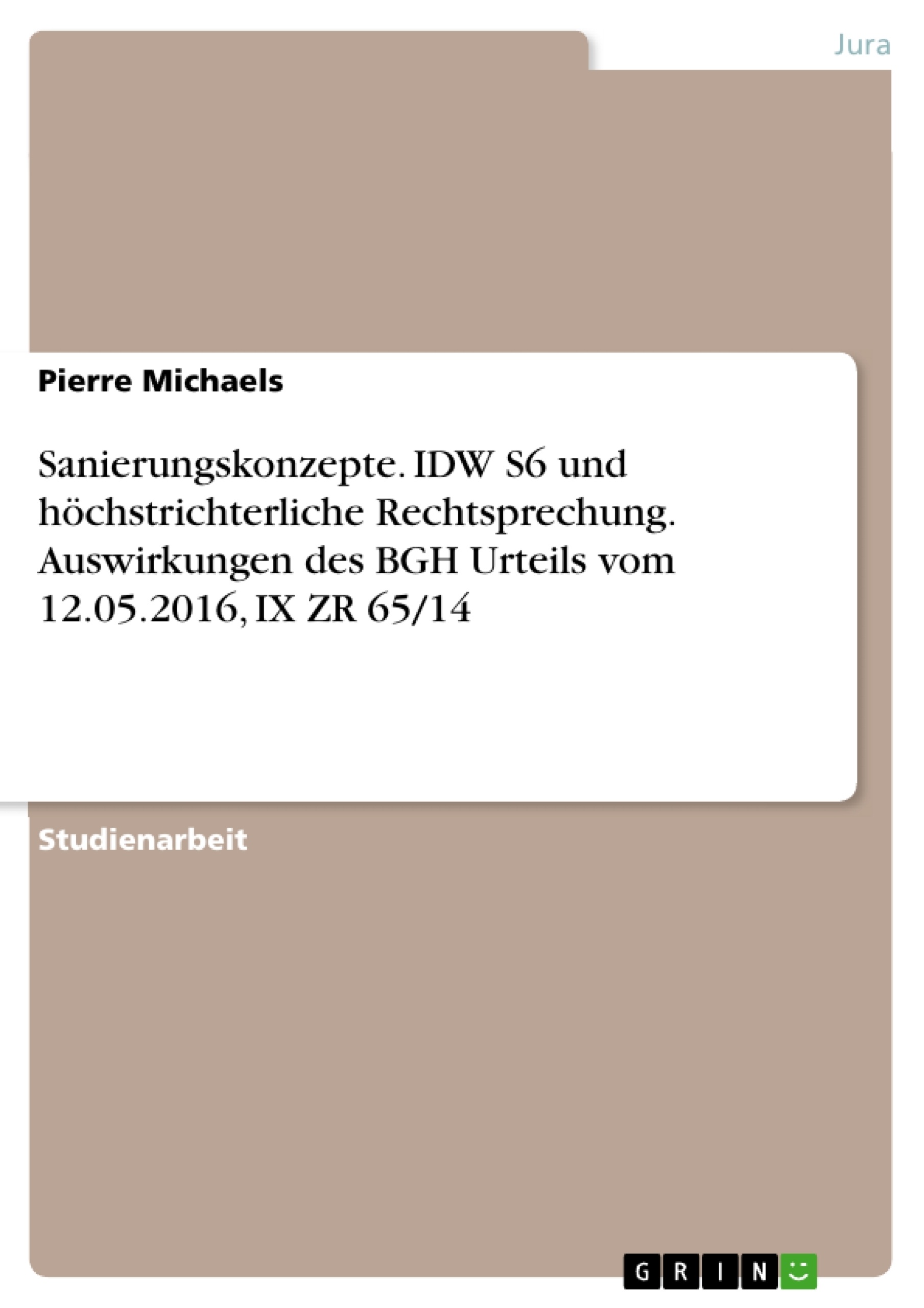Im vorliegenden Urteil galt es seitens des IX. Senats des Bundesgerichtshofes festzustellen, ob die Kenntnis des Gläubigers von einer vorsätzlichen Gläubigerbenachteiligung i.S.d. § 133 I S.2 InsO vorliegt und diese einen Anfechtungstatbestand begründe. Eine Kenntnis des Benachteiligungsvorsatzes des Schuldners wird regelmäßig schon vermutet, wenn der Gläubiger eine Inkongruenz der Leistung des Schuldners bemerkt oder wenn ein Anzeichen in den Handlungen des Schuldners auf eine Zahlungsunfähigkeit hinweist.
Der zu einem Urteil führende Sachverhalt beinhaltet zwei Streitparteien. Der Insolvenzverwalter
(nachfolgend: Klägerin) nimmt den Gläubiger (nachfolgend: Beklagte) auf Rückzahlung einer Vergleichszahlung im Rahmen der Insolvenzanfechtung gem. § 133 I S.2 InsO in Anspruch. Der Beklagten stunden fällige Forderungen in Höhe von € 59.703,20 zu. Mit Hilfe einer rechtskräftigen Titulierung von insgesamt € 25.416,85 erfolgte ein erfolgloser Versuch der Pfändung des Bankguthabens. Hierbei erhielt die Beklagte die Information, dass einerseits kein pfändbares Guthaben und andererseits bereits Vorpfändungen in Höhe von € 16.000 bestünden.
Inhaltsverzeichnis
- BGH Urteil vom 12.05.2016 – IX ZR 65/14
- Sachverhalt
- Problematik
- Anforderungen an Sanierungskonzepte zur Exkulpation des Gläubigers von der Kenntnis eines Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes des Schuldners
- Die Schlüssigkeit des Sanierungskonzeptes und die Prognose der Durchführbarkeit
- Analyse der wirtschaftlichen Ausgangslage des schuldnerischen Unternehmens
- Analyse der Krisenursachen und des derzeitig vorliegenden Stadiums
- Angaben über die Art der Durchführung/Anfordern von Informationen
- Art und Nachhaltigkeit der Sanierung
- Integrierte Unternehmensplanung
- Anwendbarkeit des Sanierungskonzeptes nach BGH vom 12.05.2016, IX ZR 65/14
- Auswirkungen des BGH Urteils vom 12.05.2016, IX ZR 65/14
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert das BGH-Urteil vom 12.05.2016 – IX ZR 65/14 und untersucht die Anforderungen an Sanierungskonzepte, um Gläubiger von der Kenntnis eines Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes des Schuldners zu exkulieren.
- Schlüssigkeit von Sanierungskonzepten
- Prognose der Durchführbarkeit von Sanierungskonzepten
- Analyse der wirtschaftlichen Ausgangslage des Schuldners
- Identifizierung von Krisenursachen und dem Stadium der Krise
- Anwendbarkeit des BGH-Urteils in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt den Sachverhalt des BGH-Urteils vor, beschreibt die Streitparteien und die relevanten Fakten.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Problematik des Urteils: Die Frage, ob der Gläubiger Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hatte und ob diese Kenntnis einen Anfechtungstatbestand begründete.
- Das dritte Kapitel analysiert die Anforderungen an Sanierungskonzepte, die notwendig sind, um den Gläubiger von der Kenntnis eines Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes zu exkulieren.
- Das vierte Kapitel untersucht die Auswirkungen des BGH-Urteils auf die Praxis der Sanierung und die Bedeutung von Sanierungskonzepten für Gläubiger und Schuldner.
Schlüsselwörter
Sanierungskonzepte, Gläubigerbenachteiligung, Insolvenzanfechtung, BGH-Urteil, IX ZR 65/14, Prognose der Durchführbarkeit, wirtschaftliche Ausgangslage, Krisenursachen, Anwendbarkeit.
- Arbeit zitieren
- Pierre Michaels (Autor:in), 2017, Sanierungskonzepte. IDW S6 und höchstrichterliche Rechtsprechung. Auswirkungen des BGH Urteils vom 12.05.2016, IX ZR 65/14, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/358070