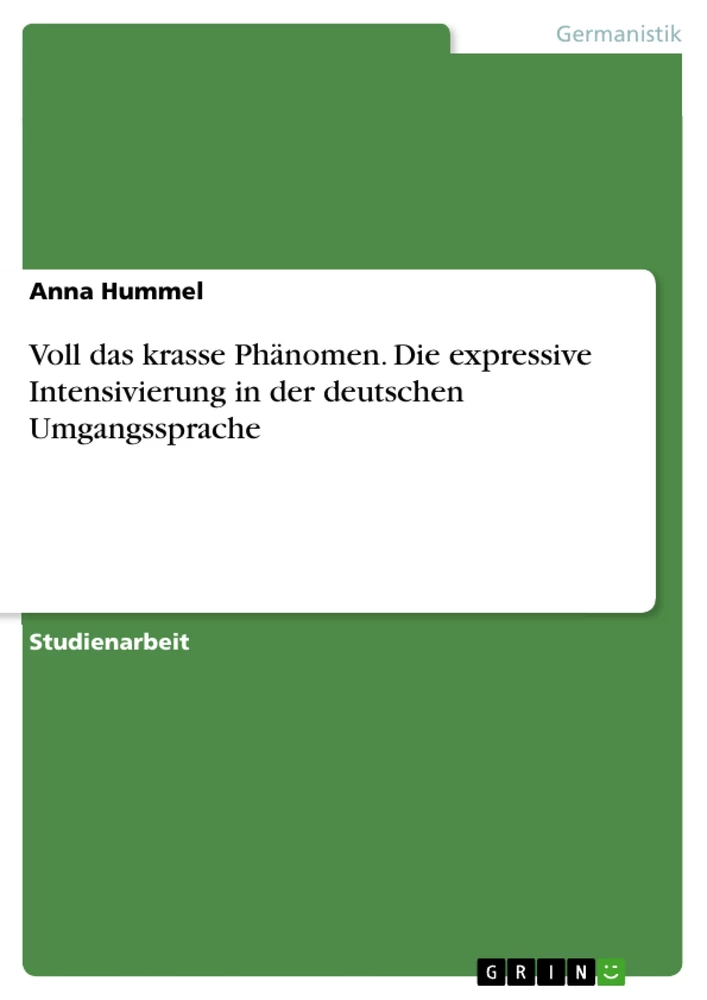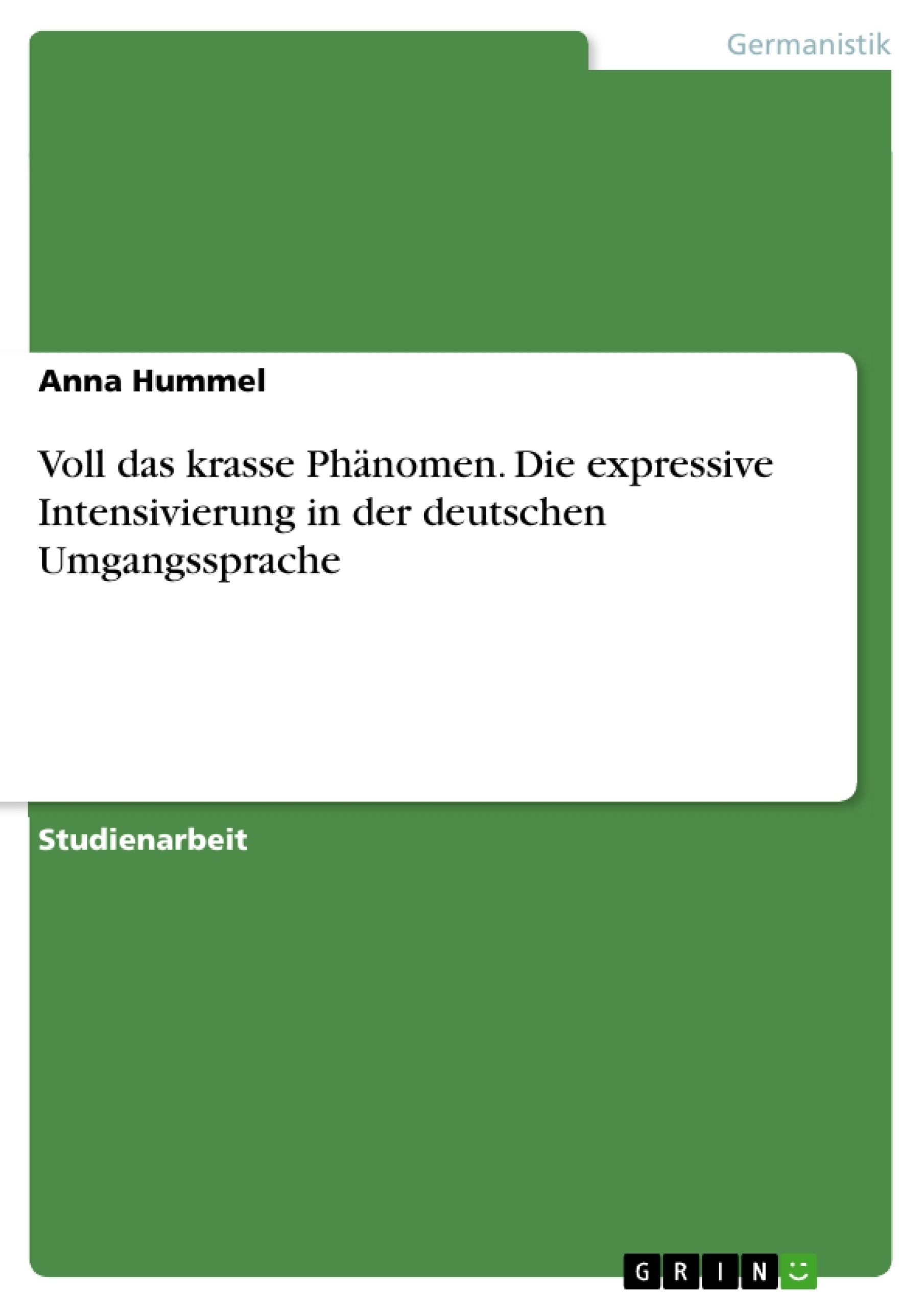Ein eher vernachlässigtes Phänomen ist die expressive lexikalische Intensivierung, die man mittlerweile – hört man junge Leute miteinander reden – in fast jedem Satz zu hören bekommt. Auffällig ist dabei eine Konstruktion, die sonst in der deutschen Grammatik syntaktisch so nicht vorkommt: Im umgangssprachlichen Gebrauch wird das verstärkende Element vor die zu intensivierende Nominalphrase gestellt, wodurch Formen wie „Sie ist echt 'voll die gute' Sängerin'“ oder „Ich hab gestern 'total den süßen Typen' kennengelernt“ entstehen.
Solchen Konstruktionen soll in dieser Arbeit auf den Grund gegangen werden. Dazu wird in Punkt 2 zunächst ein theoretischer Überblick über die verschiedenen Arten und Strukturen der Intensivierung im Deutschen verschafft und speziell auf die Besonderheiten der lexikalischen Intensivierung im Allgemeinen, anschließend im Hinblick auf die „Sonderkonstruktion“ mit vorangestelltem Intensivierer, eingegangen, was als Grundlage für den darauffolgenden empirischen Teil dienen soll. Hier wird zuerst der Frage nachgegangen, wie weit verbreitet diese Konstruktion ist und inwiefern sie als standardsprachlich betrachtet werden kann. Außerdem soll gezeigt werden, in welchen Kontexten solche Bildungen bevorzugt gebraucht werden sowie auf verschiedene Regeln und Restriktionen in der Verwendung hingewiesen werden. Den syntaktischen Besonderheiten kommt anschließend ein weiterer wichtiger Analyseschwerpunkt zu, wobei zum einen die verwendeten Adjektive als intensivierte Elemente genauer untersucht, zum anderen die Funktion und Position dieser Konstruktion im Satz analysiert werden sollen. Darauf folgen zwei verschiedene Erklärungshypothesen, wie eine solche syntaktische Veränderung überhaupt entstanden sein könnte. Zudem werden die Intensivierer genauer unter die Lupe genommen und auf mögliche Verwendbarkeit getestet.
Des Weiteren sollen auch die Erscheinungsformen ohne Adjektiv, also Bildungen, in denen nur das Nomen verstärkt wird, Teil der Untersuchung sein. Hierbei wird vor allem ein Blick auf die dabei intensivierten Nomen und deren semantische Merkmale geworfen.
Abschließend steht die Semantik der verschiedenen Intensivierer im Fokus der Analyse: Wie viel Bedeutung tragen sie noch in sich? Und kann man hierbei bereits von einer Desemantisierung, also einem Verlust des Bedeutungsinhalts, sprechen? Diesen Fragen wird im Zuge der empirischen Sprachgebrauchsanalyse versucht, auf den Grund zu gehen und sie so weit wie möglich zu erklären.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Sprachsystemanalyse
- Theorie der Intensivierung
- Abgrenzung
- Die lexikalische Intensivierung
- Variation in der Jugendsprache: EDCs
- Formale Aspekte
- Verortung der Variation
- Mögliche Interpretationsansätze
- Theorie der Intensivierung
- Empirische Sprachgebrauchsanalyse
- Methodik der Untersuchung
- Untersuchung der Hypothesen
- Analyse der EDCs
- Wegfallen des Adjektivs - Intensivierung von Nomen
- Desemantisierung der Intensivierer
- Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht die expressive lexikalische Intensivierung in der deutschen Umgangssprache, insbesondere im Kontext der Jugendsprache. Sie beleuchtet dabei die Verwendung von intensivierenden Elementen in Form von Adjektiven und Nominalphrasen und analysiert die syntaktischen Besonderheiten dieser Konstruktion. Darüber hinaus beschäftigt sich die Arbeit mit der semantischen Bedeutung der Intensivierer und der Frage, ob eine Desemantisierung im Laufe der Zeit stattfindet.
- Analyse der syntaktischen Besonderheiten der expressiven lexikalischen Intensivierung
- Untersuchung der Verwendung von Intensivierern in verschiedenen Kontexten
- Erforschung der semantischen Bedeutung von Intensivierern
- Beurteilung der Verbreitung der Konstruktion in der Jugendsprache
- Diskussion möglicher Interpretationsansätze für die Entstehung der Konstruktion
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Diese Einleitung gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zur expressiven lexikalischen Intensivierung in der deutschen Umgangssprache und stellt das Thema der Arbeit vor. Außerdem werden die Ziele der Arbeit und die wichtigsten Forschungsfragen definiert.
- Sprachsystemanalyse: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Intensivierung im Deutschen beleuchtet. Dabei werden verschiedene Arten der Intensivierung vorgestellt, wie beispielsweise die morphologische und die syntaktische Intensivierung. Besonderes Augenmerk wird auf die lexikalische Intensivierung gelegt und die Besonderheiten der "Sonderkonstruktion" mit vorangestelltem Intensivierer werden analysiert.
- Empirische Sprachgebrauchsanalyse: In diesem Kapitel wird die empirische Untersuchung der expressiven lexikalischen Intensivierung in der deutschen Umgangssprache vorgestellt. Die Methodik der Untersuchung wird erläutert und die Ergebnisse der Analyse werden dargestellt. Hierbei wird untersucht, wie weit verbreitet die Konstruktion ist, in welchen Kontexten sie bevorzugt verwendet wird und welche Regeln und Restriktionen bei der Verwendung gelten. Außerdem werden die semantischen Merkmale der intensivierten Nomen und die Bedeutung der Intensivierer untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Expressive Intensivierung, Jugendsprache, Umgangssprache, Lexikalische Intensivierung, Syntaktische Variation, Desemantisierung, Intensivierer, Nominalphrase, Adjektiv, Grammatik, Sprachwandel.
- Quote paper
- Anna Hummel (Author), 2016, Voll das krasse Phänomen. Die expressive Intensivierung in der deutschen Umgangssprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/355084