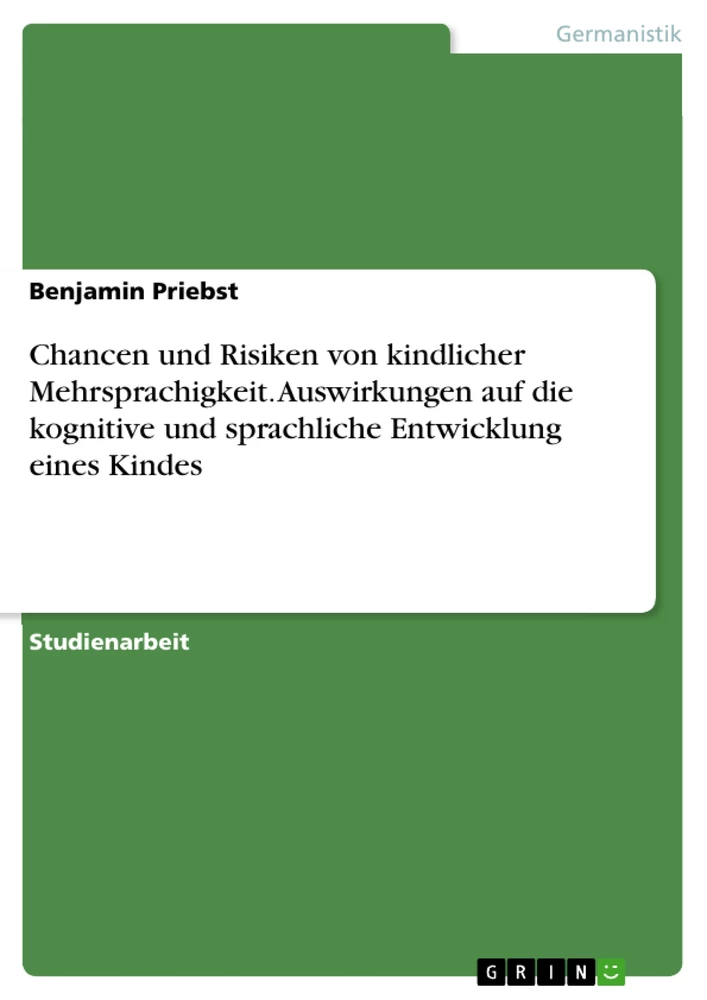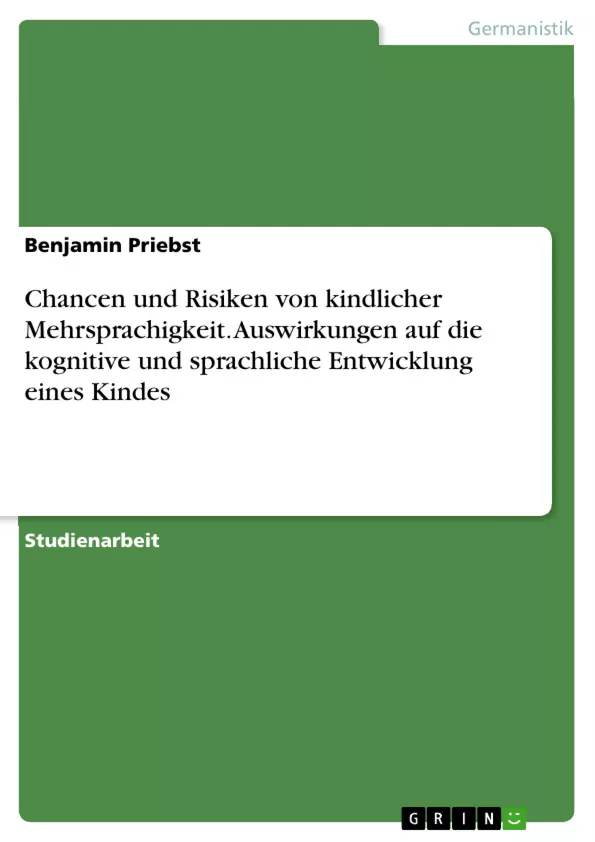Die Seminararbeit befasst sich mit den Chancen und Risiken kindlicher Mehrsprachigkeit. In einem Einführungskapitel werden die verschiedenen Formen kindlicher Mehrsprachigkeit in Bezug auf die zum Tragen kommenden spezifischen Erwerbsprozesse vorgestellt. Hierbei wird auch ein Einblick in den Stand der Forschung beziehungsweise die aktuelle Diskussion bezüglich der Mechanismen des kindlichen Spracherwerbs sowohl bei ein- als auch bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern gewährt. Der zweite Teil der Arbeit setzt sich in zwei Kapiteln mit der Diskussion auseinander, ob und inwiefern sich Mehrsprachigkeit positiv beziehungsweise negativ auf die sprachliche und allgemein-kognitive Entwicklung eines Kindes auswirkt.
Mehrsprachigkeit, also der Umstand für die alltägliche Kommunikation ohne Einschränkungen auf mehr als eine Sprache zurückgreifen zu können, ist in Deutschland zwar deutlich seltener anzutreffen als in traditionell mehrsprachigen Ländern wie der Schweiz und Indien oder klassischen Einwanderungsstaaten wie den USA, aber sie ist auch keineswegs das exotische Ausnahmephänomen mehr, das sie vor wenigen Jahrzehnten noch war. Das Statistische Bundesamt führt 19,5% der Bevölkerung Deutschlands als "Menschen mit Migrationshintergrund". Zwei Drittel davon sind im Laufe der letzten 50 Jahre zugewandert, das verbleibende Drittel umfasst die in Deutschland geborenen Kinder dieser Zugewanderten. Diese Zahlen machen deutlich, dass Mehrsprachigkeit in Deutschland für sprach- und bildungspolitische Betrachtungen und Entscheidungen ein wichtiger Faktor geworden ist, der sich vor allem in der Schulpolitik der letzten Jahrzehnte in hohem Maße bemerkbar macht. Staatliche Einrichtungen wie zweisprachige Kindergärten, bilinguale Schulen oder Züge an sprachlich orientierten Bildungseinrichtungen, aber auch private Initiativen wie die Anstellung von ausländischen Au Pairs oder fremdsprachigen Tagesmüttern zur Erziehung von Kindern lassen erkennen, wie wichtig eine gezielte Förderung mehrsprachiger Kinder mittlerweile geworden ist. Dabei hält sich bei aller Häufigkeit und Präsenz kindlicher Mehrsprachigkeit im Bewusstsein vieler Menschen nach wie vor eine Reihe von Vorurteilen und überholten „wissenschaftlichen Erkenntnissen“, die die grundsätzlich positiven Auswirkungen des Erwerbs zweier Sprachen auf die Entwicklung eines Kindes in Frage stellen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Unterschiedliche Formen von Mehrsprachigkeit
- 2.1 Die Auswirkungen neuronaler Reifungsprozesse auf den Erwerb einer zweiten Sprache
- 2.2 Der simultane Erwerb zweier Sprachen
- 2.3 Der sukzessive Erwerb zweier Sprachen
- 2.4 Der Zweitspracherwerb bei Kindern und Erwachsenen
- 3. Defizite, Risiken und Chancen in der sprachlichen Entwicklung mehrsprachiger Kinder
- 4. Defizite, Risiken und Chancen in der kognitiven Entwicklung mehrsprachiger Kinder
- 5. Schlussbetrachtungen
- 6. Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Seminararbeit analysiert die Chancen und Risiken kindlicher Mehrsprachigkeit. Sie untersucht die verschiedenen Formen des Mehrsprachigkeitserwerbs und beleuchtet die Auswirkungen auf die sprachliche und kognitive Entwicklung mehrsprachiger Kinder. Dabei werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsdiskussionen berücksichtigt.
- Formen kindlicher Mehrsprachigkeit und deren Erwerbsprozesse
- Einfluss von Mehrsprachigkeit auf die sprachliche Entwicklung
- Auswirkungen von Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung
- Diskussion von Defiziten, Risiken und Chancen der Mehrsprachigkeit
- Bewertung aktueller Forschungsergebnisse und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung stellt die Relevanz von Mehrsprachigkeit in Deutschland dar und führt in die Thematik der Seminararbeit ein. Sie erläutert den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfrage, die in den folgenden Kapiteln näher beleuchtet werden soll.
Kapitel 2: Unterschiedliche Formen von Mehrsprachigkeit Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Formen kindlicher Mehrsprachigkeit und erklärt, wie sich diese auf die Erwerbsprozesse auswirken. Es werden die drei Hauptformen der Mehrsprachigkeit beschrieben: simultaner, sukzessiver und der Zweitspracherwerb bei Kindern und Erwachsenen.
Kapitel 3: Defizite, Risiken und Chancen in der sprachlichen Entwicklung mehrsprachiger Kinder Das dritte Kapitel analysiert die möglichen Defizite, Risiken und Chancen, die mit der sprachlichen Entwicklung mehrsprachiger Kinder einhergehen. Es wird untersucht, inwiefern der Erwerb mehrerer Sprachen die sprachliche Entwicklung positiv oder negativ beeinflusst.
Kapitel 4: Defizite, Risiken und Chancen in der kognitiven Entwicklung mehrsprachiger Kinder Kapitel vier fokussiert auf die kognitiven Auswirkungen von Mehrsprachigkeit. Es werden Erkenntnisse zur kognitiven Entwicklung mehrsprachiger Kinder vorgestellt und die potenziellen Risiken und Vorteile der Mehrsprachigkeit in diesem Kontext beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Mehrsprachigkeit, kindlicher Spracherwerb, Sprachentwicklung, kognitive Entwicklung, Defizite, Risiken, Chancen, simultaner Erwerb, sukzessiver Erwerb, Zweitspracherwerb, bilinguale Kinder, Forschungsergebnisse.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Priebst (Autor:in), 2013, Chancen und Risiken von kindlicher Mehrsprachigkeit. Auswirkungen auf die kognitive und sprachliche Entwicklung eines Kindes, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/353642