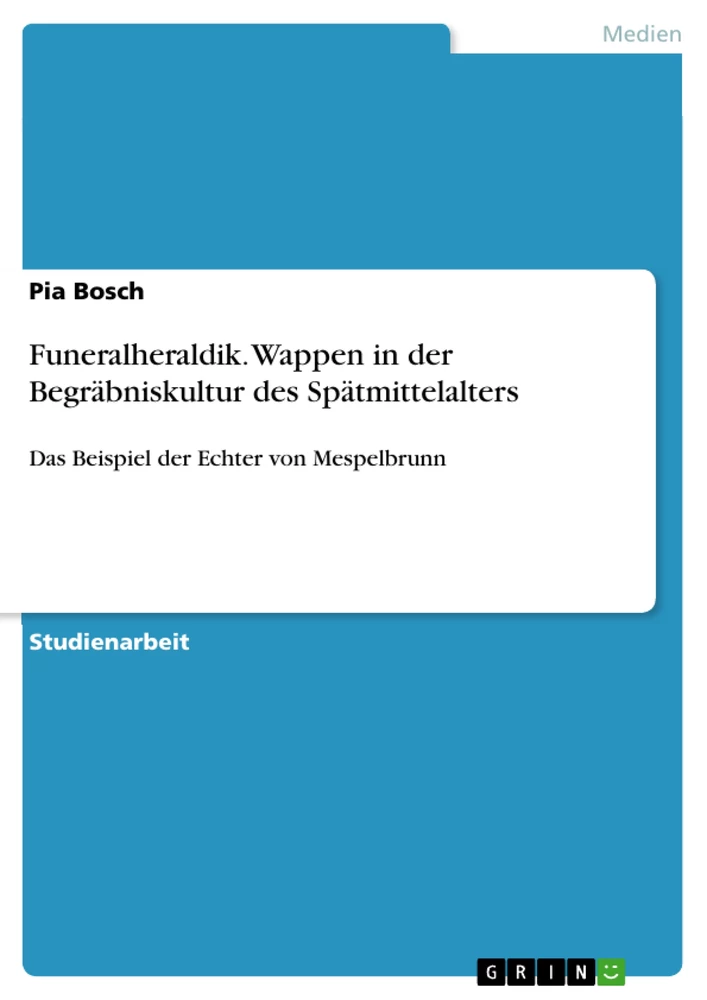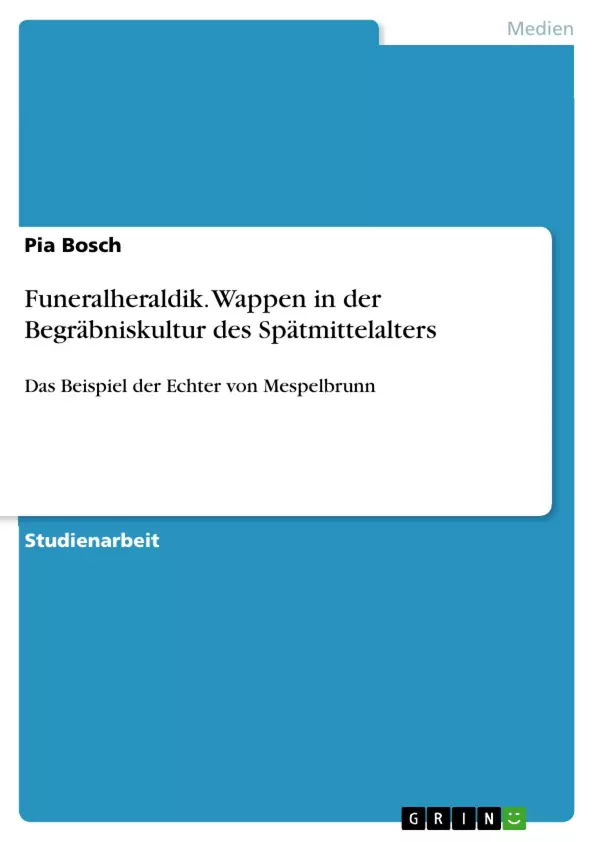Die Bildkultur des Spätmittelalters kannte im Wesentlichen zwei Ausformungen: die der christlichen und die der höfischen, weltlichen Bildkultur. Die kirchliche und klösterliche Welt war für die Menschen des Mittelalters allgegenwärtig und dominant. Hier entwickelte sich die größte Vielfalt an Bildern. Die christliche Bildkultur versuchte mit ihren Bildern die Erinnerung an die Heilsgeschichte zu wahren und ihre Glaubensinhalte durch sie zu vermitteln.
Die Heraldik war ein wichtiger Bestandteil spätmittelalterlicher Bildkultur. Im Allgemeinen finden sich Wappen im Hoch- und Spätmittelalter wo man hinschaut: auf Kirchenfenstern, Siegeln, Kleidern und Pferdedecken, Wandteppichen, Möbeln und den Wappenrollen und -briefen. Sie repräsentieren, identifizieren, dekorieren und memorieren – letzteres wird anhand wappengeschmückter Grabmäler, Epitaphe, Grabkapellen, Grüfte und auch Begräbnisse des Mittelalters besonders deutlich.
Mit dieser sogenannten Funeralheraldik und ihrer Bedeutung für die Begräbniskultur des Spätmittelalters beschäftigt sich diese Arbeit im Besonderen. Anhand aussagekräftiger Beispiele wird die Systematik der Funeralheraldik erklärt und ihre Darstellungsvielfalt verdeutlicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundregeln der Heraldik und die Darstellung von Wappen auf Grabmälern
- Die Grundregeln der Heraldik
- Die Aufschwörtafeln und die Darstellung von Wappen auf Grabmälern
- Die Grabmäler der Echter von Mespelbrunn
- Das Adelsgeschlecht der Echter von Mespelbrunn
- Das Grabmal des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn im Würzburger Dom
- Das Epitaph des Valentin Echter von Mespelbrunn
- Der Grabstein des letzten Echter von Espelbrunn im Würzburger Dom
- Abschließende Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funeralheraldik, also die Verwendung von Wappen in der Begräbniskultur des Spätmittelalters. Sie analysiert die Systematik der Funeralheraldik und ihre Darstellungsvielfalt anhand von Beispielen aus dem Adelsgeschlecht der Echter von Mespelbrunn.
- Die Bedeutung von Wappen in der spätmittelalterlichen Bildkultur
- Die Funktion von Wappen auf Grabmälern und Epitaphen
- Die Rolle der Aufschwörtafeln bei der Interpretation von Wappen
- Die Darstellung von Familiengeschichten und Herrschaftsbereichen durch Wappen
- Die Besonderheiten der Grabmäler der Echter von Mespelbrunn
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Bildkultur und der Heraldik im Spätmittelalter dar und führt in das Thema der Funeralheraldik ein. Das zweite Kapitel behandelt die Grundregeln der Heraldik und die Darstellung von Wappen auf Grabmälern, insbesondere im Hinblick auf Aufschwörtafeln. Das dritte Kapitel widmet sich den Grabmälern der Echter von Mespelbrunn, wobei die Grabmäler des Fürstbischofs Julius Echter, des Valentin Echter und des letzten Echter von Mespelbrunn im Würzburger Dom im Detail betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Funeralheraldik, Wappen, Begräbniskultur, Spätmittelalter, Echter von Mespelbrunn, Aufschwörtafeln, Grabmäler, Epitaphe, Familiengeschichte, Herrschaftsbereich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Funeralheraldik?
Funeralheraldik bezeichnet die Verwendung von Wappen im Rahmen der Begräbniskultur, etwa auf Grabmälern, Epitaphen oder Totenschilden.
Welche Funktion hatten Wappen auf mittelalterlichen Gräbern?
Sie dienten der Identifikation des Verstorbenen, der Repräsentation seines Status und dem Gedenken an seine Familiengeschichte.
Was sind Aufschwörtafeln?
Aufschwörtafeln sind heraldische Darstellungen, die die Ahnenprobe eines Adligen dokumentieren, um dessen Standeszugehörigkeit zu beweisen.
Wer war Julius Echter von Mespelbrunn?
Er war ein bedeutender Fürstbischof von Würzburg, dessen Grabmal im Würzburger Dom ein wichtiges Beispiel für prunkvolle Funeralheraldik ist.
Warum war die Heraldik im Spätmittelalter so allgegenwärtig?
Wappen waren in einer Zeit begrenzter Alphabetisierung ein universelles visuelles Kommunikationsmittel für Identität, Besitz und Herrschaft.
- Arbeit zitieren
- Pia Bosch (Autor:in), 2015, Funeralheraldik. Wappen in der Begräbniskultur des Spätmittelalters, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/352022