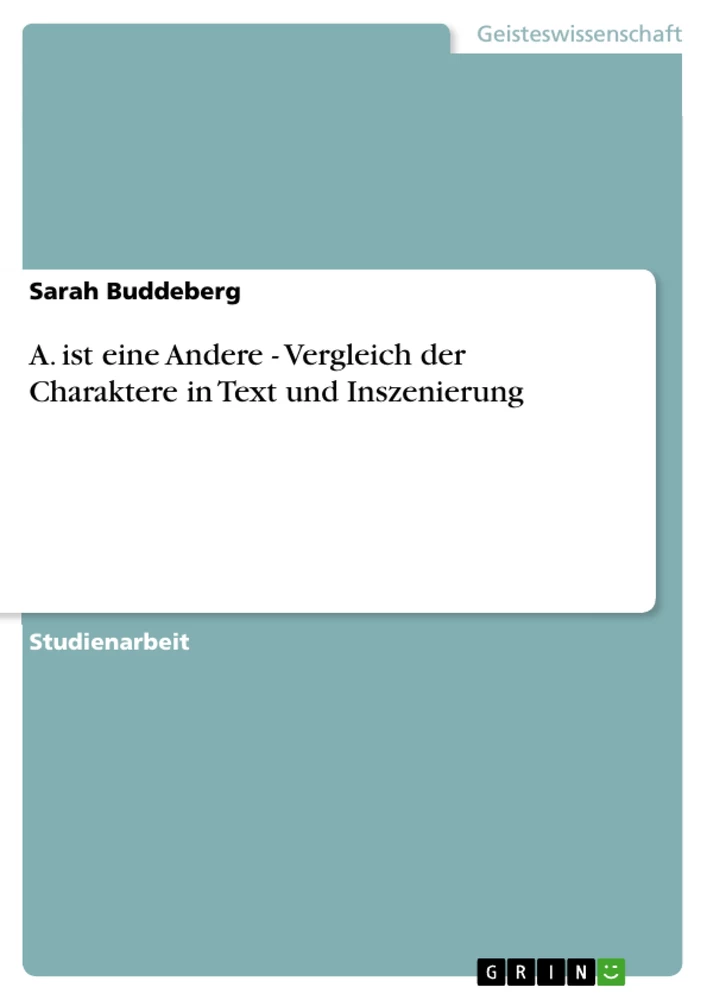A., eine Frau Mitte zwanzig, glücklich verheiratet, scheint völlig unerwartet ihrem
Leben ein Ende gesetzt zu haben: eine verbrannte Leiche wird neben ihrem Wagen
gefunden. Die Nachricht von ihrem brutalen Selbstmord erschüttert den geordneten
Alltag der ihr nahestehenden Menschen. Ihr Vater Pheres, ihr Mann Gerd, dessen
Freund Herwig, genannt Bongo und A.’s beste Freundin Nina rekonstruieren in
Rückschau und Rückblende die erlebte Zeit mit A.. Immer mehr kreist dabei jeder um
sich selbst, Dialoge gehen aneinander vorbei, bis zur Frage nach dem „Warum“ kommt
keiner von ihnen – und gerade das spiegelt die Situation, aus der A. geflohen ist: ein
Leben, das beengende Formen anzunehmen beginnt und zwischenmenschliche
Beziehungen, deren Funktionieren von festgelegten Rollen abhängt. Am Ende bleibt
offen, ob A.’s Flucht wirklich eine endgültige war.
Nach gründlicher Lektüre des mit dem Kleist-Preis ausgezeichneten Dramas „A. ist eine
Andere“ von Andreas Sauter und Bernhard Studlar wirkte die Leipziger Inszenierung
von Jorinde Dröse, Regie, und Sonja Bachmann, Dramaturgie, eher enttäuschend. In
dieser Hausarbeit soll durch Text- und Inszenierungsanalyse der Frage nachgegangen
werden, in welchen wesentlichen Punkten, besonders in der Darstellung der Charaktere,
das Regiekonzept vom Originaltext abweicht. Dabei habe ich mich besonders auf die
Figur der Nina konzentriert, bei der die Unterschiede zwischen Textanalyse und
Darstellung wohl auch am deutlichsten ist. Alle Zitate sind dem Stück ‚A. ist eine
Andere’ von Sauter/Studlar und der Strichfassung dieses Stückes von Dröse/Bachmann
entnommen. Weitere Quellen wurden nicht verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Kurze Inhaltsangabe / Einleitung
- 2. Die Charaktere
- 2.1 A.
- 2.2 Pheres
- 2.3 Nina
- 2.4 Gerd
- 2.5 Bongo
- 3. Die Inszenierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Leipziger Inszenierung von Jorinde Dröses "A. ist eine Andere" und vergleicht sie mit dem Originaltext von Andreas Sauter und Bernhard Studlar. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in der Charakterdarstellung, insbesondere der Figur Nina. Die Arbeit untersucht, inwiefern das Regiekonzept vom Originaltext abweicht und welche Auswirkungen diese Abweichungen auf die Gesamtinterpretation des Stücks haben.
- Vergleich der Charaktere im Text und in der Inszenierung
- Analyse der Regieentscheidungen und deren Auswirkungen
- Interpretation der Figuren und ihrer Beziehungen
- Untersuchung des Themas Identitätssuche
- Bedeutung der Schlüsselszene "Problem arabesque"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Kurze Inhaltsangabe / Einleitung: Die Einleitung stellt das Drama "A. ist eine Andere" vor und beschreibt den unerwarteten Tod der Protagonistin A. Sie skizziert den Versuch der um A. trauernden Personen, ihr Verschwinden zu rekonstruieren und die Motive hinter ihrem Handeln zu verstehen. Der Fokus der Arbeit wird auf den Vergleich zwischen dem Text und der Leipziger Inszenierung gelegt, wobei besonderes Augenmerk auf die Figur Nina gerichtet wird. Die Einleitung betonen die Lücke zwischen der vielschichtigen Textvorlage und der scheinbar vereinfachten Inszenierung.
2. Die Charaktere: Dieses Kapitel bietet detaillierte Charakteranalysen von A., Pheres, Nina, Gerd und Bongo. Es werden die Beziehungen zwischen den Charakteren beleuchtet und deren Rollen im Stück analysiert. Die Kapitelteil-Zusammenfassungen konzentrieren sich auf die jeweiligen Schlüsselmerkmale jedes Charakters und zeigen die unterschiedlichen Perspektiven auf A. und ihre Situation auf. Das Kapitel unterstreicht, wie jede Figur A. in eine für sie selbst verständliche Rolle einordnet, anstatt sie als eigenständige Person zu betrachten.
2.1 A.: Die Analyse der Figur A. beginnt mit der Frage nach ihrer Identität und rekonstruiert ihr Leben anhand der Aussagen anderer Charaktere. A. wird als lebenslustig und lebenshungrig dargestellt, was den Selbstmord rätselhaft erscheinen lässt. Die Schlüsselszene "Problem arabesque" offenbart A.'s Suche nach sich selbst, ihre Bemühung um die eigene Identität und ihre Überzeugung vom Scheitern dieses Unterfangens. Die zentrale These ist, dass A. durch die Reduktion auf die von anderen ihr zugewiesenen Rollen an der Entdeckung ihrer eigenen Identität gehindert wird.
2.2 Pheres: Pheres, A.'s Vater, wird als zurückgezogener Blumenhändler charakterisiert, dessen Leben durch den Tod seiner Frau und die enge Beziehung zu seiner Tochter geprägt ist. Die Analyse deutet eine ambivalente Beziehung zwischen Vater und Tochter an, wobei A. für Pheres möglicherweise mehr als nur eine Tochter war. Pheres' Reaktion auf A.'s Verschwinden offenbart seine Unfähigkeit, sie loszulassen, und seine resignative Haltung gegenüber dem Verlust.
2.3 Nina: Nina, A.'s beste Freundin, wird als Gegenfigur zu A. dargestellt, deren Verhalten im Gegensatz zu A.'s Lebensfreude eher auf einen selbstzerstörerischen Impuls hindeutet. Die Analyse zeigt Ninas Unfähigkeit im Umgang mit Vergänglichkeit und ihre problematische Beziehung zu A. auf. Es wird die Frage nach einer möglichen Liebesbeziehung zwischen Nina und A. gestellt, die durch Ninas Reaktion auf Gerds Beziehung zu A. unterstützt wird. Ninas Alkoholmissbrauch und ihre unverarbeitete Trauer nach A.'s Verschwinden werden ausführlich behandelt.
2.4 Gerd: Gerd, A.'s Ehemann, wird als erfolgreicher Architekt dargestellt, der bemüht ist, es allen recht zu machen und Harmonie zu schaffen. Die Analyse konzentriert sich auf Gerds Unverständnis für A.'s Handeln und seine Reaktion auf ihren Tod. Es wird die Frage gestellt, ob A. für Gerd austauschbar wäre und ob seine Beziehung zu A. auf einem Missverständnis beruhte. Gerds Wandlung nach A.'s Tod und seine Flucht aus einem festgefahrenen Leben werden als zentrale Aspekte seiner Entwicklung betrachtet.
2.5 Bongo: Bongo, Gerds bester Freund, wird als oberflächlicher und machohafter Charakter dargestellt. Die Analyse beleuchtet sein Verhältnis zu Gerd und Nina, besonders die Frage nach seinem einseitigen Interesse an Nina. Bongos Reaktion auf A.'s Tod zeigt seine oberflächliche Anteilnahme und seine Unfähigkeit, die Situation tiefgründig zu verstehen.
3. Die Inszenierung: Dieses Kapitel bewertet die Inszenierung des Stücks im Leipziger "Horch & Guck". Es analysiert das Bühnenbild, die Darstellung der Charaktere und das Regiekonzept. Der Fokus liegt auf den Abweichungen vom Originaltext und deren Auswirkungen auf die Interpretation des Stücks. Es wird besonders kritisiert, dass die vielschichtige Darstellung der Charaktere, insbesondere Nina, zu Gunsten einer vereinfachten und teilweise oberflächlichen Interpretation reduziert wird. Die Inszenierung wird insgesamt als nicht zufriedenstellend beurteilt, da sie die Komplexität des Originaltextes nicht ausreichend wiedergibt.
Schlüsselwörter
A. ist eine Andere, Andreas Sauter, Bernhard Studlar, Jorinde Dröse, Sonja Bachmann, Inszenierungsanalyse, Charakteranalyse, Identitätssuche, Selbstmord, Beziehungen, Freundschaft, Liebe, Missverständnis, Flucht, Text-Inszenierungsvergleich, Nina, Gerd, Pheres, Bongo.
Häufig gestellte Fragen zu "A. ist eine Andere" - Inszenierungsanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert die Leipziger Inszenierung von Jorinde Dröses Theaterstück "A. ist eine Andere" und vergleicht sie mit dem Originaltext von Andreas Sauter und Bernhard Studlar. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in der Charakterdarstellung, insbesondere der Figur Nina, und den Auswirkungen dieser Unterschiede auf die Gesamtinterpretation.
Welche Aspekte werden im Vergleich zwischen Text und Inszenierung untersucht?
Die Arbeit vergleicht die Charaktere im Text und in der Inszenierung, analysiert die Regieentscheidungen und deren Auswirkungen, interpretiert die Figuren und ihre Beziehungen, untersucht das Thema Identitätssuche und die Bedeutung der Schlüsselszene "Problem arabesque".
Welche Charaktere werden im Detail analysiert?
Die Hausarbeit bietet detaillierte Charakteranalysen von A., Pheres (A.'s Vater), Nina (A.'s beste Freundin), Gerd (A.'s Ehemann) und Bongo (Gerds bester Freund). Die Analysen beleuchten die Beziehungen zwischen den Charakteren und deren jeweilige Rollen im Stück.
Wie wird die Figur A. dargestellt?
A. wird als lebenslustig und lebenshungrig dargestellt, was ihren Selbstmord rätselhaft erscheinen lässt. Die Analyse untersucht ihre Identitätssuche und die Frage, inwiefern sie durch die Reduktion auf von anderen ihr zugewiesenen Rollen an der Entdeckung ihrer eigenen Identität gehindert wird. Die Schlüsselszene "Problem arabesque" spielt dabei eine wichtige Rolle.
Wie werden die anderen Figuren beschrieben?
Pheres wird als zurückgezogener Blumenhändler dargestellt, dessen Leben durch den Tod seiner Frau und die enge Beziehung zu seiner Tochter geprägt ist. Nina wird als Gegenfigur zu A. beschrieben, mit selbstzerstörerischen Impulsen und einer problematischen Beziehung zu A. Gerd wird als erfolgreicher Architekt dargestellt, der Harmonie sucht und A.'s Handeln nicht versteht. Bongo wird als oberflächlicher und machohafter Charakter charakterisiert.
Wie wird die Inszenierung bewertet?
Die Inszenierung im Leipziger "Horch & Guck" wird kritisch bewertet. Es wird bemängelt, dass die vielschichtige Darstellung der Charaktere, insbesondere Nina, zu Gunsten einer vereinfachten und teilweise oberflächlichen Interpretation reduziert wird. Die Inszenierung wird insgesamt als nicht zufriedenstellend beurteilt, da sie die Komplexität des Originaltextes nicht ausreichend wiedergibt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: "A. ist eine Andere", Andreas Sauter, Bernhard Studlar, Jorinde Dröse, Sonja Bachmann, Inszenierungsanalyse, Charakteranalyse, Identitätssuche, Selbstmord, Beziehungen, Freundschaft, Liebe, Missverständnis, Flucht, Text-Inszenierungsvergleich, Nina, Gerd, Pheres, Bongo.
Welche zentrale These wird in der Arbeit vertreten?
Eine zentrale These ist, dass A. durch die Reduktion auf die von anderen ihr zugewiesenen Rollen an der Entdeckung ihrer eigenen Identität gehindert wird. Die Inszenierung wird als Vereinfachung und Verflachung des komplexen Themas kritisiert.
- Arbeit zitieren
- Sarah Buddeberg (Autor:in), 2003, A. ist eine Andere - Vergleich der Charaktere in Text und Inszenierung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/35081