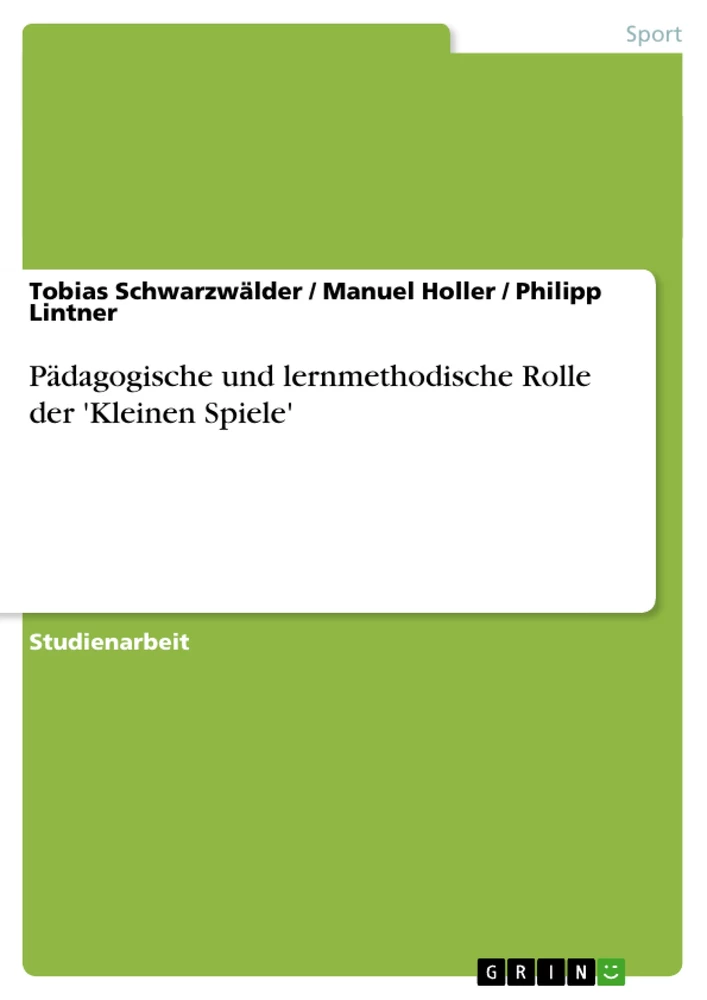„Kleine Spiele“ haben sich seit Jahren im Schul- und Vereinssport etabliert, sei es als Aufwärmspiel, als Förderung des sozialen Verhaltens oder als Heranführung an die großen Sportspiele.
Der Begriff „Kleine Spiele“ bezeichnet im Allgemeinen „eine von einem bestimmten Spielgedanken bzw. einer Aufgabe ausgehenden Folge von lustbetonten und freudvollen Handlungen, die in anregender und unterhaltender Form die körperlichen und geistigen Kräfte entwickeln und üben“ sollen. (Döbler u. Döbler, S.31)
Die Anfänge der Spielbewegung gehen auf GutsMuths zurück. Er veröffentlichte 1796 sein erstes Lehrbuch für Spiele, um die disziplinierenden schulischen Leibesübungen aufzulockern und spielerischer zu gestalten. Die traditionelle Männergymnastik trat keinesfalls zurück, sie wurde durch die „Kleinen Spiele“ und neue Spiele aus England, wie Fußball, Kricket oder Lawn Tennis, lediglich ergänzt.
„Große Kampfspiele“ entstanden, die vor allem bei älteren Schülern eingesetzt wurden. Der neue Spielgedanke wurde an die deutschen Turnspiele angepasst, sodass neue Spiele im Schulsport eingeführt wurden.
Heute sind einige dieser Sportarten beinahe „ausgestorben“. Die damals „Großen Sportspiele“ wie Faustball, Schlagball, Feldhandball und Prellball spielen in der gegenwärtigen Welt des Sports eine untergeordnete Rolle. Viele Sportgeräte wie das Schlagholz, das Wurfholz oder das Tamburin, welches vorwiegend für Singspiele eingesetzt wurde, existieren in deutschen Sporthallen schon längere Zeit nicht mehr.
Der Stellenwert der „kleinen Spiele“ hat sich im Laufe der Zeit geändert. Füllten sie vor Jahren noch ganze Schulstunden, werden sie heute meist nur noch zur Vorbereitung auf die „Großen Sportspielen“ eingesetzt.
Die große Anzahl an Einsatzmöglichkeiten und der lernmethodische Ansatz der „Kleinen Spiele“ werden im Verlauf der Arbeit vorgestellt.
Zahlreiche Autoren bemühen sich die historischen Spielformen wieder in den heutigen Schul- und Vereinsport aufzunehmen, in dem sie in Büchern und Berichten die „Kleinen Turnspiele“ wieder aufleben zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung (Philipp Lintner)
- 1.1 Klassifizierung und Abgrenzung zu anderen Spielformen
- 1.1.1 Die präventiv-medizinisch orientierte Systematik nach Stemper (1983)
- 1.1.2 Die Systematik nach Brinkmann & Treeß (1980)
- 1.1.3 Die Systematik sozial-affektiver Aspekte nach Kapustin (1983)
- 1.1.4 Die Systematik nach Räumlichkeiten nach Elstner (1979)
- 1.1.5 Die Systematik nach Döbler & Döbler (1998)
- 1.2 Definition, Anforderung an „Kleine Spiele, Abgrenzungen
- 1.3 Anforderungen an die „Kleinen Spiele“
- 1.4 Abgrenzungen
- 1.5 Kleine Spiele - Wozu?
- 1.3.1 Schulung von Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer
- 1.3.2 Schulung der Koordination
- 1.3.3 Schulung von Sehen, Hören, Fühlen
- 1.3.4 Förderung von sozialem Verhalten
- 1.3.5 Förderung von kreativem Verhalten
- 1.3.6 Vorbereitung auf die „Großen Spiele\" wie Basketball, Fußball, Handball, Hockey, Volleyball
- 1.3.7 Vorbereitung auf die Individualrückschlagspiele wie Badminton und Tischtennis
- 1.4 Variationen
- 1.5 Anwendungsbereiche
- 2 Die pädagogische Rolle der „Kleinen Spiele\" (Tobias Schwarzwälder)
- 2.1 Bezug zum Lehrplan
- 2.1.1 Wieso „Kleine Spiele“ im Sportunterricht?
- 2.2 Erziehung zum Sport
- 2.3 Förderung/Forderung zu sozialer Attitüde
- 2.4 Fairness und Ehrlichkeit
- 2.5 Ordnung und Disziplin
- 2.6 Förderung der Kreativität
- 2.7 „Kleine Spiele“ im außerschulischen Anwendungsbereich
- 2.7.1 Kleine Spiele\" im Freizeitsport
- 2.7.2,,Kleine Spiele\" im Leistungssport
- 2.7.3,,Kleine Spiele“ in der Rehabilitation und im Behindertensport
- 2.8 New Games
- 3 Zusammenfassung und Fazit
- 4 Mit Kleinen Spielen lernen – Neurowissenschaftliche Zusammenhänge (Manuel Holler)
- 4.1 Einführung
- 4.2 Die Tätigkeit des Gehirns
- 4.3 Lernen im neuronalen Netzwerk
- 4.4 Das Gehirn lernt immer - nur was?
- 4.5 Wir können viel und wissen wenig
- 4.6 Spielerisch Lernen
- 4.7 Können langsam lernen
- 4.8 Reflektion ist Lernen
- 5 (Kein) Ende...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der pädagogischen und lernmethodischen Rolle von „Kleinen Spielen“ im Sportunterricht und darüber hinaus. Ziel ist es, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und den didaktischen Wert dieser Spielform aufzuzeigen und wissenschaftliche Erkenntnisse zum spielerischen Lernen zu beleuchten.
- Klassifizierung und Abgrenzung von „Kleinen Spielen“
- Die pädagogische Rolle von „Kleinen Spielen“ im Sportunterricht
- Die lernmethodischen Aspekte von „Kleinen Spielen“
- Die Rolle von „Kleinen Spielen“ im außerschulischen Bereich
- Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum spielerischen Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung Dieses Kapitel definiert den Begriff „Kleine Spiele“, grenzt ihn von anderen Spielformen ab und erläutert seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Es stellt zudem verschiedene Klassifizierungssysteme und historische Entwicklungen vor.
- Kapitel 2: Die pädagogische Rolle der „Kleinen Spiele“ Dieses Kapitel analysiert die pädagogische Relevanz von „Kleinen Spielen“ im Sportunterricht und beleuchtet deren Beitrag zur Erziehung zum Sport, zur Förderung sozialer Kompetenzen sowie zur Entwicklung von Fairness und Disziplin.
- Kapitel 3: Mit Kleinen Spielen lernen – Neurowissenschaftliche Zusammenhänge Dieses Kapitel befasst sich mit den neurobiologischen Grundlagen des spielerischen Lernens und zeigt, wie „Kleine Spiele“ die Entwicklung von Gehirnaktivitäten und kognitiven Fähigkeiten fördern können.
Schlüsselwörter
„Kleine Spiele“, Sportunterricht, Pädagogik, Lernmethoden, Sozialverhalten, Neurowissenschaften, spielerisches Lernen, Kognition, Entwicklung, Didaktik, Kreativität, Fairness, Disziplin
- Quote paper
- Tobias Schwarzwälder (Author), Manuel Holler (Author), Philipp Lintner (Author), 2004, Pädagogische und lernmethodische Rolle der 'Kleinen Spiele', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/34717