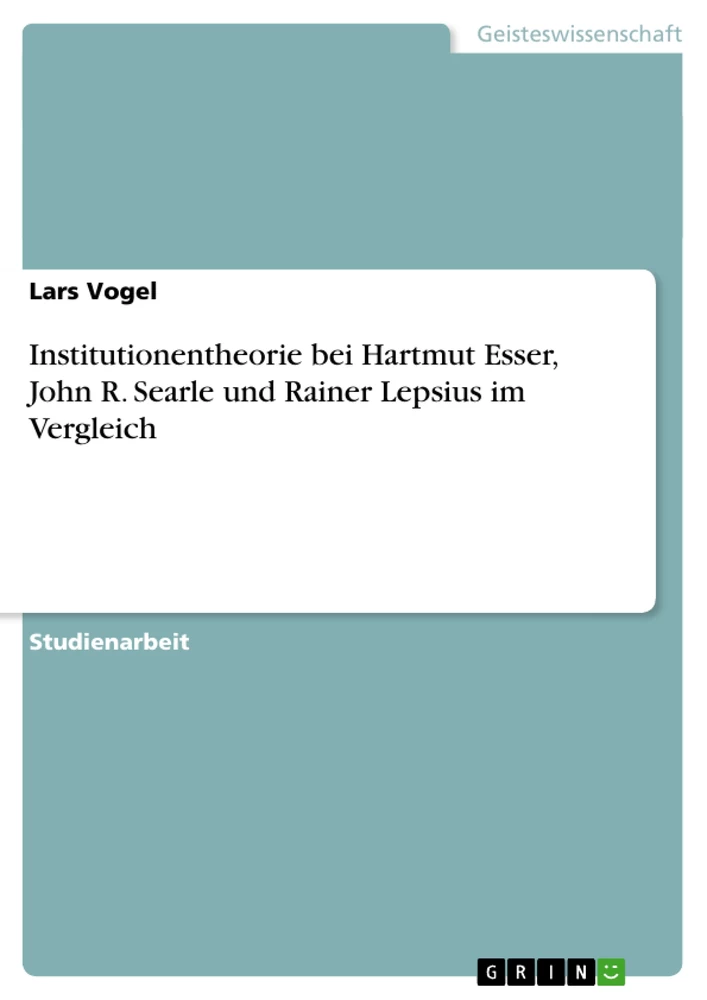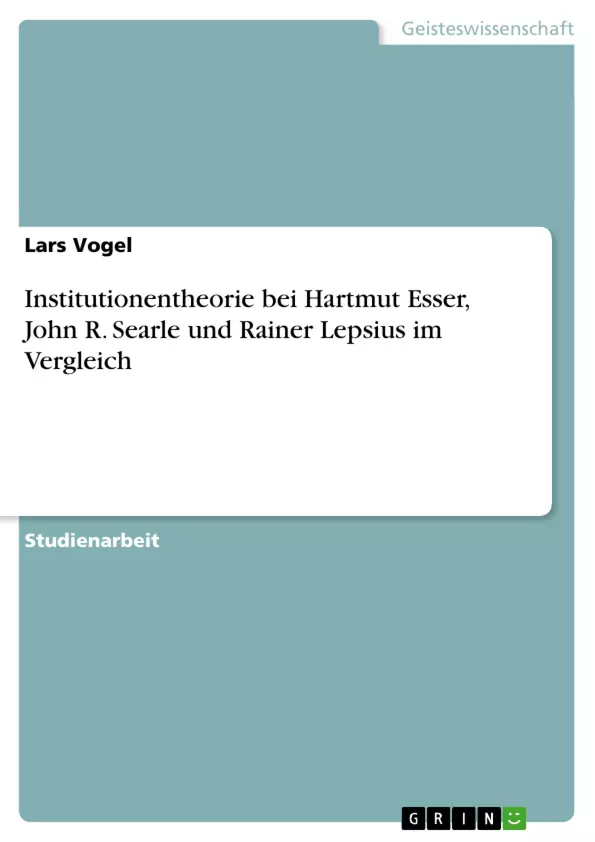Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit drei Theorien über Institutionen. Da der Erkenntnisgegenstand in der Sozialwissenschaft auch durch die Theorie strukturiert wird, ist ein Vergleich hauptsächlich deshalb möglich, weil alle drei den Begriff Institutionen benutzen. Herauszuarbeiten, ob alle drei dasselbe Phänomen untersuchen, ist ein Ziel dieser Arbeit. Es erschien zum Zwecke des Vergleich sinnvoll, zuerst zwei der Theorien vorzustellen. Es sind dies die Theorien von Hartmut Esser und John R. Searle. Erst im dritten Teil, dem eigentlichen Vergleich, wird der dritte Autor, Rainer M. Lepsius, eingeführt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dennoch auf den ersten beiden Autoren, denn der Vergleich zwischen ihnen ist am fruchtbarsten. Dies ist insbesondere in der zugrundeliegenden Annahme begründet, dass Lepsius das Verhältnis zwischen Struktur und Handlung anders fasst, als die ersten beiden Autoren.
Nach einer Vorstellung der ersten beiden Theorien, die angesichts des Rahmens der Arbeit sehr knapp ausfällt und besonders die Aspekte hervorhebt, wo sich Vergleichsmöglichkeiten ergeben, wird der Vergleich auf drei Ebenen geführt. Zuerst werden die unterschiedlichen Analyseebenen verglichen, dort zeigen sich grob drei unterschiedliche Ebenen, wobei aber Searle und Esser auch Gemeinsamkeiten aufweisen. Bei der anschließenden Untersuchung des Status von Regeln, ein Kernbegriff in jeder der Theorien, zeigen sich Gemeinsamkeiten zwischen Esser und Lepsius gegenüber Searle. Und in der dritten Ebene, dem Vergleich der Arten der Entstehung von Institutionen, unterscheiden sich insbesondere Searle und Esser gegenüber Lepsius, der dort aus der Analyse ausgeklammert werden muss. Doch Searles und Essers Unterschiede, die erheblich sind, lassen sich in gewisser Weise als komplementär darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hartmut Esser
- Definition von Institutionen
- Funktionen von Institutionen
- Orientierungsfunktion
- Ordnungsfunktion
- Sinnstiftungsfunktion
- Legitimität von Institutionen
- John R. Searle
- Der Hintergrund
- Institutionen als Komplex konstitutiver Regeln
- Funktionszuweisung
- Kollektive Intentionalität
- Konstitutive Regeln
- Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit
- Typen institutioneller Tatsachen
- Vergleich
- Analyseebene
- Der Status von Regeln
- Die Entstehung von Institutionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht drei Theorien über Institutionen, wobei der Fokus auf den Ansätzen von Hartmut Esser und John R. Searle liegt. Ziel ist es, herauszufinden, ob die drei Theorien dasselbe Phänomen untersuchen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf Analyseebenen, den Status von Regeln und die Entstehung von Institutionen zu beleuchten. Der Vergleich mit Rainer M. Lepsius dient als ergänzender Aspekt.
- Vergleich verschiedener institutionentheoretischer Ansätze
- Analyse der unterschiedlichen Analyseebenen der Theorien
- Untersuchung des Stellenwerts von Regeln in den jeweiligen Theorien
- Vergleich der Perspektiven auf die Entstehung von Institutionen
- Bewertung der Komplementarität der Ansätze von Esser und Searle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: einen Vergleich dreier institutionentheoretischer Ansätze (Esser, Searle, Lepsius). Es wird die Forschungsfrage nach der Übereinstimmung der Phänomene formuliert und die Struktur der Arbeit skizziert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vergleich der Ansätze von Esser und Searle gelegt wird, da der Ansatz von Lepsius sich in der Betrachtung des Verhältnisses von Struktur und Handlung unterscheidet. Der Vergleich wird auf drei Ebenen – Analyseebene, Status von Regeln und Entstehung von Institutionen – durchgeführt.
Hartmut Esser: Dieses Kapitel präsentiert Essers institutionentheoretischen Ansatz im Kontext seiner Theorie sozialen Handelns, basierend auf methodologischem Individualismus und der SEU-Theorie rationalen Handelns. Esser definiert Institutionen als Erwartungen über die Einhaltung verbindlich geltender Regeln, wobei die Geltung der Regeln auch über individuelle Regelbefolgung hinausgeht und durch Sanktionen und Legitimität gestützt wird. Die Funktionen von Institutionen werden in Orientierungs-, Ordnungs- und Sinnstiftungsfunktionen unterteilt. Die Ordnungsfunktion wird im Kontext der Kritik am Marktmodell der klassischen Ökonomie und des Coase-Theorems diskutiert, wobei Transaktionskosten als zentrale Herausforderung für die Entstehung und Funktion von Institutionen identifiziert werden.
John R. Searle: Dieses Kapitel beschreibt Searles Theorie der Institutionen. Es wird Searles Konzept von Institutionen als Systeme konstitutiver Regeln erläutert, die soziale Tatsachen schaffen. Der Fokus liegt auf der Funktionszuweisung, kollektiven Intentionalität und der Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit durch konstitutive Regeln. Unterschiedliche Typen institutioneller Tatsachen werden dargestellt. Der Hintergrund und die Bedeutung der konstitutiven Regeln für das Verständnis von Institutionen werden detailliert behandelt.
Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Ansätze von Esser und Searle (und implizit Lepsius) auf den drei Ebenen: Analyseebene, Status von Regeln und Entstehung von Institutionen. Die Unterschiede in den Analyseebenen werden herausgearbeitet, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verständnis des Regelstatus werden diskutiert, und schließlich werden die divergierenden Perspektiven auf die Entstehung von Institutionen kontrastiert. Die Unterschiede zwischen Searle und Esser werden als potenziell komplementär dargestellt.
Schlüsselwörter
Institutionen, methodologischer Individualismus, SEU-Theorie, konstitutive Regeln, kollektive Intentionalität, gesellschaftliche Wirklichkeit, Transaktionskosten, Legitimität, Ordnung, Orientierung, Sinnstiftung, Analyseebenen, Regelstatus, Entstehung von Institutionen, Vergleich institutionentheoretischer Ansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich institutionentheoretischer Ansätze von Esser und Searle
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht drei institutionentheoretische Ansätze, wobei der Schwerpunkt auf den Theorien von Hartmut Esser und John R. Searle liegt. Ein ergänzender Vergleich wird mit Rainer M. Lepsius durchgeführt. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theorien bezüglich Analyseebene, Regelstatus und Entstehung von Institutionen herauszuarbeiten.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die institutionentheoretischen Ansätze von Hartmut Esser, John R. Searle und Rainer M. Lepsius. Der Fokus liegt jedoch auf dem Vergleich zwischen Esser und Searle.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob die drei Theorien dasselbe Phänomen untersuchen und inwiefern sie sich in Bezug auf Analyseebenen, den Status von Regeln und die Entstehung von Institutionen ähneln oder unterscheiden.
Wie definiert Hartmut Esser Institutionen?
Esser definiert Institutionen als Erwartungen über die Einhaltung verbindlich geltender Regeln. Die Geltung dieser Regeln geht über die individuelle Regelbefolgung hinaus und wird durch Sanktionen und Legitimität gestützt. Er unterteilt die Funktionen von Institutionen in Orientierungs-, Ordnungs- und Sinnstiftungsfunktionen.
Wie definiert John R. Searle Institutionen?
Searle beschreibt Institutionen als Systeme konstitutiver Regeln, die soziale Tatsachen schaffen. Zentrale Konzepte sind Funktionszuweisung, kollektive Intentionalität und die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit durch konstitutive Regeln. Er differenziert verschiedene Typen institutioneller Tatsachen.
Welche Ebenen werden im Vergleich der Theorien betrachtet?
Der Vergleich der Ansätze von Esser, Searle und Lepsius erfolgt auf drei Ebenen: Analyseebene, Status von Regeln und Entstehung von Institutionen.
Wie werden die Unterschiede zwischen Esser und Searle dargestellt?
Die Arbeit hebt die Unterschiede in den Analyseebenen, im Verständnis des Regelstatus und in den Perspektiven auf die Entstehung von Institutionen hervor. Die Unterschiede werden jedoch auch als potenziell komplementär dargestellt.
Welche Rolle spielt der Ansatz von Rainer M. Lepsius?
Der Ansatz von Lepsius dient als ergänzender Aspekt im Vergleich. Er unterscheidet sich von den Ansätzen von Esser und Searle in seiner Betrachtung des Verhältnisses von Struktur und Handlung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Institutionen, methodologischer Individualismus, SEU-Theorie, konstitutive Regeln, kollektive Intentionalität, gesellschaftliche Wirklichkeit, Transaktionskosten, Legitimität, Ordnung, Orientierung, Sinnstiftung, Analyseebenen, Regelstatus, Entstehung von Institutionen, Vergleich institutionentheoretischer Ansätze.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Hartmut Esser und John R. Searle, ein Vergleichskapitel und ein Fazit. Jedes Kapitel fasst die jeweilige Theorie zusammen und trägt zum Vergleich bei.
- Arbeit zitieren
- Lars Vogel (Autor:in), 2004, Institutionentheorie bei Hartmut Esser, John R. Searle und Rainer Lepsius im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/34642