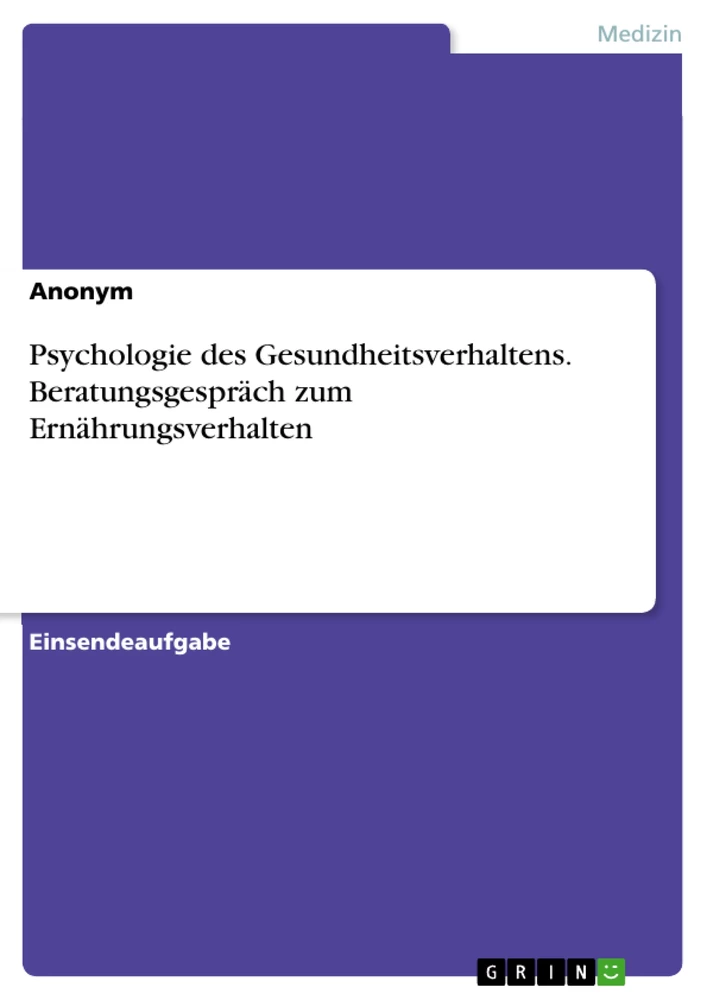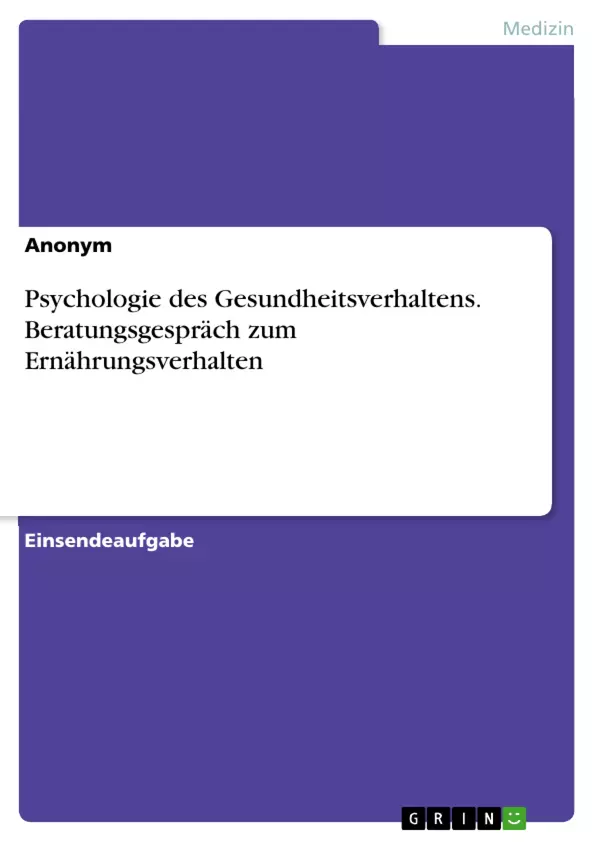In einem Beratungsgespräch spielen viele Faktoren eine Rolle, die entscheidend für den Erfolg des Gesprächs sind. Ein gutes Beratungsgespräch beginnt mit einer sorgfältigen Vorbereitung. Die Vorbereitungsphase, bei der es noch nicht zur persönlichen Kontaktaufnahme mit dem Kunden kommt, macht 50% des Erfolges aus.
Ein Berater muss sich wohlfühlen in seiner Rolle, sich deren bewusst sein. Das bedeutet auch, dass er selbstverständlich ein gepflegtes Erscheinungsbild abgibt: keine fettigen Haare, Schweißgeruch, Mundgeruch. Sauber gepflegte Nägel und Hände. Adrette Kleidung. Ruhiges, souveränes und gewinnendes Auftreten.. So ist der Berater darüber hinaus in der Pflicht, genügend Zeit für den Kunden einzuplanen und die entsprechenden Unterlagen die für das Beratungsgespräch relevant sind bereitzulegen.
Vorab sollten wichtige Informationen über den Kunden z. B. bei einem Telefonat zur Terminvereinbarung notiert werden, um sich auf das Gespräch einstellen zu können. Des Weiteren muss der Berater sich seiner Verantwortung bewusst sein, von der Richtigkeit seiner Arbeit über-zeugt sein und mit Freude den Kunden eine individuelle Problemlösung anbieten können.
Inhaltsverzeichnis
- Selbstwirksamkeitserwartung
- Definition Selbstwirksamkeitserwartung
- Fragebogen zur Selbstwirksamkeitserwartung
- Auswertung der Selbstwirksamkeitserwartung
- Studien im Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeitserwartung
- Ernährungsverhalten
- Beratungsgespräch
- Beschreibung der Kundin
- Wesentliche Aspekte in einem Beratungsgespräch
- Einordnung des Kunden in den Prozess der Verhaltensänderung
- Darstellung des Gesprächsverlaufs
- Reflektion
- Literaturverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung, einem zentralen Aspekt der Lernpsychologie, der die persönliche Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Herausforderungen beschreibt. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieses Konzepts im Bereich des Ernährungsverhaltens und der damit verbundenen Verhaltensänderung.
- Definition und Bedeutung der Selbstwirksamkeitserwartung
- Anwendung des Selbstwirksamkeitserwartungs-Konzepts im Bereich Ernährung
- Analyse von Ernährungsverhalten im Kontext von Selbstwirksamkeit
- Bedeutung von Beratung und Unterstützung bei der Verhaltensänderung
- Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der Veränderung des Ernährungsverhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Definition der Selbstwirksamkeitserwartung und ihre Bedeutung für die Bewältigung von Herausforderungen im Alltag. Es werden verschiedene Aspekte der Selbstwirksamkeitserwartung, wie die Entstehung und die Auswirkungen auf Motivation und Leistung, beleuchtet.
Kapitel zwei widmet sich dem Fragebogen zur Selbstwirksamkeitserwartung und erläutert dessen Anwendung im Bereich Ernährung. Die Auswertung des Fragebogens wird anhand von Beispielen verdeutlicht und die Ergebnisse in Bezug auf die Selbstwirksamkeitserwartung der einzelnen Personen interpretiert.
Im dritten Kapitel wird ein Beratungsgespräch im Kontext von Ernährungsverhalten beschrieben. Hierbei wird die Kundin vorgestellt, die wesentlichen Aspekte des Gesprächs erläutert und die Einordnung der Kundin in den Prozess der Verhaltensänderung betrachtet. Der Gesprächsverlauf wird dargestellt und reflektiert.
Schlüsselwörter
Selbstwirksamkeitserwartung, Kompetenzerwartung, self-efficacy, Ernährungsverhalten, Verhaltensänderung, Beratungsgespräch, Motivation, Leistung, Erfolg, Misserfolg, Fragebogen, Auswertung, Normwerte, Persönlichkeit, Handlungskompetenz, Umweltanforderungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Psychologie des Gesundheitsverhaltens. Beratungsgespräch zum Ernährungsverhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/343760