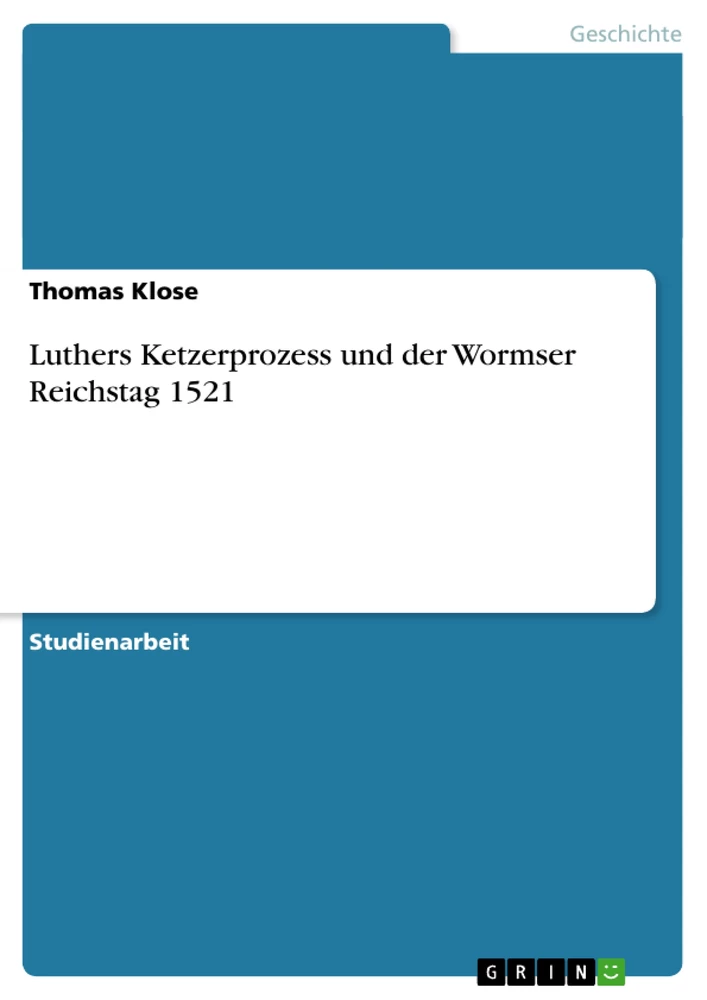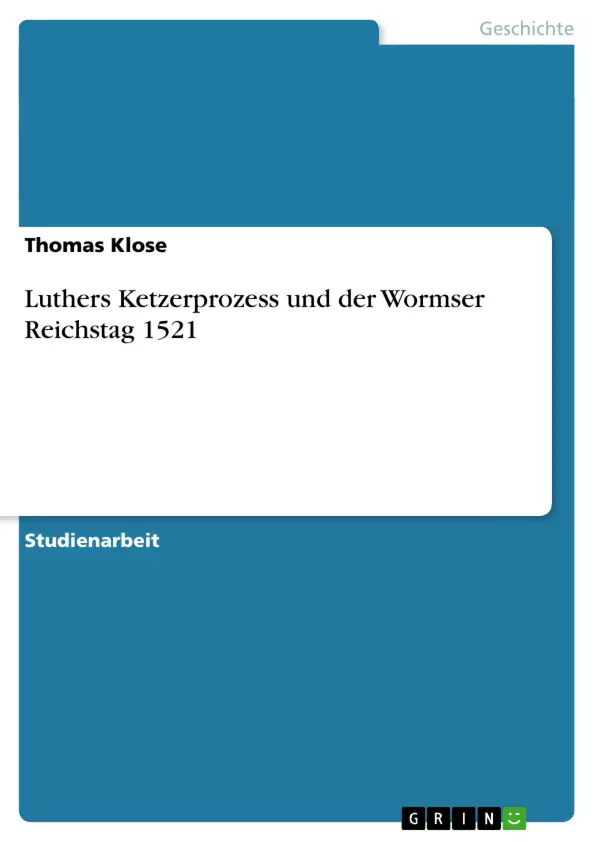Einleitung
Als am 10. November 1482 ein Junge Namens Martin Luder, der sich später Luther nannte, in der kleinen Stadt Eisleben das Licht der Welt erblickte, ahnte wohl noch niemand, dass dieser Junge einmal das gesamte Deutsche Reich in Atem halten würde. Nachdem die Familie Luther 1484 nach Mansfeld zog1, begab er sich mit viereinhalb Jahren auf die Mansfelder Lateinschule, welche er neun Jahre lang besuchen sollte.2 Im Jahr 1501 ging Luther auf Anweisung seines Vaters nach Erfurt, um an der hiesigen Universität zu studieren. 1505 erreichte er den Abschluss des Magisters. Doch er setzte sein Studium nicht fort, sondern begab sich am 17. Juli 1505 in das Erfurter Augustiner-Kloster.3 Im Jahr 1508 wurde Luther als Vertretung für einen erkrankten Dozenten an die Universität in Wittenberg versetzt. Dort blieb er bis ins Jahr 1509 und kehrte dann nach Erfurt zurück.4 1512 verließ Luther Erfurt endgültig und wurde Professor für Theologie in Wittenberg. 5 Hier begann Luther, seine eigene Theologie zu entwickeln, welche mit dem Thesenanschlag vom 31.10.1517 seine vorläufigen Höhepunkt finden sollte. In der nachfolgenden Arbeit möchte ich näher auf den Ketzerprozesses Luthers eingehen. Dieser verläuft von der Reaktion auf den Thesenanschlag über den Augsburger Reichstag bis hin zum Wormser Reichstag mit dem Wormser Edikt im Jahr 1521.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Reaktionen auf Luthers Thesenanschlag
- 3. Luther auf dem Reichstag zu Augsburg
- 4. Luthers Ketzerprozess zwischen dem Reichstag zu Augsburg und dem Reichstag zu Worms
- 5. Luther auf dem Reichstag zu Worms
- 6. Das Wormser Edikt
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ketzerprozess gegen Martin Luther, beginnend mit den Reaktionen auf seinen Thesenanschlag und kulminierend im Wormser Reichstag und dem Wormser Edikt von 1521. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Prozesses und den zentralen Konfliktpunkten zwischen Luther und der katholischen Kirche.
- Die Reaktionen auf Luthers Thesenanschlag und die Einleitung des Ketzereiverfahrens.
- Die Auseinandersetzung Luthers mit Kardinal Cajetan auf dem Augsburger Reichstag.
- Die Argumentation Luthers und seine Weigerung, seine Thesen zu widerrufen.
- Der Verlauf des Prozesses bis zum Wormser Reichstag.
- Die Verkündigung des Wormser Edikts.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Martin Luther kurz vor und beschreibt seinen Weg zum Professor für Theologie in Wittenberg. Sie führt in das Thema der Hausarbeit ein: den Ketzerprozess gegen Luther vom Thesenanschlag bis zum Wormser Edikt.
2. Die Reaktionen auf Luthers Thesenanschlag: Dieses Kapitel beschreibt die unmittelbaren Folgen von Luthers Thesenanschlag. Die brisanten theologischen Aussagen führten zur Einleitung eines Prozesses durch Erzbischof Albrecht von Mainz und zur Information des Papstes. Anfangs wurde Luthers Wirken nur als Ablassbehinderung gesehen, jedoch führte die theologische Auseinandersetzung schließlich zu einem formellen Ketzervorwurf und einer Vorladung nach Rom. Luthers Weigerung, nach Rom zu reisen, und die Intervention des Kurfürsten Friedrich des Weisen ermöglichten schließlich eine Verhandlung auf dem Reichstag zu Augsburg.
3. Luther auf dem Reichstag zu Augsburg: Dieses Kapitel detailliert Luthers Auftritt vor Kardinal Cajetan auf dem Augsburger Reichstag. Der Fokus liegt auf dem zentralen Konfliktpunkt: die Bulle Unigenitus von Clemens VI., die den Ablasshandel legitimierte. Luther widerlegte die Interpretation der Bulle durch Cajetan und bestritt die Unfehlbarkeit des Papstes. Trotz mehrerer Versuche Cajetans, Luther zum Widerruf zu bewegen, blieben die Positionen unversöhnlich, und das Treffen endete ohne Einigung. Die Weigerung Luthers, seine Überzeugung aufzugeben, trotz Androhung des Bannfluchs, wird hervorgehoben.
4. Luthers Ketzerprozess zwischen dem Reichstag zu Augsburg und dem Reichstag zu Worms: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext – hier wäre eine detaillierte Zusammenfassung des Kapitelinhalts aus dem vollständigen Text notwendig)
5. Luther auf dem Reichstag zu Worms: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext – hier wäre eine detaillierte Zusammenfassung des Kapitelinhalts aus dem vollständigen Text notwendig)
6. Das Wormser Edikt: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext – hier wäre eine detaillierte Zusammenfassung des Kapitelinhalts aus dem vollständigen Text notwendig)
Schlüsselwörter
Martin Luther, Thesenanschlag, Ketzerprozess, Ablasshandel, Reichstag zu Augsburg, Reichstag zu Worms, Wormser Edikt, Kardinal Cajetan, Bulle Unigenitus, Reformation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ketzerprozess gegen Martin Luther
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Ketzerprozess gegen Martin Luther, beginnend mit den Reaktionen auf seinen Thesenanschlag und endend mit dem Wormser Reichstag und dem Wormser Edikt von 1521. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Prozesses und den zentralen Konfliktpunkten zwischen Luther und der katholischen Kirche.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Reaktionen auf Luthers Thesenanschlag, die Auseinandersetzung Luthers mit Kardinal Cajetan auf dem Augsburger Reichstag, Luthers Argumentation und seine Weigerung, seine Thesen zu widerrufen, den Prozessverlauf bis zum Wormser Reichstag und die Verkündigung des Wormser Edikts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Reaktionen auf Luthers Thesenanschlag, Luther auf dem Reichstag zu Augsburg, Luthers Ketzerprozess zwischen Augsburg und Worms, Luther auf dem Reichstag zu Worms, Das Wormser Edikt und Fazit. Die Kapitel 4, 5 und 6 enthalten im vorliegenden Auszug keine detaillierte Zusammenfassung.
Was ist in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt Martin Luther kurz vor, beschreibt seinen Weg zum Professor für Theologie in Wittenberg und führt in das Thema der Hausarbeit, den Ketzerprozess gegen Luther vom Thesenanschlag bis zum Wormser Edikt, ein.
Was wird im Kapitel über die Reaktionen auf den Thesenanschlag behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die unmittelbaren Folgen des Thesenanschlags, die Einleitung eines Prozesses durch Erzbischof Albrecht von Mainz, die Information des Papstes, die anfängliche Wahrnehmung Luthers nur als Ablassbehinderung und die Entwicklung zum formellen Ketzervorwurf mit der Vorladung nach Rom. Es wird Luthers Weigerung, nach Rom zu reisen, und die Intervention des Kurfürsten Friedrich des Weisen erwähnt.
Was ist der Kernpunkt des Kapitels über Luthers Auftritt in Augsburg?
Dieses Kapitel detailliert Luthers Auftritt vor Kardinal Cajetan. Der zentrale Konfliktpunkt ist die Bulle Unigenitus von Clemens VI. und deren Interpretation durch Cajetan. Luther widerlegte Cajetans Interpretation, bestritt die Unfehlbarkeit des Papstes und blieb trotz Androhung des Bannfluchs bei seiner Überzeugung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Martin Luther, Thesenanschlag, Ketzerprozess, Ablasshandel, Reichstag zu Augsburg, Reichstag zu Worms, Wormser Edikt, Kardinal Cajetan, Bulle Unigenitus, Reformation.
Welche Informationen fehlen in diesem Auszug?
Detaillierte Zusammenfassungen der Kapitel 4 ("Luthers Ketzerprozess zwischen dem Reichstag zu Augsburg und dem Reichstag zu Worms"), 5 ("Luther auf dem Reichstag zu Worms") und 6 ("Das Wormser Edikt") fehlen im vorliegenden Auszug.
- Arbeit zitieren
- Thomas Klose (Autor:in), 2004, Luthers Ketzerprozess und der Wormser Reichstag 1521, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/34101