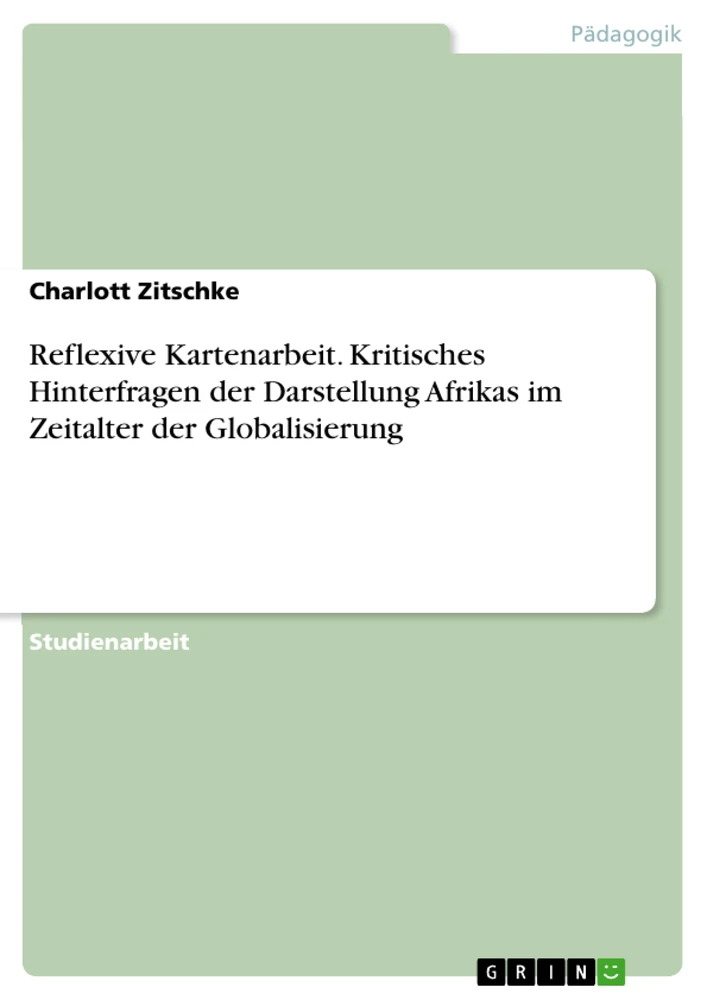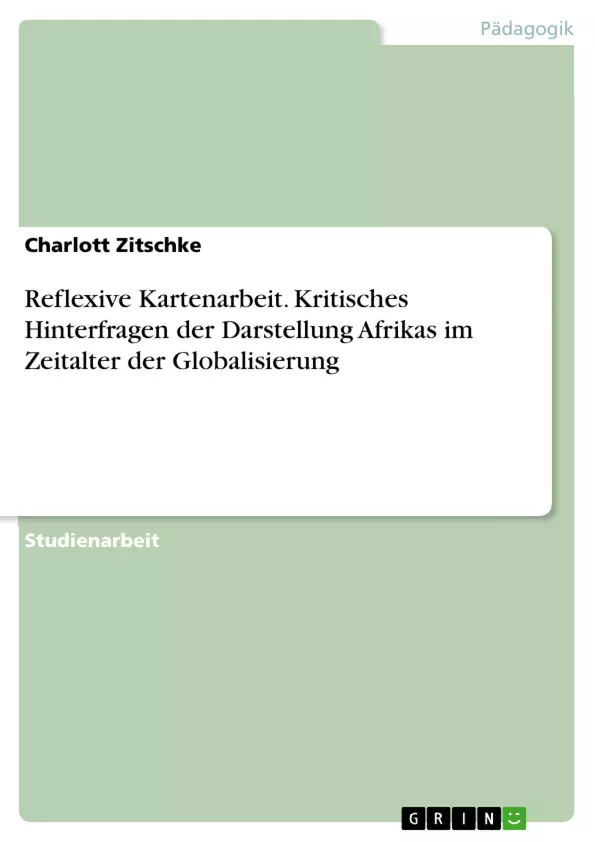Im Folgenden bietet diese vorliegende Seminararbeit einen Einblick, inwiefern, angesichts der fachdidaktischen Pluralität, kritisch mit Karten umgegangen und ein raumzentrierter und kritisch geografischer Zugriff, erlangt werden kann. Es soll aufgezeigt werden, dass es ein wesentliches Bestreben des Geographieunterrichts ist, die Schüler(innen) zu befähigen, Argumentationen auf der Basis von Karten zu vernehmen, kritisch zu hinterfragen und durch Gegenargumente zu entkräften.
Im Rahmen dieser Seminararbeit wird die Kartenarbeit des kritischen Hinterfragens am Beispiel Afrikas im Zeitalter der Globalisierung thematisiert werden. Globales lernen – die Welt zu deuten, zu erfahren und zu verstehen. Der Lebensalltag, inmitten der Globalisierung, ist gekennzeichnet durch Undurchschaubarkeit und Fremdbestimmtheit. Dies erfordert die Auseinandersetzung mit den politischen, sozioökonomischen und kulturellen Vorgängen als gestaltbare Entwicklung.
Ziel ist es, den Kartenvergleich und demzufolge die Karten, als gemachte Präsentationen zu verstehen. Zunächst werden die zu betrachtenden Karten präsentiert. Im Anschluss daran wird in der Sachanalyse, vor dem Hintergrund des Lehrplans sowie der fachlichen und kartographischen Perspektiven, die Auswahl der Karten begründet. Daran anknüpfend folgt die Didaktische Analyse, in der vor dem Hintergrund des kartographischen Zugriffs (raumzentriert und kritisch geografisch), des Vermittlungsinteresses und der didaktischen Prinzipien die Zusammenführung der Methoden und Aufgaben begründet und dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Präsentation der Karten
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Bedeutung von Karten im Geographieunterricht, insbesondere im Kontext des kritischen Hinterfragens und des raumzentrierten, kritisch geographischen Zugriffs. Sie beleuchtet das Konzept des Globalen Lernens und analysiert die Rolle von Karten bei der Auseinandersetzung mit globalen sozioökonomischen und kulturellen Verflechtungen. Ziel ist es, den Kartenvergleich und die Karten selbst als gemachte Präsentationen zu verstehen und Schüler(innen) zu befähigen, Argumentationen auf der Basis von Karten zu vernehmen, kritisch zu hinterfragen und durch Gegenargumente zu entkräften.
- Der Einsatz von Karten im Geographieunterricht
- Die Bedeutung des kritischen Hinterfragens von Karten
- Der raumzentrierte und kritisch geographische Zugang zur Kartenanalyse
- Das Konzept des Globalen Lernens und seine Bedeutung für den Geographieunterricht
- Die Analyse von anamorphotischen Karten ("cartograms") im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Bedeutung von Karten im Geographieunterricht dar und betont die Notwendigkeit des kritischen Hinterfragens von Karten, um ein umfassendes Weltwissen und -verständnis zu erlangen. Sie stellt die Relevanz des Globalen Lernens und die Rolle von Karten bei der Auseinandersetzung mit globalen Verflechtungen heraus.
Das Kapitel "Präsentation der Karten" stellt eine anamorphotische Karte ("cartogram") vor, die das Bruttonationaleinkommen pro Kopf im Jahr 2000 darstellt. Diese Karte veranschaulicht die Bedeutung von Karten als gemachte Präsentationen, die eine bestimmte Perspektive auf die Welt vermitteln. Der Fokus liegt auf der Analyse der "cartogram" als Mittel zur Darstellung globaler Ungleichheiten und als Werkzeug für das kritische Hinterfragen von Daten und deren Interpretation.
Schlüsselwörter
Karten, Geographieunterricht, kritisches Hinterfragen, raumzentrierter Zugriff, globaler Lernprozess, anamorphotische Karten ("cartograms"), Globalisierung, sozioökonomische und kulturelle Verflechtungen, Ungleichheit, Datenanalyse, Interpretation, kritische Analyse.
- Arbeit zitieren
- Charlott Zitschke (Autor:in), 2016, Reflexive Kartenarbeit. Kritisches Hinterfragen der Darstellung Afrikas im Zeitalter der Globalisierung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/340065