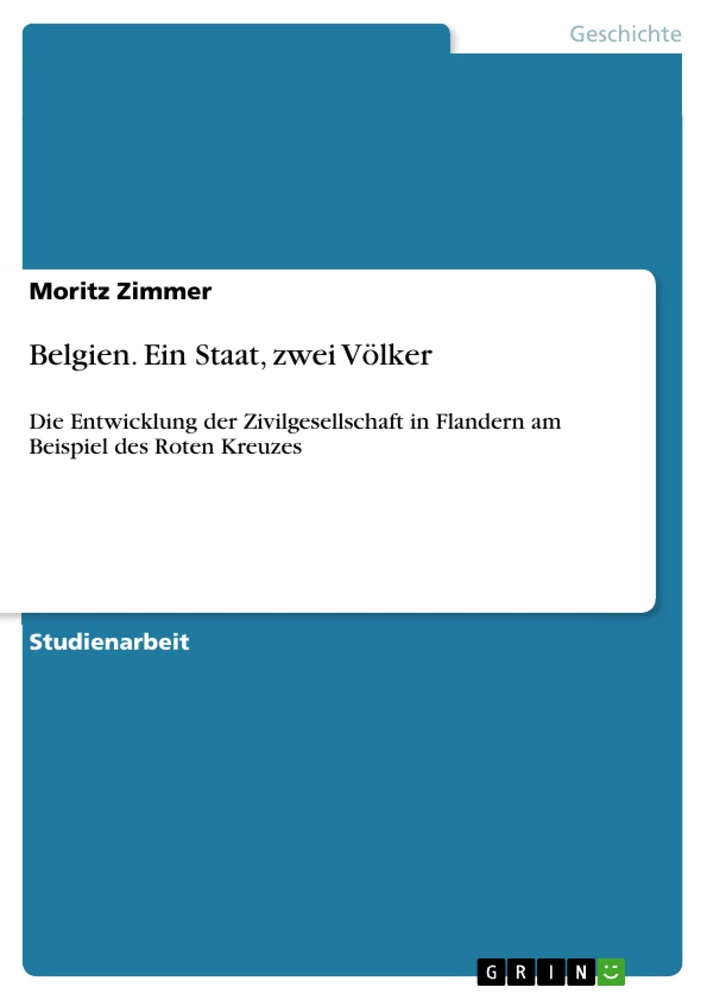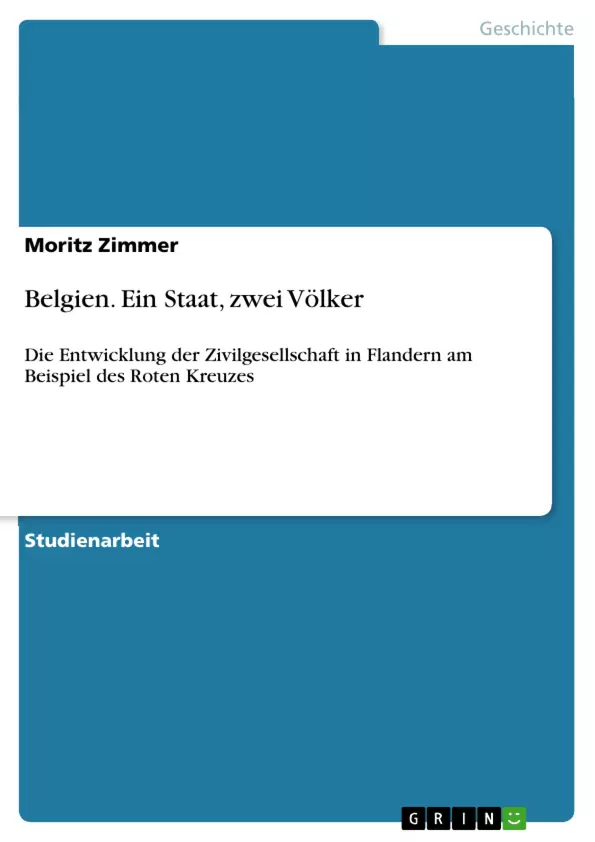Aus deutscher Sicht ist Belgien eines von mehreren kleinen Nachbarländern, das weder als bedrohlich noch als exotisch empfunden wird. Mit seiner Fläche von 30.528 km² ist es in etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen, wohingegen die Bevölkerungszahl mit 11.209.044 Einwohnern deutlich geringer ist. Das Wissen über den Staat, der von vielen nur als Transitland nach Frankreich oder Großbritannien angesehen wird, ist in Deutschland ziemlich gering. Selbst das Deutsch neben Niederländisch und Französisch die dritte Amtssprache ist, wissen wohl die wenigsten Deutschen.
Auch wenn Belgien für den deutschen Betrachter ein eher unscheinbares Nachbarland ist, so ist es doch ein äußerst kompliziertes politisches und gesellschaftliches Gebilde, das vor allem durch seine inneren Gegensätze dazu herausfordert, sich näher mit ihm zu befassen. Das Zusammenleben der niederländisch sprachigen Flamen mit dem französischsprachigen Wallonen birgt seit Gründung des belgischen Staates im Jahr 1830 reichlich Konfliktpotential und ist Ursache für beinahe jeden innerstaatlichen Konflikt. Zwar ist die Mehrsprachigkeit in einem Land kein belgisches Unikat und ist auch in anderen Industrienationen wie etwa der Schweiz oder Kanada anzutreffen. Dort wurde jedoch bereits während der Nationalitätsbildung ein föderalistisches Regierungssystem errichtet, um keine der Sprachgruppen zu diskriminieren. Weil diese Maßnahme bei der Gründung Belgiens ausblieb, entwickelten sich die Gegensätze zwischen Flamen und Wallonen zu einem folgenreichen Problem für den Staat und sein Regierungssystem.
Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen der sprachlichen Gegensätze der Landesteile auf die belgische Gesellschaft. Der Autor stellt die These auf, dass der Sprachenstreit dafür verantwortlich ist, dass keine belgische, sondern sowohl eine flämische als auch eine wallonische Zivilgesellschaft innerhalb Belgiens existiert, die zwar auf administrativen Wegen miteinander kooperieren, sich jedoch nicht näher als Zivilgesellschaften zweier (angrenzender) Länder sind. Bei der Arbeit handelt es sich um eine im Ansatz theoriegeleitete Untersuchung zum Verständnis dieses wichtigen Aspekts des belgischen politischen Systems, die durch historische Argumente gestützt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zivilgesellschaft in einer gespaltenen Gesellschaft
- Geschichte des flämisch-wallonischen Konflikts
- Die föderale Struktur Belgiens
- Die Zivilgesellschaft in einer gespaltenen Gesellschaft am Beispiel des Flämischen Roten Kreuzes
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der sprachlichen Gegensätze in Belgien auf die belgische Gesellschaft und argumentiert, dass diese für die Existenz einer flämischen und wallonischen, aber nicht einer gesamtstaatlichen belgischen Zivilgesellschaft verantwortlich sind. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Belgien aufgrund der sprachlichen, kulturellen und historischen Umstände ein Beispiel für eine gespaltene Gesellschaft ist.
- Definition von Zivilgesellschaft in gespaltenen Gesellschaften
- Historische Entwicklung des flämisch-wallonischen Konflikts
- Rolle von politischen Mythen in der Identitätsbildung der Flamen
- Institutionelle Berücksichtigung der Gegensätze in Belgien
- Analyse der gespaltenen Zivilgesellschaft anhand des Beispiels des Rode Kruis Vlaanderen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die These der Arbeit vor, dass aufgrund der sprachlichen Gegensätze keine belgische, sondern eine flämische und wallonische Zivilgesellschaft existiert. Sie formuliert drei zentrale Forschungsfragen und skizziert die Gliederung der Arbeit.
- Zivilgesellschaft in einer gespaltenen Gesellschaft: Dieses Kapitel definiert den Analyserahmen für die Betrachtung von Zivilgesellschaften in gespaltenen Gesellschaften und entwickelt eine theoretische Hypothese, die auf der Definition von Wolfgang Merkel und Hans-Joachim Lauth basiert.
- Geschichte des flämisch-wallonischen Konflikts: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des flämisch-wallonischen Konflikts bis 1970, wobei der Fokus auf dem 19. und 20. Jahrhundert liegt. Es untersucht die Entstehung von sozialen und kulturellen Strukturen, die Belgien noch heute prägen, und beantwortet die Frage nach dem Einfluss von politischen Mythen auf das Nationalbewusstsein der Flamen.
- Die föderale Struktur Belgiens: Dieses Kapitel analysiert die fünf Staatsreformen in Belgien (1970, 1980, 1988/1989, 1993 und 2001-2003), die Belgien zum föderalistischsten Staat Europas machten. Es untersucht, inwieweit die sprachlichen, kulturellen und historischen Gegensätze in der Staatsstruktur Berücksichtigung finden.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit der Zivilgesellschaft in Belgien, insbesondere mit den Auswirkungen des flämisch-wallonischen Konflikts auf die gesellschaftliche Entwicklung. Die Kernthemen sind Sprachkonflikte, Identitätsbildung, Nationalbewusstsein, Föderalismus, Zivilgesellschaft und gespaltene Gesellschaften. Die Untersuchung stützt sich auf die Werke von Wolfgang Merkel, Hans-Joachim Lauth, Johannes Koll, Yves Manhès, Sophie de Schaepdrijver, Horst Siegemund und Claus Hecking.
- Arbeit zitieren
- Moritz Zimmer (Autor:in), 2016, Belgien. Ein Staat, zwei Völker, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/338811