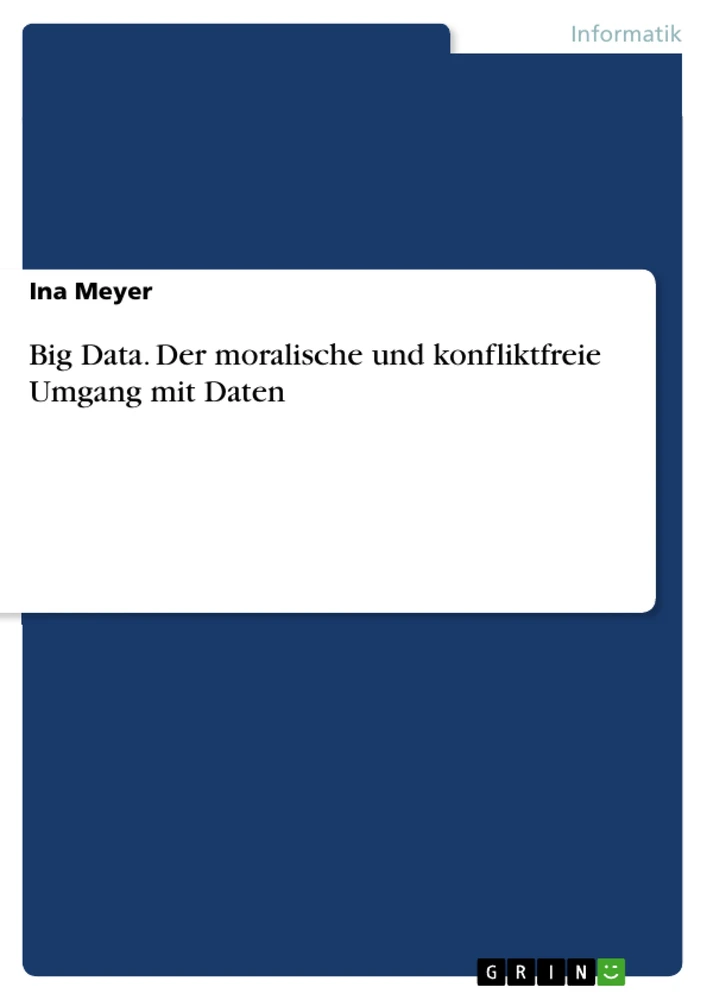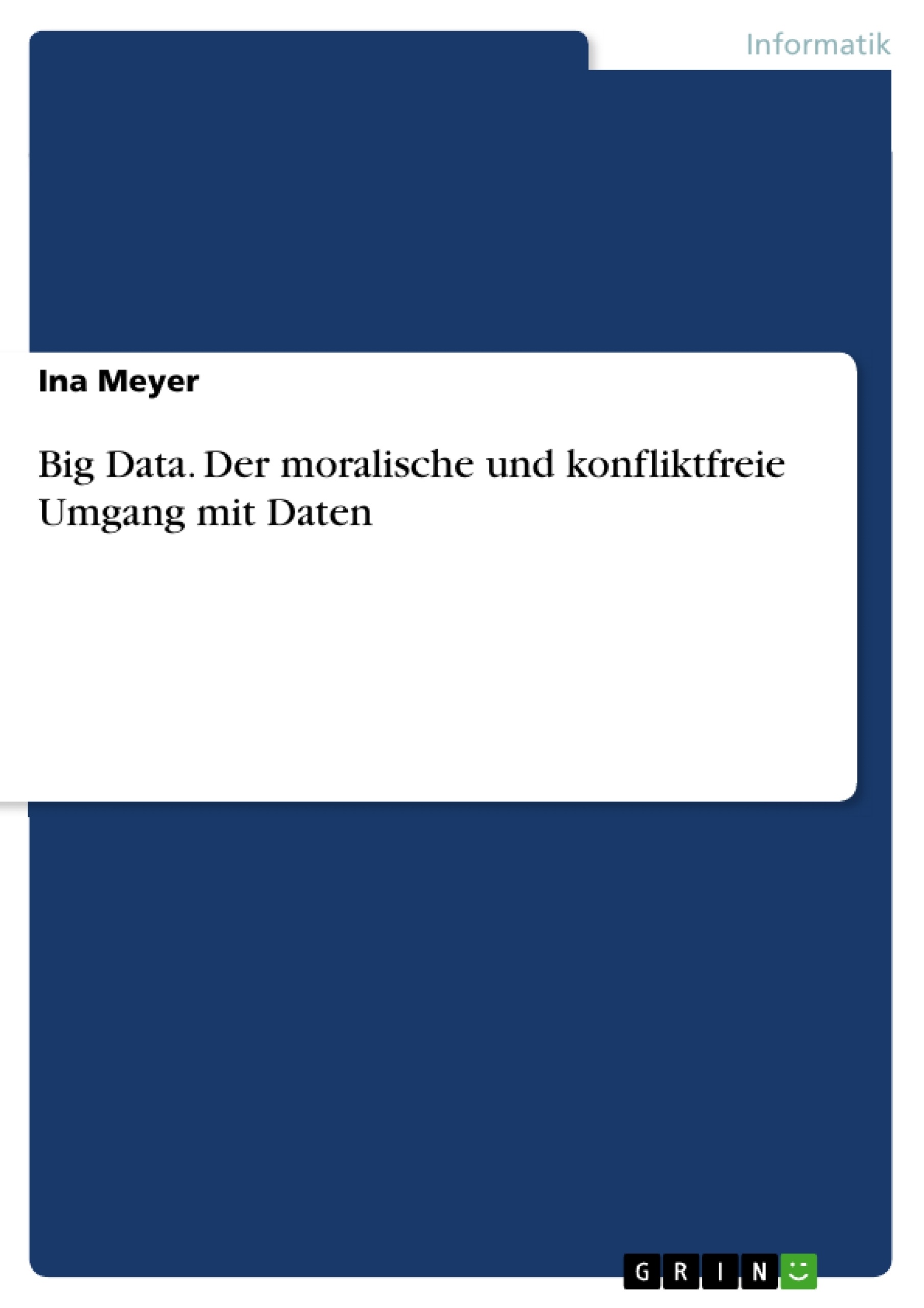„Big Data“ ermöglicht es den Menschen mit höherer fachlicher Kompetenz, Entscheidungen so einfach und qualifiziert wie möglich zu treffen. Das menschliche Gehirn ist eine sehr gute Maschine, aber es ist sehr schlecht darin, aus Milliarden von aufeinander aufbauenden oder unabhängigen Faktoren und Ereignissen eine qualifizierte Entscheidung abzuleiten. Denn die linke Hirnhälfte ist nun mal langsam und rechnet sequentiell. Computer sind wiederum anders. Sie können nur mit sehr großer Mühe unabhängige visuelle und akustische Faktoren parallel zu einem inneren Bild verarbeiten, wie es das menschliche Gehirn in der rechten Hälfte tut. Dafür kann aber der Computer sehr schnell und fehlerfrei logische Ketten mit unzähligen Faktoren durchrechnen. Allein dem Computer das Treffen von qualifizierten und weitreichenden Entscheidungen zu überlassen, ist mehr als kritisch.“
„Big Data“ ist also die Informations- und Technologiegrundlage für die Empfehlungssysteme bzw. Entscheidungsunterstützungssysteme. Die Technologie, also das „Womit?“, ist dabei vorerst nicht relevant. Zuerst stellt sich die Frage nach dem „Was?“ in irgendwelchen Daten, die Sie bereits haben oder erst benötigen. Wenn man weiß, „was“ man wissen will, kommt das „Wie?“, das aus der analytischen bzw. generell wissenschaftlichen Perspektive heraus hilft, das „Was?“ zu beantworten. Und das „Womit?“ ergibt sich dann automatisch, weil technische Unterstützungen dafür benötigen werden.
Was das „Big Data“ so spannend und nützlich macht, ist die Möglichkeit, die Computerfähigkeiten mit dem menschlichen Gehirn zu kombinieren. Der Computer errechnet aus Milliarden von Faktoren ein paar Entscheidungsoptionen – und das immer und immer wieder, und der Mensch trifft die finale Entscheidung mit all seiner Intuition, dem Situationsgefühl und seiner Erfahrung. Genau dieser Punkt macht das Thema so interessant, dass es in diesem Assignment behandeln wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Allgemeines
- Der Begriff Big Data
- Merkmale von Big Data
- Moralische Sicht
- Datenschutzrechtliche Sicht
- Gesetzmäßigkeiten
- Die Akteure
- Allgemeines
- Die Verantwortung der Akteure
- Die Werte der Akteure
- Die Konflikte der Akteure
- Handlungsalternativen und deren Folgen für die Akteure
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Implikationen von Big Data in Bezug auf die Identifizierung von Personen im Internet zu analysieren. Sie untersucht die moralischen und datenschutzrechtlichen Herausforderungen, die sich aus der Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen ergeben, und beleuchtet die Rolle der Akteure in diesem Szenario.
- Die Herausforderungen von Big Data in Bezug auf Moral und Datenschutz
- Die Identifizierung von Personen im Internet durch Big Data
- Die verschiedenen Akteure im Big Data-Ökosystem und deren Verantwortung
- Die Werte, die die Akteure vertreten, und die daraus resultierenden Konflikte
- Handlungsalternativen für den Umgang mit Big Data und deren Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Das Kapitel stellt das Thema Big Data und dessen Bedeutung für die Entscheidungsfindung vor.
- Allgemeines: Dieses Kapitel beleuchtet die rasante Zunahme an Daten und deren Relevanz für die Gesellschaft und die Wirtschaft.
- Der Begriff Big Data: Das Kapitel definiert den Begriff Big Data, analysiert seine Merkmale und stellt verschiedene Definitionen von Big Data vor.
- Moralische Sicht: Dieses Kapitel beleuchtet die ethischen und moralischen Implikationen von Big Data in Bezug auf die Privatsphäre und den informationellen Machtmissbrauch.
- Datenschutzrechtliche Sicht: Das Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Big Data und den Schutz personenbezogener Daten.
- Die Akteure: Dieses Kapitel identifiziert und beschreibt die verschiedenen Akteure im Big Data-Ökosystem, darunter Datensammler, Technologiehersteller, Spezialisten, Datenaggregateure, Datenwissenschaftler, Datennutzer, Personen, die Daten bereitstellen, Daten-Infomediäre, Broker, Regulatoren und Datenschutzbeauftragte.
- Die Verantwortung der Akteure: Das Kapitel untersucht die spezifischen Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure im Bereich Big Data, insbesondere in Bezug auf Datenschutz, Datensicherheit und Urheberrechte.
- Die Werte der Akteure: Dieses Kapitel befasst sich mit den Werten, die die Akteure im Big Data-Ökosystem vertreten, wie z. B. Akzeptanz, Authentizität, Effizienz, Genauigkeit, Glaubwürdigkeit, Weitsicht, Transparenz, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung.
- Die Konflikte der Akteure: Dieses Kapitel diskutiert die Konflikte, die sich zwischen den Akteuren im Zusammenhang mit Big Data ergeben, beispielsweise in Bezug auf Datenschutz, Transparenz, und den potenziellen Missbrauch von Daten.
- Handlungsalternativen und deren Folgen für die Akteure: Das Kapitel analysiert verschiedene Handlungsalternativen für den Umgang mit Big Data, wie z. B. Transparenz, Datensparsamkeit, der Ausbau der gesetzlichen Regelungen, Datenqualität und Sampling.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Big Data, insbesondere mit den Herausforderungen, die sich aus der Erhebung und Verarbeitung von Daten im Internet ergeben. Dabei spielen die Themen Datenschutz, Privatsphäre, Moral, Recht, Identifizierung, Akteure, Verantwortung, Werte, Konflikte und Handlungsalternativen eine zentrale Rolle.
- Arbeit zitieren
- Ina Meyer (Autor:in), 2016, Big Data. Der moralische und konfliktfreie Umgang mit Daten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/335761