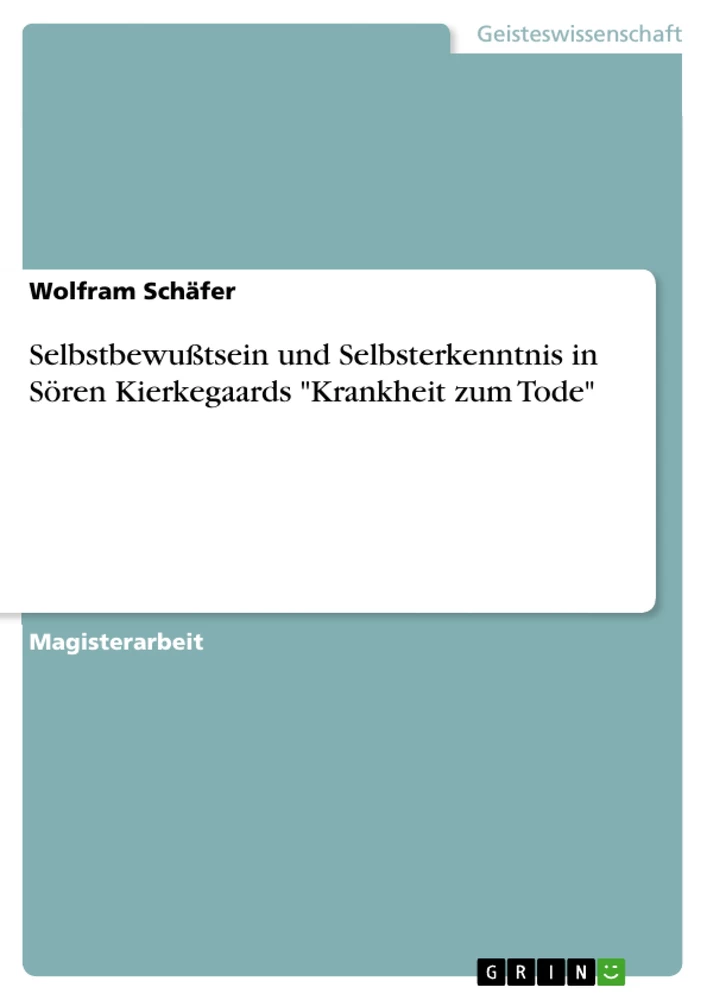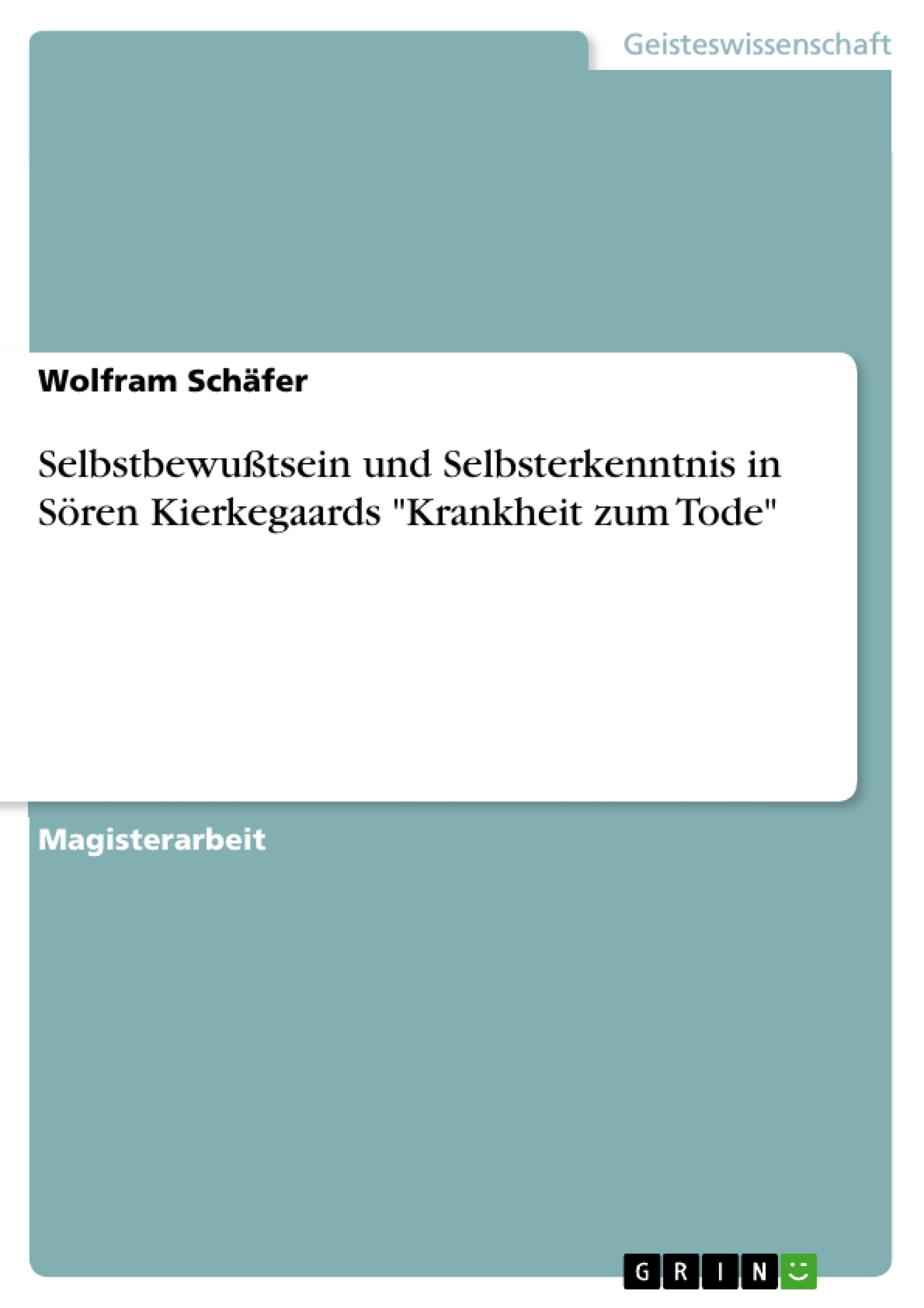"Die Krankheit zum Tode" (1849) gilt nicht nur dem Autor als der Höhepunkt des literarischen Schaffens Sören Kierkegaards, sondern es ist das Hauptwerk des dänischen Philosophen und Theologen, in dem sich das Grundanliegen seiner Existenzphilosophie wiederfindet.
Dieses Werk wird für den Leser/die Leserin umso verständlicher als W. Schäfer andere Hauptwerke Kierkegaards heranzieht, um dieses komplexe Werk überhaupt erst mit Hilfe des Gesamtwerkes durchsichtig zu machen.
"Die Krankheit zum Tode" gilt als schwierig, gerade auch hinsichtlich der an Hegel erinnernden Sprache zu Anfang des Werkes.
W. Schäfer, der Anti-Climacus' theologische Anthropologie umfassend darlegt, erläutert klar, was es mit dem "Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält", auf sich hat.
Die verschiedenen Verzweiflungsformen werden von W. Schäfer deutlich dargestellt und differenziert, so dass auch die sogenannte "unbewusste Verzweiflung" nach Anti-Climacus mit seiner theologischen Anthroplogie erläutert werden kann (M. Theunissen hat in seinem Werk "Der Begriff Verzweiflung: Korrekturen an Kierkegaard", 1993, die unbewußte Verzweiflung lediglich als die "unangemessene Form der Verzweiflung" darstellen können. W. Schäfer erklärt hingegen die unbewußte Verzweiflung mit Hilfe von Anti-Climacus' anthropologischen Überlegungen: vgl. II 2.).
Im dritten und letzten Kapitel gibt es nicht nur einen Exkurs zum Sündenbegriff bei Haufniensis ("Der Begriff Angst", 1844) im Vergleich zu Anti-Climacus' Verzweiflungsbegriff und seiner Sündenabhandlung, sondern Anti-Climacus' Sündenbegriff wird zunächst einmal von seinen Vorstellungen hinsichtlich der Verzweiflung unterschieden.
Eine abschließende Kritik darf der Leser/die Leserin in der Schlußbetrachtung erwarten, wobei hier weitere Aspekte aufgenommen werden, insofern sie nicht Teil der Hauptanalyse sind.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- I. Anti-Climacus' theologische Anthropologie: Selbstverhältnis und Gottesverhältnis
- 1. Vom selbstlosen zum selbstbewußten Dasein menschlicher Existenz
- 2. Im Bewußtsein der Unwahrheit: Paradoxer Glaube - Paradoxe Existenz?
- 3. Exkurs: "Verzweifelt nicht man selbst sein wollen - verzweifelt man selbst sein wollen": Anti-Climacus' gescheiterte Begründung eines gottgesetzten Selbst und Kierkegaards Bruch mit Schelling
- 4. Bewußtes Sein im Bewußtsein der Zeit
- 5. Kurze Zusammenfassung: Über Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis in Anti-Climacus' theologischer Anthropologie
- Über das Unvermögen der Selbsterkenntnis und das mangelnde Selbstbewußtsein in der Verzweiflung: Die Bewußtseinsstufen und die Formen der Verzweiflung
- 1. Vom Ursprung und der Aufhebung der Verzweiflung
- 2. Die Reise von der unbewußten zur bewußten Verzweiflung
- 3. Von der unbewußten Verzweiflung als unmittelbare Leib-Seele Einheit
- 4. "Verzweifelt nicht man selbst sein wollen": Die Verzweiflung der Schwachheit
- 5. "Verzweifelt man selbst sein wollen": Die Verzweiflung der Möglichkeit und die des Trotzes
- 6. Betrachtung zur Unterscheidung der Bewußtseinsstufen und den Formen der Verzweiflung
- 7. Kurze Zusammenfassung zum Selbstbewußtsein und zur Selbsterkenntnis in der Verzweiflung
- III. Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis hinsichtlich des Sündenbegriffes in Anti-Climacus' Krankheit zum Tode
- 1. Allgemeine Begriffsbestimmung der Sünde in der Krankheit zum Tode
- 2. Die Steigerung der Sünde, die eine Position ist:: "Verschlossenheit" und "Ärgernis"
- 3. Der erdichtete Gott: Von dem Gottesverhältnis, das nicht zur Selbsterkenntnis führen kann
- 4. "Verstehen und Verstehen": Subjektivität ist Wahrheit
- 5. Exkurs: Haufniensis' Sündenbegriff unter Berücksichtung des Verzweiflungsbegriffes und der Sündenabhandlung in Anti-Climacus' Die Krankheit zum Tode
- 6. Abschließende Betrachtung: Über Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis in der Sünde
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Konzepte von Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis in Sören Kierkegaards "Krankheit zum Tode" zu analysieren. Sie untersucht, wie Kierkegaard diese Konzepte im Kontext seiner theologischen Anthropologie verwendet und wie sie sich in der Auseinandersetzung mit dem Problem der Verzweiflung und der Sünde manifestieren.
- Kierkegaards theologische Anthropologie
- Die Rolle des Selbstbewußtseins und der Selbsterkenntnis in der Verzweiflung
- Der Sündenbegriff in der "Krankheit zum Tode"
- Das Paradox des Glaubens und die Existenz
- Die Bedeutung von Zeit und Bewusstsein
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Anti-Climacus' theologische Anthropologie: Dieses Kapitel befasst sich mit Kierkegaards Konzept der "theologischen Anthropologie", das im Werk "Krankheit zum Tode" durch die Figur des Anti-Climacus dargestellt wird. Der Fokus liegt auf dem Selbstverhältnis und dem Gottesverhältnis des Menschen. Insbesondere wird die Entwicklung vom selbstlosen zum selbstbewußten Dasein analysiert.
- Kapitel II: Über das Unvermögen der Selbsterkenntnis: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Formen der Verzweiflung, die mit dem Unvermögen der Selbsterkenntnis einhergehen. Es wird die Reise von der unbewußten zur bewußten Verzweiflung nachvollzogen und die unterschiedlichen Bewußtseinsstufen und ihre Auswirkungen auf das Selbstbewußtsein beleuchtet.
- Kapitel III: Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis in der Sünde: Dieses Kapitel analysiert den Sündenbegriff in der "Krankheit zum Tode" und untersucht die Beziehung zwischen Sünde, Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis. Es wird gezeigt, wie die Sünde zu einer "Verschlossenheit" gegenüber dem Selbst und Gott führt und wie das Gottesverhältnis des Menschen die Selbsterkenntnis beeinflussen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Philosophie Kierkegaards, darunter Selbstbewußtsein, Selbsterkenntnis, Verzweiflung, Sünde, Gottesverhältnis, Paradox, Zeit, Existenz, theologische Anthropologie, "Krankheit zum Tode" und Anti-Climacus. Diese Begriffe dienen als Leitfaden für die Analyse und Interpretation des Werks.
- Arbeit zitieren
- Wolfram Schäfer (Autor:in), 1995, Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis in Sören Kierkegaards "Krankheit zum Tode", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/33541