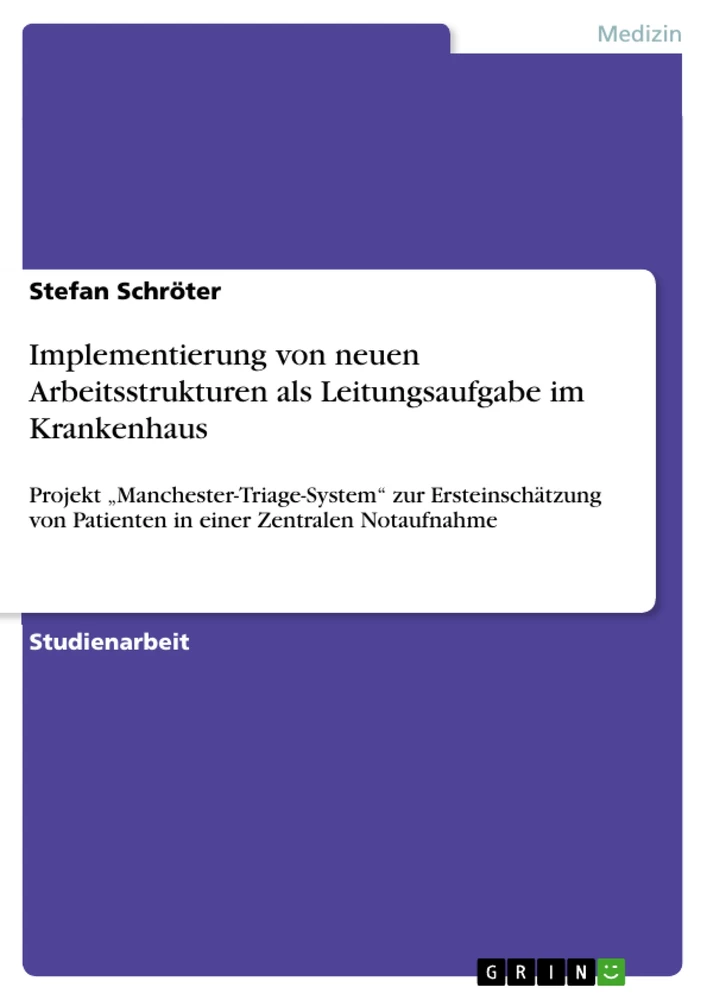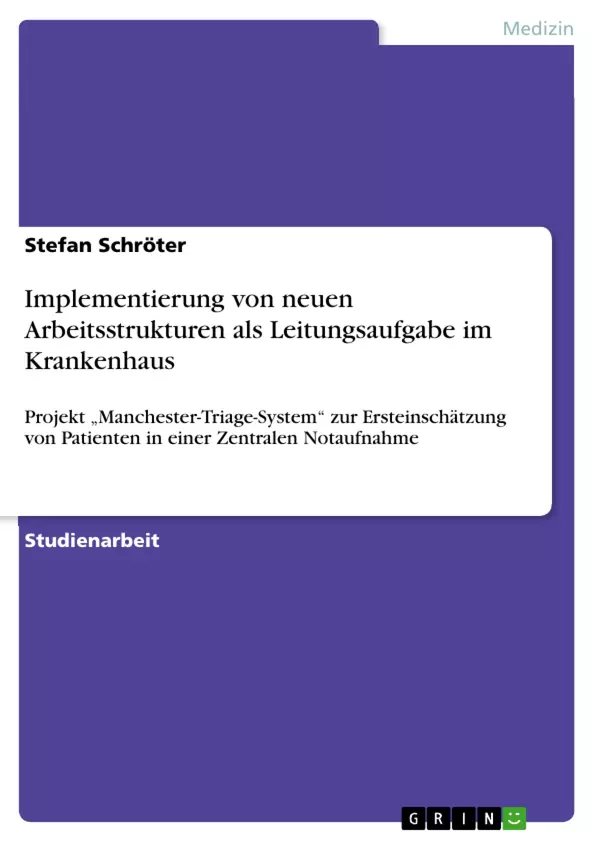Die Patienten- und Behandlungszahlen deutscher Krankenhäuser steigen ständig an. In den Jahren 2005 bis 2012 kam es zu einer Zunahme von 16.071.846 auf 17.976.447 vollstationärer Patienten. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der prozentuale Anteil der als Notfall aufzunehmenden Patienten von 33,7% auf 41,5%. Außerhalb der Öffnungszeiten von niedergelassenen Ärzten konzertiert sich die Notfallversorgung auf die Krankenhäuser. Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e.V. (DGINA) gibt an, dass mindestens 20 Mio. Notfallpatienten jährlich in deutschen Krankenhäusern stationär und ambulant versorgt werden. Durch weitere gesellschaftliche Rahmenbedingungen und neue strukturelle Maßnahmen der letzten Jahre, wie dem demografischen Wandel, der Einführung eines neuen Abrechnungssystems (DRG) und der Entwicklung in der ambulanten Versorgung, kommt es zu einer Steigerung der Anforderungen an die Organisation Zentraler Notaufnahmen (ZNA), da diese die erste Anlaufstelle für mehr als 50 Prozent der stationären Patienten darstellt und dadurch oft als Aushängeschild eines Krankenhauses betrachtet wird.
Durch notwendige Umstrukturierungen und die Zusammenlegung der chirurgischen und internistischen Notaufnahmeeinheiten kam es 2012 zur Zentralisierung und Bündelung des Patientenaufkommens in eine gemeinsame ZNA. Die Patientenzahlen stiegen in dieser Einheit fast übergangslos beträchtlich an. Im Jahr 2011 waren es noch 10000 Kontakte mit Patienten, im Folgejahr schon 17000. Seitdem ist ein weiterer kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Eine Dringlichkeitseinschätzung der Patienten erfolgt durch die erstaufnehmende Pflegefachkraft. Dieser Einschätzung liegt bisher kein strukturierter Standard zugrunde. Vielmehr beruht sie auf den Erfahrungswerten der jeweiligen Pflegefachkraft und den Informationen, die durch den Rettungsdienst sowie die Patienten selbst und deren Angehörige zu erheben sind.
Durch die Notwendigkeit einer einheitlichen und qualitativen Ersteinschätzung, besonders für Patienten mit akuten Krankheitsbildern, ergibt sich für mich die Wahl des Themas der Facharbeit. Sie beschreibt das Führungsinstrument Projektmanagement (PM) und dessen heutige Bedeutung, um neue Prozesse in bestehende Systeme implementieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Projektmanagement
- 2.1 Wie definiert sich Projektmanagement?
- 2.2 Vorteile der Anwendung des Projektmanagements
- 2.3 Projektentstehung und Ausgangssituation
- 2.4 Der Projektauftrag
- 3. Projektplanung und -phasen
- 3.1 Die Projektstrukturplanung
- 3.2 Projektablaufplanung und Terminplanung
- 3.3 Kosten- und Ressourcenplanung
- 3.4 Risikoanalyse und Überwachung des Projekts
- 3.5 Durchführung des Projekts
- 3.6 Abschluss des Projekts
- 4. Der Projektleiter
- 5. Ersteinschätzung durch MTS am Klinikum XXX
- 5.1 Die Zentrale Notaufnahme am Klinikum XXX
- 5.2 Derzeitiger Prozessablauf
- 5.3 Triage und Ersteinschätzung
- 5.3.1 Geschichtliche Entwicklung und Systemvergleich
- 5.3.2 Verfahrensgrundlagen
- 5.4 Implementierung des MTS als Projekt
- 5.4.1 Initiierung und Zielsetzung
- 5.4.2 Benennung des Projektleiters
- 5.4.3 Zusammenstellung der Projektgruppe
- 5.4.4 Planung mittels PDCA-Zyklus
- 5.4.5 Kostenberechnung
- 5.4.6 Schulungsphase
- 5.5 Prozesseinbindung in die ZNA
- 5.5.1 Veränderungen der vorhandenen Strukturen
- 5.5.2 Organisatorische Änderungen
- 5.5.3 Personelle Voraussetzungen
- 6. Die Rolle der FLP
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit befasst sich mit der Implementierung des Manchester-Triage-Systems (MTS) als neues Ersteinschätzungssystem in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) eines Klinikums. Die Arbeit analysiert die Notwendigkeit und Vorteile der Anwendung des Projektmanagements in diesem Kontext. Darüber hinaus beleuchtet sie den Prozess der Implementierung, die Rolle des Projektleiters und die Bedeutung der Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege (FLP).
- Implementierung eines neuen Ersteinschätzungssystems in der ZNA
- Anwendung des Projektmanagements im Gesundheitswesen
- Rolle des Projektleiters bei der Implementierung
- Bedeutung der FLP im Kontext des Projekts
- Analyse und Vergleich verschiedener Ersteinschätzungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Facharbeit ein und erläutert die Relevanz des Projekts "Manchester-Triage-System" für die ZNA. Kapitel 2 behandelt das Projektmanagement und definiert dessen Kernelemente. Es wird die Bedeutung und die Vorteile des Projektmanagements für die Implementierung eines neuen Ersteinschätzungssystems in der ZNA herausgestellt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Projektplanung und den verschiedenen Phasen des Projekts. Es werden die Projektstrukturplanung, die Terminplanung, die Kosten- und Ressourcenplanung sowie die Risikoanalyse und Überwachung des Projekts erläutert. In Kapitel 4 wird die Rolle des Projektleiters bei der erfolgreichen Implementierung des MTS beleuchtet.
Kapitel 5 widmet sich der Ersteinschätzung durch MTS am Klinikum XXX. Es werden die Struktur der ZNA, der derzeitige Prozessablauf und die Triage und Ersteinschätzung im Detail beschrieben. Der Vergleich mit anderen Ersteinschätzungssystemen und die Verfahrensgrundlagen werden ebenfalls diskutiert. Kapitel 5.4 behandelt die Implementierung des MTS als Projekt. Hier werden die Initiierung und Zielsetzung, die Benennung des Projektleiters, die Zusammenstellung der Projektgruppe, die Planung mittels PDCA-Zyklus, die Kostenberechnung und die Schulungsphase analysiert. Die Prozesseinbindung in die ZNA wird in Kapitel 5.5 beleuchtet, wobei die Veränderungen der vorhandenen Strukturen, organisatorische Änderungen und personelle Voraussetzungen im Fokus stehen. Kapitel 6 diskutiert die Rolle der FLP im Kontext des Projekts und ihr Beitrag zur erfolgreichen Implementierung des MTS.
Schlüsselwörter
Projektmanagement, Ersteinschätzung, Manchester-Triage-System (MTS), Zentrale Notaufnahme (ZNA), Triage, Implementierung, Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege (FLP), PDCA-Zyklus, Kostenberechnung, Schulung, Prozessintegration, organisatorische Veränderungen, Personelle Voraussetzungen.
- Quote paper
- Stefan Schröter (Author), 2016, Implementierung von neuen Arbeitsstrukturen als Leitungsaufgabe im Krankenhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/334869