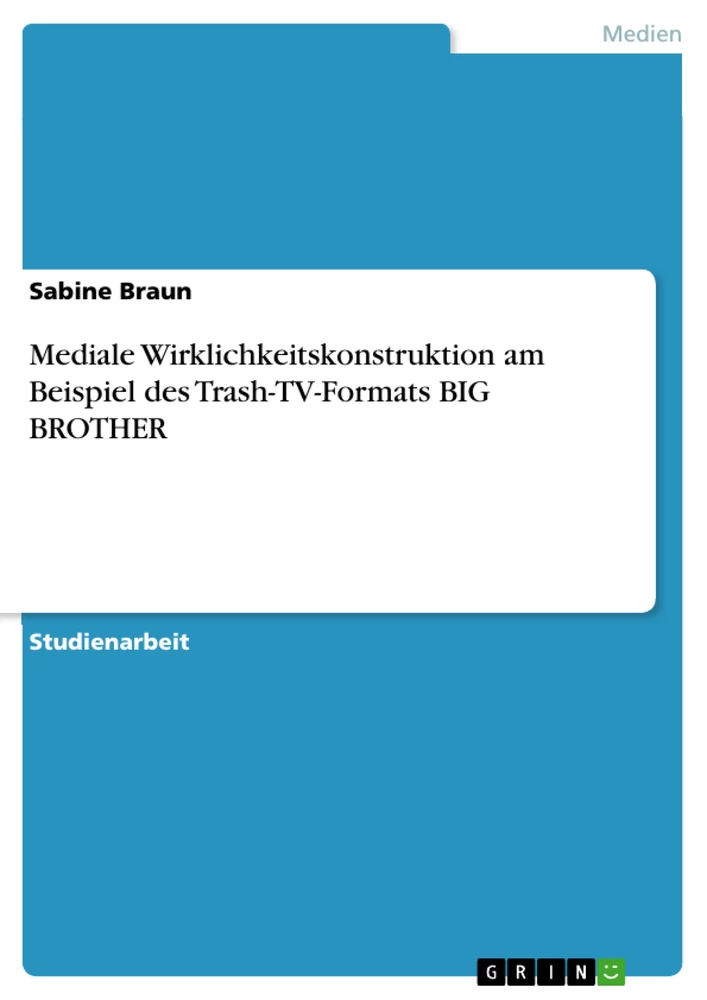Im heutigen so genannten „Medienzeitalter“ wird die für den Einzelnen erfahrbare Welt ständig komplexer und vielfältiger. Die individuelle Aneignung von Welt, sprich das Sammeln von Erfahrungen, geschieht zunehmend indirekt über mediale Vermittlungsinstanzen, allen voran das Fernsehen. Dadurch entsteht bei regelmäßigen Mediennutzern ein zum größten Teil auf Sekundärwissen basierendes Weltbild. Man erlebt nicht mehr selbst hautnah, sondern holt sich via TV- oder PC-Screen die Welt nach Hause. Medienvermitteltes Weltwissen entsteht in zwei Etappen: Im ersten Schritt wird Realität in Medienrealität überführt und im zweiten Schritt fließt diese Medienrealität in das subjektive Weltwissen des Publikums ein, sodass Mediennutzern letztlich nur ein Abbild des Abbilds der Realität zugänglich ist. Aus sozial agierenden Interaktanten werden somit lediglich noch reagierende Rezipienten von bereits gefilterter, formatierter und in schmalhirngerechte Häppchen zerlegter Infotainmentmasse. Durch dieses Ausbleiben von Primärerfahrungen entsteht bei vielen Mediennutzern ein regelrechtes Authentizitätsloch, das sie, meist mangels besseren Wissens beziehungsweise fehlender Alternativen für die Lebensgestaltung, wiederum mit vermehrtem Medienkonsum zu füllen suchen. Das führt im Extremfall leicht nachvollziehbar unweigerlich in einen Kreislauf aus medialer Realitätsflucht und mehr oder weniger stark ausgeprägten Überforderungserscheinungen bei direkter Konfrontation mit der wirklichen Realität. Oft findet deshalb eine permanente Überflutung vieler Menschen mit Medienangeboten verschiedenster Art statt. Ständige Informationsselektion wird somit zum Muss im ′struggle for existence′; the ′survival of the fittest′ im Darwin′schen Sinne erfolgt mittlerweile nach der Devise: nur der im Mediendschungel Bestangepasste überlebt. Was also macht der homo sapiens zur Erhaltung seiner Art? Er passt sich an, was in diesem Fall konkret bedeutet, dass er die Wirklichkeitsentwürfe, die ihm die Medien aufdrängen, annimmt und damit die ′Medienwelten′ in seine eigene Wirklichkeitskonstruktion mit einfließen lässt. Im Rahmen dieser Seminararbeit soll auf der Basis des Trash-TV-Formats „Big Brother“ analysiert werden, welche Konsequenzen diese Form von Wahrnehmung aus zweiter Hand für den Umgang mit und die eigene Lebensgestaltung in der wirklichen Realität haben kann, die immer noch jeden Mediennutzer zusätzlich direkt umgibt.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Vorwort
- Realität und Massenmedien
- Allgemeine Grundannahmen des Konstruktivismus
- Niklas Luhmanns konstruktivistisches Wirklichkeitsmodell
- "Ausdifferenzierung als Verdopplung der Realität"
- "Selbstreferenz und Fremdreferenz"
- "Die Funktion der Massenmedien"
- Fernseh-Wirklichkeiten - Faszination Trash-TV
- 'Big Brother 3' (RTL / RTL 2) - Das 'wahre' Leben?
- Das Konzept
- Die Spielregeln
- Technische Voraussetzungen
- Die 'Macher'
- 'Echte-Leute-Fernsehen' als völlig neues Format: Wie funktioniert Trash-TV?
- Was ist das Erfolgsrezept von 'Big Brother'?
- Trash-Kultur: Wo hört die Realität auf und wo fängt Inszenierung an? - Die Gefahr eines drohenden Wirklichkeitsverlustes
- Schlussgedanke
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die mediale Wirklichkeitskonstruktion am Beispiel des Trash-TV-Formats „Big Brother“. Die Arbeit analysiert die Folgen einer sekundären Welterfahrung, die durch den Konsum von Medien entsteht, und wie dies das reale Leben der Zuschauer beeinflusst. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die „Big Brother“-Inszenierung die Wahrnehmung von Realität verändert und welche Auswirkungen dies auf das Individuum hat.
- Mediale Wirklichkeitskonstruktion und der Konstruktivismus
- Analyse des Trash-TV-Formats „Big Brother“
- Wirkung von Medienkonsum auf die Wahrnehmung von Realität
- Die „Big Brother“-Inszenierung und ihre Rezeption
- Gefahr des Wirklichkeitsverlustes durch mediale Überflutung
Zusammenfassung der Kapitel
Realität und Massenmedien: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es untersucht die allgemeinen Grundannahmen des Konstruktivismus und Luhmanns konstruktivistisches Wirklichkeitsmodell, fokussiert auf die Konzepte der Ausdifferenzierung, Selbst- und Fremdreferenz sowie die Rolle der Massenmedien in der Wirklichkeitskonstruktion. Es wird dargelegt, wie Medien Realität in Medienrealität transformieren und wie diese wiederum das subjektive Weltbild des Rezipienten prägt. Der Kapitel verdeutlicht die Entstehung eines auf Sekundärwissen basierenden Weltbildes bei regelmäßigen Medienkonsumenten und die daraus resultierende Sehnsucht nach Authentizität und die damit verbundenen Gefahren der Realitätsflucht.
'Big Brother 3' (RTL / RTL 2) - Das 'wahre' Leben?: Dieser Abschnitt analysiert das Konzept und die Spielregeln der „Big Brother“-Show, einschließlich der technischen Voraussetzungen und der Rolle der „Macher“. Er erörtert, wie das Format „Echte-Leute-Fernsehen“ funktioniert und welche Faktoren zu seinem Erfolg beitragen. Die Kapitel beleuchtet die Frage, wo bei „Big Brother“ Realität endet und Inszenierung beginnt, und wie die Show die Sehnsüchte nach Authentizität und Adrenalin ausnutzt. Es stellt kritische Fragen nach der Authentizität der dargestellten Leben und den daraus resultierenden Effekten auf die Zuschauer.
Schlüsselwörter
Mediale Wirklichkeitskonstruktion, Konstruktivismus, Niklas Luhmann, Trash-TV, Big Brother, Medienkonsum, Realität, Inszenierung, Authentizität, Wirklichkeitsverlust, Medienrezeption, Sekundärwissen.
Häufig gestellte Fragen zu "Realität und Massenmedien am Beispiel von Big Brother"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die mediale Wirklichkeitskonstruktion am Beispiel des Trash-TV-Formats „Big Brother“. Sie analysiert die Folgen einer sekundären Welterfahrung durch Medienkonsum und dessen Einfluss auf das reale Leben der Zuschauer. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Realitätswahrnehmung durch die „Big Brother“-Inszenierung und deren Auswirkungen auf das Individuum.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Konstruktivismus und Luhmanns konstruktivistischem Wirklichkeitsmodell. Es werden Konzepte wie Ausdifferenzierung, Selbst- und Fremdreferenz sowie die Rolle der Massenmedien in der Wirklichkeitskonstruktion behandelt. Die Entstehung eines auf Sekundärwissen basierenden Weltbildes bei regelmäßigen Medienkonsumenten und die Sehnsucht nach Authentizität mit der Gefahr der Realitätsflucht werden beleuchtet.
Wie wird „Big Brother“ in der Arbeit analysiert?
Die Analyse von „Big Brother“ umfasst das Konzept, die Spielregeln (inklusive technischer Voraussetzungen), die Rolle der „Macher“, und die Funktionsweise des Formats „Echte-Leute-Fernsehen“. Es wird untersucht, wo Realität endet und Inszenierung beginnt, wie die Show Sehnsüchte nach Authentizität und Adrenalin ausnutzt, und kritische Fragen nach der Authentizität der dargestellten Leben und deren Auswirkungen auf die Zuschauer gestellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit medialer Wirklichkeitskonstruktion und Konstruktivismus, der Analyse des Trash-TV-Formats „Big Brother“, der Wirkung von Medienkonsum auf die Realitätswahrnehmung, der „Big Brother“-Inszenierung und ihrer Rezeption sowie der Gefahr des Wirklichkeitsverlustes durch mediale Überflutung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Realität und Massenmedien (mit Unterkapiteln zu Konstruktivismus, Luhmanns Modell und Trash-TV), „Big Brother 3“ (Konzept, Spielregeln, Macher, Erfolgsrezept), Trash-Kultur und dem drohenden Wirklichkeitsverlust, sowie einem Schlussgedanken und einer Bibliographie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mediale Wirklichkeitskonstruktion, Konstruktivismus, Niklas Luhmann, Trash-TV, Big Brother, Medienkonsum, Realität, Inszenierung, Authentizität, Wirklichkeitsverlust, Medienrezeption, Sekundärwissen.
Welche zentrale Frage wird in der Arbeit untersucht?
Die zentrale Frage ist, wie die „Big Brother“-Inszenierung die Wahrnehmung von Realität verändert und welche Auswirkungen dies auf das Individuum hat.
- Arbeit zitieren
- Sabine Braun (Autor:in), 2001, Mediale Wirklichkeitskonstruktion am Beispiel des Trash-TV-Formats BIG BROTHER, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3295