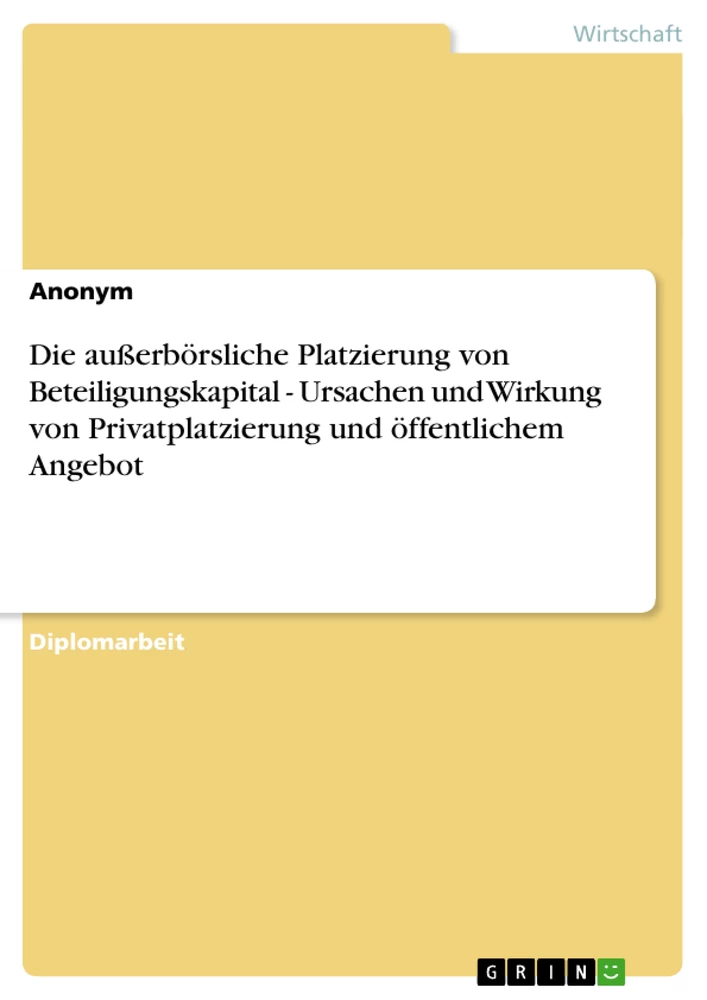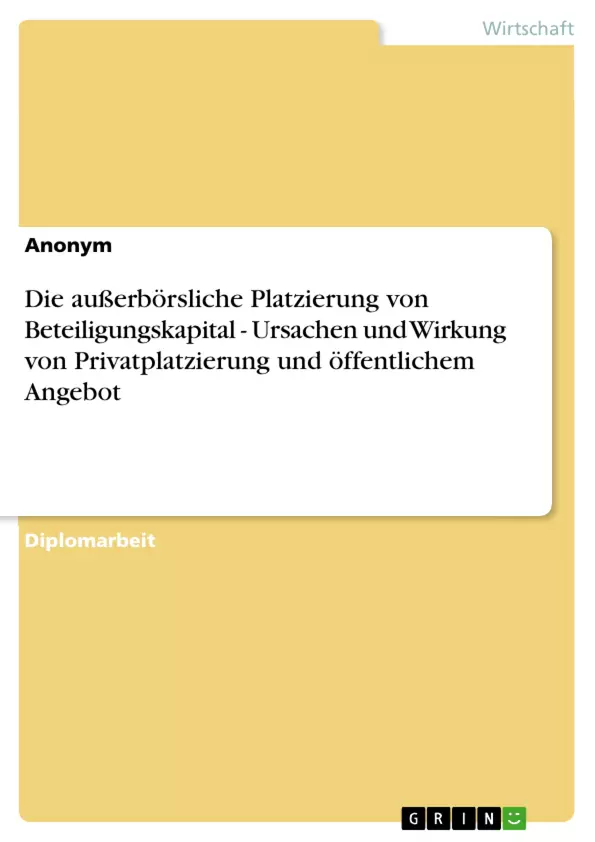In diesem Zusammenhang möchte die vorliegende Arbeit die Frage klären, welche
Rolle der außerbörsliche Emissionsmarkt in Konkurrenz oder als Ergänzung zur
börslichen Einführung (von eigenkapitalverbriefenden Wertpapieren) für eine
verbesserte Kapitalversorgung einnehmen kann. Dabei sind insbesondere zwei Fragen
von Interesse:
• Welche Gründe veranlassen ein emissionswilliges Unternehmen, Kapital unter
Umgehung des börslich organisierten Kapitalmarktes aufzunehmen?
• Welche Möglichkeiten und Probleme entstehen bei einer außerbörslichen
Emission für das Unternehmen?
Zur Beantwortung soll untersucht werden, welche Unzulänglichkeiten und Beschränkungen
auf realen Kapitalmärkten bestehen, die auch der börsliche Handel nicht
eliminieren kann oder sogar verstärkt. Daraus soll abgeleitet werden, ob die Mechanismen
der außerbörslichen Platzierung Lösungen hierfür bereitstellen und wie diese in
der Praxis umgesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung und Motivation
- 1.2 Zielsetzung und Abgrenzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Begriffe und Definitionen
- 2.1 Grundlagen des außerbörslichen Kapitalmarktes
- 2.1.1 Kapitalmarkt als Allokationsinstrument
- 2.1.2 Einordnung des außerbörslichen Kapitalmarktes
- 2.1.3 Grauer Kapitalmarkt
- 2.2 Finanzierungsinstrumente der außerbörslichen Beteiligung
- 2.3 Begriffe für Platzierungsmethoden
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Problemreduktion durch außerbörsliche Emission
- 3.1 Das System börslichen und außerbörslichen Handels
- 3.2 Funktion der Wertpapierbörsen
- 3.3 Börsenfähigkeit und Anforderungen einer börslichen Listung
- 3.3.1 Objektive Kriterien
- 3.3.2 Subjektive Kriterien
- 3.4 Gründe gegen eine börsliche Emission aus Emittentsicht
- 3.4.1 Fehlende Notwendigkeit der Börsenlistung
- 3.4.2 Emissionskostenreduktion
- 3.4.3 Flexibilität und individuell strukturierte Emissionen
- 3.4.4 Vermeidung fremder Unternehmenskontrolle
- 3.4.5 Umgehung einer fehlenden Qualifikation
- 3.5 Außerbörsliche Kapitalbeschaffung für den Mittelstand
- 3.6 Probleme für den Emittenten durch außerbörsliche Emissionen
- 3.7 Privatplatzierung als Spezialfall der außerbörslichen Emission
- 3.7.1 Die Regelung des Private Placement in den USA
- 3.7.2 Die Regelung der Privatplatzierung in Deutschland
- 3.7.3 Privatplatzierung im allgemeinen Sprachgebrauch
- 3.7.4 Bedeutung von Aktienemissionen mittels Privatplatzierung
- 3.8 Zusammenfassung
- 4. Beschränkungsfaktoren auf Kapitalmärkten
- 4.1 Effizienzbegriffe und idealer Markt
- 4.2 Markttransparenz
- 4.3 Transaktionskosten
- 4.3.1 Kosten für Information und Entscheidung
- 4.3.2 Kosten der Sicherung gegen Transaktionsrisiken
- 4.3.3 Kosten des Transaktionsservice
- 4.3.4 Kosten des sofortigen Abschlusses
- 4.4 Informationsasymmetrien
- 4.5 Opportunistisches Verhalten
- 4.6 Finanzintermediation und Direktgeschäfte
- 4.7 Behavioral Finance und menschliche Dimension
- 4.7.1 Persönliche Präferenzen der Anleger
- 4.7.2 Sonstiges irrationales Verhalten der Handelsakteure
- 4.8 Marktzugangsbeschränkungen
- 4.9 Marktregulation durch gesetzliche Vorschriften
- 4.9.1 Die Rolle der EU
- 4.9.2 Zugangsbeschränkungen der Börsen
- 4.9.3 Anlegerschutz
- 4.9.4 Publizitätspflichten
- 4.9.5 Aufgaben der Marktaufsicht in Deutschland
- 4.10 Marktliquidität
- 4.11 Zusammenfassung
- 5. Eigenschaften des außerbörslichen Emissionsmarktes
- 5.1 Emissionsbegleiter in außerbörslichen Emissionen
- 5.1.1 Wertpapierhandelsbanken / Makler
- 5.1.2 Vermittler, Berater
- 5.1.3 Emissions- und Handelsportale im Internet
- 5.2 Anlegerverhalten
- 5.2.1 Privatanleger
- 5.2.2 Institutionelle Anleger
- 5.3 Informationsproduktion und -beschaffung
- 5.4 Alternative Börsensegmente
- 5.5 Zusammenfassung
- 6. Probleme und Entscheidungen im Ablauf einer Emission
- 6.1 Anlässe für Emissionen
- 6.2 Grundsatzentscheidungen und Voraussetzungen des Emittenten
- 6.2.1 Beteiligungsmodell
- 6.2.2 Anforderungen an die Gesellschaft
- 6.2.3 Finanzierungsplanung und Kosten der Emission
- 6.2.4 Timing
- 6.2.5 Platzierungsvolumen
- 6.3 Due Diligence und Unternehmensbewertung
- 6.4 Kommunikationskonzept
- 6.4.1 Prospektierung
- 6.4.2 Anlegerkommunikation
- 6.5 Preisfindungsmechanismus
- 6.6 Vertrieb
- 6.6.1 Fremdemission
- 6.6.2 Selbstemission
- 6.6.3 Vertriebsformen
- 6.6.4 Abwicklung
- 6.7 Investor Relations nach der Emission
- 6.7.1 Bedeutung
- 6.7.2 Instrumente/Hilfsmittel
- 6.8 Einbeziehung in einen Sekundärmarkthandel
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die außerbörsliche Platzierung von Beteiligungskapital, vergleicht sie mit öffentlichen Angeboten und analysiert die Ursachen und Wirkungen beider Methoden. Der Fokus liegt auf den Vorteilen und Nachteilen für den Emittenten.
- Vergleich von Privatplatzierung und öffentlichem Angebot
- Analyse der Kosten und des Aufwands beider Verfahren
- Untersuchung der rechtlichen Rahmenbedingungen
- Bewertung der Eignung für verschiedene Unternehmenstypen (z.B. Mittelstand)
- Bedeutung von Markttransparenz und -liquidität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der außerbörslichen Kapitalbeschaffung ein, begründet die Relevanz des Themas und skizziert die Ziele und den Aufbau der Arbeit. Es liefert eine erste Übersicht über die behandelten Aspekte und die Forschungsfrage.
2. Begriffe und Definitionen: Hier werden zentrale Begriffe des außerbörslichen Kapitalmarktes definiert und abgegrenzt. Es werden die Grundlagen des Kapitalmarktes als Allokationsinstrument erläutert und verschiedene Finanzierungsinstrumente und Platzierungsmethoden wie IPO, Pre-IPO und Privatplatzierung detailliert beschrieben. Der Unterschied zwischen Public und Private Equity wird klargestellt. Diese fundierte Begriffserklärung bildet die Basis für das weitere Verständnis der Arbeit.
3. Problemreduktion durch außerbörsliche Emission: Das Kapitel beleuchtet die Vorteile einer außerbörslichen Emission im Vergleich zu einer börslichen Platzierung. Es werden die Gründe für die Wahl einer außerbörslichen Emission aus Sicht des Emittenten dargelegt, wie z.B. geringere Kosten, höhere Flexibilität bei der Gestaltung der Emission und die Vermeidung von Fremdkontrolle. Die Besonderheiten der Privatplatzierung werden als Spezialfall der außerbörslichen Emission herausgearbeitet. Das Kapitel vergleicht das System des börslichen und außerbörslichen Handels und benennt die Herausforderungen für den Emittenten bei der außerbörslichen Kapitalbeschaffung.
4. Beschränkungsfaktoren auf Kapitalmärkten: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Faktoren, die die Effizienz von Kapitalmärkten beeinflussen. Es untersucht die Rolle von Markttransparenz, Transaktionskosten, Informationsasymmetrien und opportunistischem Verhalten. Der Einfluss von Behavioral Finance und die Bedeutung von Marktregulation und -liquidität werden eingehend diskutiert. Dieses Kapitel liefert wichtige Kontextinformationen für die Beurteilung der Vor- und Nachteile außerbörslicher Emissionen.
5. Eigenschaften des außerbörslichen Emissionsmarktes: Das Kapitel beschreibt die Akteure auf dem außerbörslichen Emissionsmarkt, wie Emissionsbegleiter, Anleger (sowohl private als auch institutionelle) und die Rolle von Informationsbeschaffung. Die verschiedenen Formen der außerbörslichen Emissionen und alternative Börsensegmente werden beleuchtet. Dieses Kapitel liefert ein umfassendes Bild der Marktstruktur und der beteiligten Akteure.
6. Probleme und Entscheidungen im Ablauf einer Emission: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess einer außerbörslichen Emission detailliert. Es behandelt die Anlässe für Emissionen, die Grundsatzentscheidungen des Emittenten, die Unternehmensbewertung, das Kommunikationskonzept, den Preisfindungsmechanismus, den Vertrieb und die Bedeutung der Investor Relations nach der Emission. Es analysiert die verschiedenen Phasen des Emissionsprozesses, von der Planung bis zur Abwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Außerbörsliche Kapitalbeschaffung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der außerbörslichen Platzierung von Beteiligungskapital. Sie vergleicht dieses Verfahren mit öffentlichen Angeboten und analysiert die jeweiligen Ursachen und Wirkungen. Der Schwerpunkt liegt auf den Vor- und Nachteilen für den Emittenten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit untersucht den Vergleich von Privatplatzierung und öffentlichem Angebot, analysiert die Kosten und den Aufwand beider Verfahren, untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen, bewertet die Eignung für verschiedene Unternehmenstypen (insbesondere den Mittelstand) und beleuchtet die Bedeutung von Markttransparenz und -liquidität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung. Kapitel 2 (Begriffe und Definitionen) klärt zentrale Begriffe des außerbörslichen Kapitalmarktes. Kapitel 3 (Problemreduktion durch außerbörsliche Emission) vergleicht börsliche und außerbörsliche Emissionen und deren Vorteile für den Emittenten. Kapitel 4 (Beschränkungsfaktoren auf Kapitalmärkten) analysiert Einflussfaktoren auf die Effizienz von Kapitalmärkten. Kapitel 5 (Eigenschaften des außerbörslichen Emissionsmarktes) beschreibt die Akteure und die Marktstruktur. Kapitel 6 (Probleme und Entscheidungen im Ablauf einer Emission) detailliert den Prozess einer außerbörslichen Emission. Kapitel 7 bietet eine abschließende Zusammenfassung.
Welche Vorteile bietet eine außerbörsliche Emission im Vergleich zu einer börslichen Platzierung?
Eine außerbörsliche Emission bietet Vorteile wie geringere Kosten, höhere Flexibilität bei der Gestaltung der Emission und die Vermeidung von Fremdkontrolle. Die Arbeit analysiert diese Vorteile detailliert.
Welche Nachteile birgt eine außerbörsliche Emission?
Die Arbeit beleuchtet auch die Herausforderungen für den Emittenten bei der außerbörslichen Kapitalbeschaffung. Dies beinhaltet Aspekte wie die Marktliquidität und die Informationsasymmetrien.
Welche Akteure spielen auf dem außerbörslichen Emissionsmarkt eine Rolle?
Zu den Akteuren gehören Emissionsbegleiter (Wertpapierhandelsbanken, Makler, Berater, Online-Portale), Anleger (Privat- und Institutionelle) und die mit der Informationsbeschaffung betrachteten Parteien.
Wie läuft der Prozess einer außerbörslichen Emission ab?
Kapitel 6 beschreibt den Prozess detailliert, von den Anlässen für Emissionen über Grundsatzentscheidungen des Emittenten, Unternehmensbewertung, Kommunikationskonzept, Preisfindungsmechanismus und Vertrieb bis hin zur Bedeutung der Investor Relations nach der Emission.
Welche Bedeutung haben Markttransparenz und -liquidität im Kontext außerbörslicher Emissionen?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Markttransparenz und -liquidität für den Erfolg und die Bewertung außerbörslicher Emissionen. Dies wird im Kontext von Beschränkungsfaktoren auf Kapitalmärkten analysiert.
Für welche Unternehmenstypen eignet sich eine außerbörsliche Emission besonders?
Die Arbeit bewertet die Eignung außerbörslicher Emissionen für verschiedene Unternehmenstypen, insbesondere für den Mittelstand.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind für außerbörsliche Emissionen relevant?
Die Arbeit beleuchtet die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen für außerbörsliche Emissionen, sowohl im deutschen als auch im internationalen Kontext (z.B. USA).
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2004, Die außerbörsliche Platzierung von Beteiligungskapital - Ursachen und Wirkung von Privatplatzierung und öffentlichem Angebot, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/32599