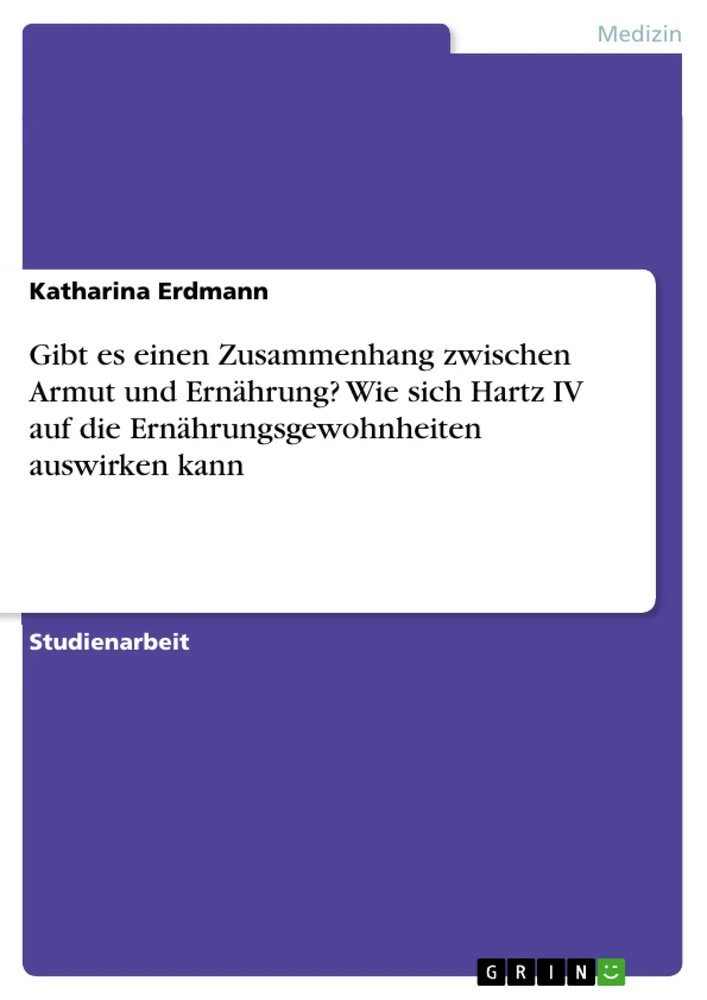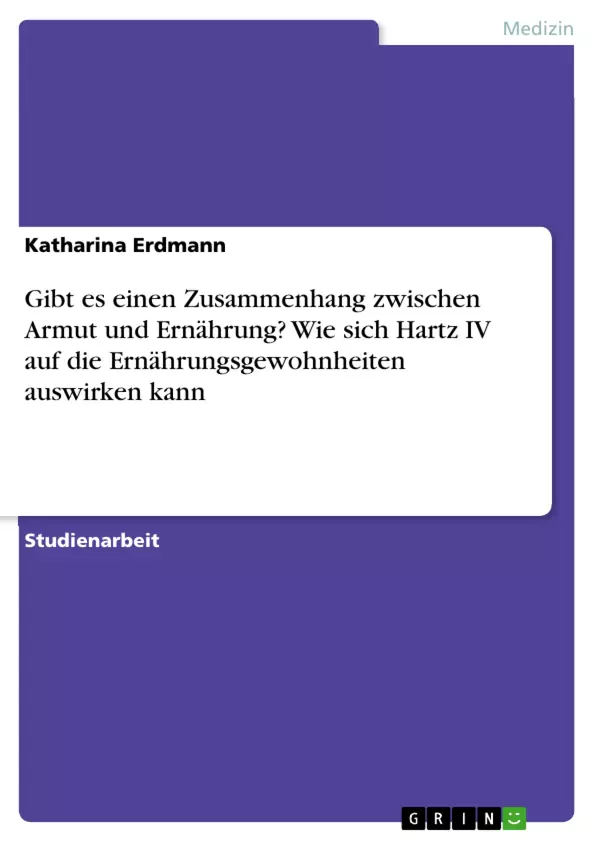Der UN-Sozialpakt, den auch Deutschland 1968 unterschrieben hat, enthält Rechtspflichten für die Vertragsstaaten, die jedoch nicht in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Artikel 11, Absatz 1 soll einen ausreichenden und menschenwürdigen Lebensstandard sicherstellen und Absatz 2 zielt auf den Schutz vor Hunger ab. Eine hinlängliche Ausstattung mit Nahrungsmitteln und Bekleidung, ferner eine adäquate Wohnsituation bestimmen den Lebensstandard.
Diesen Inhalten entspricht in Deutschland der Paragraph 27a des Zwölften Buch, Sozialgesetzbuch. „Der für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. […]“( Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz, Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe, 2003)
Zielstellung dieser Ausarbeitung ist es herauszustellen, ob die Höhe der Sozialhilfe, allgemein als Hartz IV bezeichnet, ausreichend ist, einen „menschenwürdigen Lebensstandard“ sicherzustellen. Inwieweit mit dieser ökonomische Grundlage eine bedarfsgerechte und ausreichende Ernährung möglich ist und wie diese das Ernährungsverhalten beeinflusst.
Laut Barlösius wurde in Befragungen von Sozialhilfeempfängern Essen als derjenige Bereich genannt, in dem sich zuerst und einschneidend eingeschränkt wird. Schon im 19. Jahrhundert wurde das Existenzminimum definiert als das Einkommen, das eine ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln gewährleistet und somit der Armut entgegenwirkt. Zunächst werde ich mich in der Hausarbeit mit der Definition und den Formen der Armut auseinandersetzen. und was Armut überhaupt ist. Weiterhin möchte ich beschreiben, wie Nahrung und deren qualitative und quantitative Verfügbarkeit in die kulturellen und sozialen Dimensionen des Lebens hineinspielt und zur Beschreibung von prekären Lebenslagen genutzt werden kann und welche Auswirkungen sich auf die Gesundheit der Menschen feststellen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Armutsdefinition und Formen der Armut.
- Ernährung als Aspekt in Armutsstudien.......
- Definition Ernährungsarmut
- Gesellschaftliche Erwartungen an arme Bevölkerungsteile...........
- Ist die Höhe der Sozialleistungen ausreichend für eine ausgewogene, gesunde Ernährung?
- Ernährungsalltag in armen Haushalten..\n
- Gesundheitliche Auswirkungen der Armutssituation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Ausarbeitung ist es zu untersuchen, ob die Höhe der Sozialhilfe, auch bekannt als Hartz IV, ausreichend ist, um einen "menschenwürdigen Lebensstandard" zu gewährleisten. Insbesondere soll geklärt werden, ob diese finanzielle Grundlage eine bedarfsgerechte und ausreichende Ernährung ermöglicht und welche Auswirkungen dies auf das Ernährungsverhalten von Sozialhilfeempfängern hat.
- Definition und Formen der Armut
- Ernährung als Aspekt in Armutsstudien
- Ernährungsarmut und ihre Auswirkungen
- Soziale und kulturelle Einflüsse auf das Ernährungsverhalten in Armut
- Gesundheitliche Folgen der Armutssituation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen des Existenzminimums in Deutschland und den internationalen Verpflichtungen zur Armutsbekämpfung. Sie stellt die Forschungsfrage in den Mittelpunkt: Ist die Höhe der Sozialhilfe ausreichend, um einen menschenwürdigen Lebensstandard, insbesondere eine ausreichende Ernährung, zu gewährleisten?
Armutsdefinition und Formen der Armut
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Definitionen von Armut, darunter die absolute, relative, subjektive und verdeckte Armut. Es werden die soziologischen Aspekte der Armut beleuchtet und der Einfluss gesellschaftlicher Werte auf die Wahrnehmung von Armut diskutiert.
Ernährung als Aspekt in Armutsstudien
Hier wird untersucht, wie Ernährung in Armutsstudien betrachtet wird. Es wird erläutert, wie die qualitative und quantitative Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln die Lebensqualität von Menschen in prekären Lebenslagen beeinflusst.
Definition Ernährungsarmut
Dieses Kapitel definiert Ernährungsarmut und beschreibt ihre Ursachen und Folgen. Es wird auf die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen in Armut hingewiesen.
Gesellschaftliche Erwartungen an arme Bevölkerungsteile
Dieses Kapitel beleuchtet die sozialen Erwartungen an arme Bevölkerungsteile und wie diese das Ernährungsverhalten beeinflussen können. Es wird diskutiert, ob diese Erwartungen realistisch sind und welche Auswirkungen sie auf die soziale Teilhabe von Menschen in Armut haben.
Ist die Höhe der Sozialleistungen ausreichend für eine ausgewogene, gesunde Ernährung?
Dieses Kapitel analysiert die Höhe der Sozialleistungen in Deutschland und untersucht, ob sie ausreichend sind, um eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu ermöglichen. Es werden die Auswirkungen von finanziellen Einschränkungen auf das Ernährungsverhalten und die Ernährungssicherheit von Menschen in Armut betrachtet.
Ernährungsalltag in armen Haushalten
Hier wird der Ernährungsalltag in armen Haushalten beleuchtet. Es werden die Ernährungsgewohnheiten und -strategien von Menschen in Armut beschrieben, sowie die Herausforderungen, die mit begrenztem Budget und Zugang zu Nahrungsmitteln verbunden sind.
Gesundheitliche Auswirkungen der Armutssituation
Dieses Kapitel befasst sich mit den gesundheitlichen Folgen der Armut. Es wird die Verbindung zwischen Ernährung und Gesundheit untersucht, insbesondere die Risiken, die mit einer unzureichenden Ernährung verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Armut, Ernährung, Existenzminimum, Sozialhilfe, Hartz IV, Ernährungsarmut, Gesundheit, Wohlbefinden, gesellschaftliche Erwartungen, Ernährungsverhalten, soziale Teilhabe und Lebensstil.
- Quote paper
- Katharina Erdmann (Author), 2015, Gibt es einen Zusammenhang zwischen Armut und Ernährung? Wie sich Hartz IV auf die Ernährungsgewohnheiten auswirken kann, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/323065