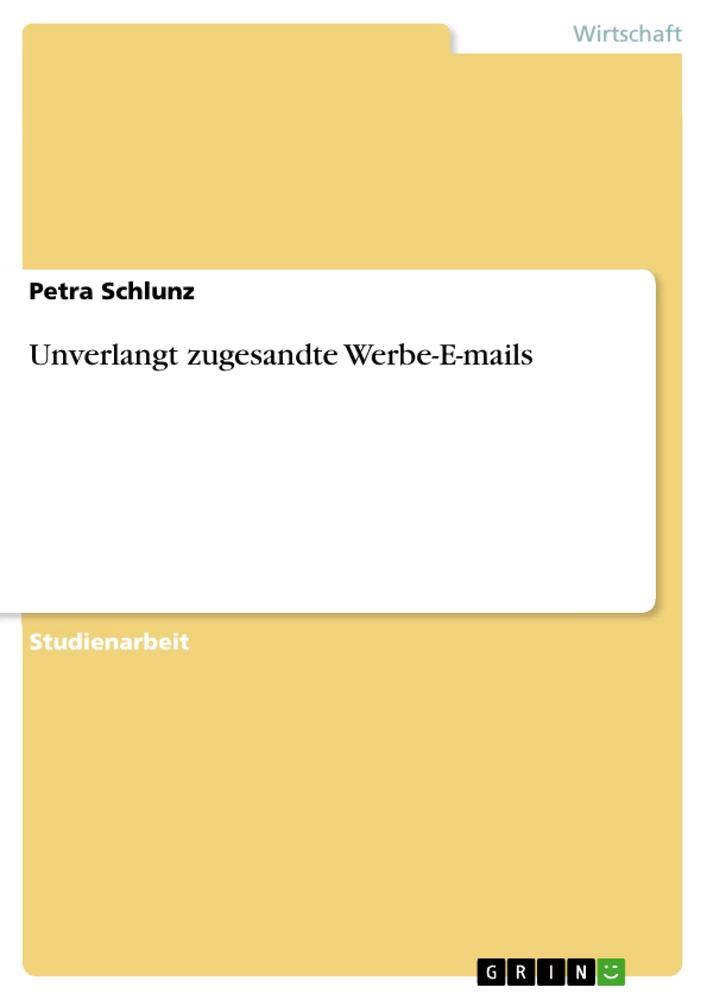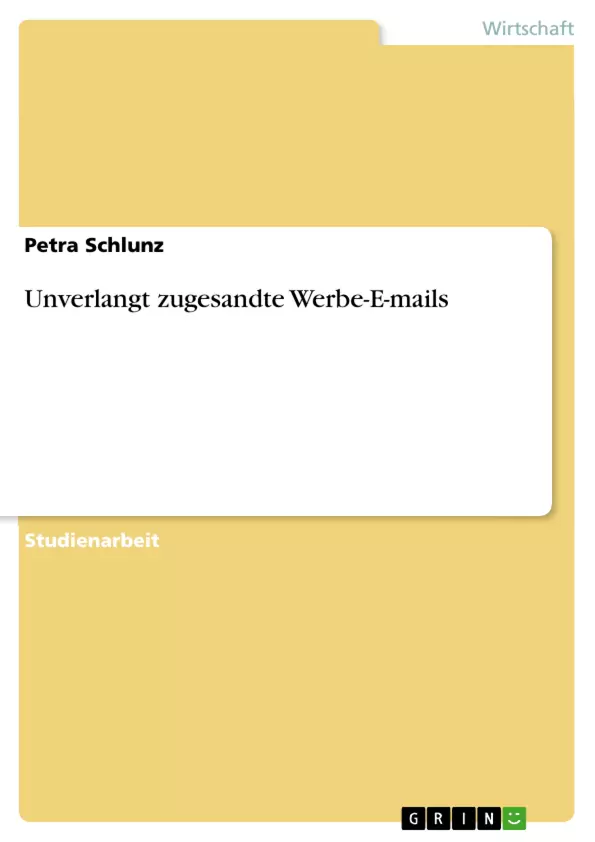EINFÜHRUNG
Bereits seit längerer Zeit machen sich Unternehmen das Internet als
Kommunikationsinstrument zu nutze. Anfangs begnügte man sich noch mit der Präsentation von Unternehmen auf einer Homepage.(1) Inzwischen aber kontaktieren immer mehr Unternehmen die Internet-Nutzer mit E-Mail-Nachrichten, die ausschließlich werbenden bzw. belästigenden Charakter haben und dem Empfänger ungefragt zugesandt werden. Die meisten Empfänger fühlen sich durch diese sog. „Spams(2)“ oder auch „Junk-Mails (3)“ genannt, belästigt. Junk-Mails werden nicht als
Werbung gekennzeichnet4. In der Betreffzeile der E-Mail-Nachricht wird vom Versender nicht darauf hingewiesen, dass es sich um eine Werbebotschaft handelt.
Dies erschwert dem Empfänger einer solchen Nachricht noch weiterhin das schnelle und problemlose Aussortieren (also das Löschen) dieser unerbetenen Nachrichten, da sie nicht von vorneherein zu erkennen sind. Um das versehentliche Löschen von erbetener elektronischer Post zu vermeiden, muß der Internet-Nutzer die Mail öffnen,
um den Inhalt zur Kenntnis nehmen zu können. Somit hat der Empfänger die Kosten für die eventuell minutenlange Durchsicht der E-Mails zu tragen sowie den für dafür benötigten Zeitaufwand. Desweiteren ist mit einer Beeinträchtigung der Speicherkapazität des E-Mail-Accounts des Nutzers zu rechnen. Da diese nur eine begrenzte Anzahl von E-Mails aufnehmen, besteht die Gefahr, dass bei einem
bereits „vollem“ Account (verursacht durch eine größere Anzahl von Spams zusätzlich zu den erwünschten Mails) keine weiteren E-Mails mehr aufgenommen werden können. Somit erhält der Internet-Nutzer solange auch keine erwünschten Mails mehr bis er seine E-Mails aussortiert und gelöscht hat.
[...]
_____
1 Vgl. Naaf, Silke: In aller Munde: Die unerwünschte Werbe-E-Mail. Online im Internet: URL:http://www.graefeundpartner.de/ ecom/werbeemail.htm
2 Der Name entstand in einem Sketch. Die US-Firma Hormel Foods stellt gewürztes Schweinefleisch und Schinken („spiced pork and ham“) in einer Konserve her. Als Abkürzung steht der Begriff
„Spam“. In dem Sketch, der in einem Café spielt, [...]So kam es offenbar zu dem Namen Spam. Vgl. Häufig gestellte Fragen zu Spam. Online im Internet: URL:http://www.trash.net/~roman/faq.shtml. S. [...]
3 Anderes Wort für Spam, das durch den Vergleich mit „Junk-Food“ („Billig-Fraß“) entstand. Vgl. Börner, F., Dr. u. a.: [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Direktwerbung
- 2.1 Beurteilung traditioneller Marketinginstrumente nach § 1 UWG
- 2.1.1 Telefonwerbung
- 2.1.2 Telefaxwerbung
- 2.1.3 Telex- und Btx-Werbung
- 2.2 Beurteilung von E-Mail-Werbung nach § 1 UWG
- 2.2.1 Entscheidung des LG Traunstein sowie anderer Gerichte
- 2.2.2 Literaturmeinung
- 3. Die Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie – bedeutende lauterkeitsrechtliche Aspekte für die E-Mail-Werbung
- 3.1 Anwendungsbereich und Zielsetzung
- 3.2 Art. 10 FARL - Schutz vor unaufgeforderter Werbung
- 3.3 Art. 14 FARL – Umsetzungsspielraum
- 4. Regelungen der E-Mail-Werbung in der E-Commerce-Richtlinie
- 4.1 Herkunftslandprinzip gem. Art. 3 ECRL
- 4.1.1 Definition des Art. 3 ECRL
- 4.1.2 Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip gem. Art. 3 Abs. 3 ECRL
- 4.2 Art. 7 ECRL: Nicht angeforderte kommerzielle Kommunikation
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtliche Beurteilung unverlangt zugesandter Werbe-E-Mails im deutschen Wettbewerbsrecht. Sie beleuchtet die Problematik von Spam-Mails im Kontext traditioneller Direktmarketingmethoden und analysiert die Anwendung relevanter Rechtsvorschriften, insbesondere des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (§ 1 UWG) sowie der Fernabsatz- und E-Commerce-Richtlinien.
- Rechtliche Einordnung von Spam-Mails im Kontext des UWG
- Vergleichende Betrachtung traditioneller Direktmarketingmethoden
- Analyse der Fernabsatzrichtlinie und ihrer Relevanz für E-Mail-Werbung
- Auswirkungen der E-Commerce-Richtlinie auf die Zulässigkeit von unaufgeforderter kommerzieller Kommunikation
- Bewertung der Interessenlage von Werbenden und Empfängern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beschreibt den zunehmenden Einsatz von E-Mails als Werbeinstrument und die damit verbundene Problematik von unerwünschten Werbe-E-Mails (Spam). Sie betont die Belästigung der Empfänger durch solche Mails, die oft nicht als Werbung gekennzeichnet sind und somit zu erhöhtem Aufwand beim Löschen und zur Beeinträchtigung der Speicherkapazität von E-Mail-Accounts führen. Die minimalen Kosten des Versands für den Werbenden im Gegensatz zum Aufwand des Empfängers werden ebenfalls hervorgehoben. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende Analyse der rechtlichen Situation.
2. Direktwerbung: Dieses Kapitel befasst sich mit traditionellen Marketinginstrumenten wie Telefon-, Telefax-, Telex- und Btx-Werbung im Vergleich zur E-Mail-Werbung. Es analysiert die rechtliche Beurteilung dieser Methoden nach § 1 UWG, wobei die Briefkastenwerbung als grundsätzlich zulässig (Opt-out-Modell) dargestellt wird, während die anderen aufgrund der erheblichen Belastung für den Empfänger als sittenwidrig eingestuft werden. Die Interessenabwägung zwischen Werbendem, Empfänger und Allgemeinheit im Rahmen der Generalklausel des § 1 UWG bildet den Kern der Argumentation.
3. Die Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie – bedeutende lauterkeitsrechtliche Aspekte für die E-Mail-Werbung: Dieses Kapitel analysiert die Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie und ihre Relevanz für die rechtliche Beurteilung von E-Mail-Werbung. Es untersucht den Anwendungsbereich und die Zielsetzung der Richtlinie, den Schutz vor unaufgeforderter Werbung (Art. 10 FARL) und den Umsetzungsspielraum für die Mitgliedsstaaten (Art. 14 FARL). Die Kapitel beleuchtet die Schnittstelle zwischen nationalem Recht und europäischer Rechtsprechung in Bezug auf den Schutz der Verbraucher vor unerwünschter Werbung.
4. Regelungen der E-Mail-Werbung in der E-Commerce-Richtlinie: Das Kapitel befasst sich mit den Regelungen der E-Commerce-Richtlinie im Hinblick auf E-Mail-Werbung. Im Mittelpunkt stehen das Herkunftslandprinzip (Art. 3 ECRL), seine Definition sowie die Ausnahmen davon. Die Analyse von Art. 7 ECRL, der nicht angeforderte kommerzielle Kommunikation betrifft, bildet einen weiteren Schwerpunkt. Der Abschnitt analysiert den Konflikt zwischen dem freien Warenverkehr und dem Schutz der Konsumenten vor unerwünschter Werbung.
Schlüsselwörter
Wettbewerbsrecht, § 1 UWG, Direktwerbung, E-Mail-Werbung, Spam, Junk-Mails, Fernabsatzrichtlinie, E-Commerce-Richtlinie, Lauterkeitsrecht, Interessenabwägung, unerwünschte kommerzielle Kommunikation, Opt-out-Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Rechtliche Beurteilung unverlangt zugesandter Werbe-E-Mails im deutschen Wettbewerbsrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die rechtliche Beurteilung von unerwünschten Werbe-E-Mails (Spam) im deutschen Wettbewerbsrecht. Sie analysiert die Anwendung relevanter Rechtsvorschriften wie § 1 UWG, der Fernabsatzrichtlinie und der E-Commerce-Richtlinie im Kontext traditioneller Direktmarketingmethoden.
Welche Rechtsvorschriften werden untersucht?
Die Arbeit analysiert insbesondere § 1 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), die Fernabsatzrichtlinie (FARL) und die E-Commerce-Richtlinie (ECRL). Es wird untersucht, wie diese Vorschriften die Zulässigkeit von unaufgeforderter kommerzieller Kommunikation per E-Mail regeln.
Wie werden traditionelle Direktmarketingmethoden behandelt?
Die Arbeit vergleicht die rechtliche Beurteilung von E-Mail-Werbung mit traditionellen Methoden wie Telefon-, Telefax-, Telex- und Btx-Werbung. Es wird untersucht, ob und wie diese Methoden nach § 1 UWG beurteilt werden und wie sich die Interessenabwägung zwischen Werbendem und Empfänger gestaltet.
Welche Rolle spielt die Fernabsatzrichtlinie?
Die Arbeit analysiert die Fernabsatzrichtlinie hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs, ihrer Zielsetzung (Schutz vor unaufgeforderter Werbung, Art. 10 FARL) und des Umsetzungsspielraums für die Mitgliedsstaaten (Art. 14 FARL). Die Schnittstelle zwischen nationalem Recht und europäischer Rechtsprechung wird beleuchtet.
Welche Bedeutung hat die E-Commerce-Richtlinie?
Die Arbeit untersucht das Herkunftslandprinzip (Art. 3 ECRL) und seine Ausnahmen sowie die Regelungen zu nicht angeforderter kommerzieller Kommunikation (Art. 7 ECRL). Der Konflikt zwischen freiem Warenverkehr und Verbraucherschutz wird analysiert.
Wie wird die Interessenlage von Werbenden und Empfängern bewertet?
Die Arbeit bewertet die Interessenlage von Werbenden und Empfängern im Kontext der rechtlichen Regelungen. Es wird die Abwägung der Interessen im Rahmen der Generalklausel des § 1 UWG und im Hinblick auf die europäischen Richtlinien betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zu Direktwerbung (inkl. traditioneller Methoden und E-Mail-Werbung), ein Kapitel zur Fernabsatzrichtlinie, ein Kapitel zur E-Commerce-Richtlinie und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der rechtlichen Beurteilung von Spam-Mails.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wettbewerbsrecht, § 1 UWG, Direktwerbung, E-Mail-Werbung, Spam, Junk-Mails, Fernabsatzrichtlinie, E-Commerce-Richtlinie, Lauterkeitsrecht, Interessenabwägung, unerwünschte kommerzielle Kommunikation, Opt-out-Modell.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kürze)?
Die Arbeit bietet eine umfassende Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen für E-Mail-Werbung in Deutschland, unter Berücksichtigung nationaler und europäischer Rechtsvorschriften. Sie beleuchtet die Herausforderungen des Umgangs mit Spam-Mails und die Abwägung der Interessen verschiedener Akteure.
- Arbeit zitieren
- Petra Schlunz (Autor:in), 2001, Unverlangt zugesandte Werbe-E-mails, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3229