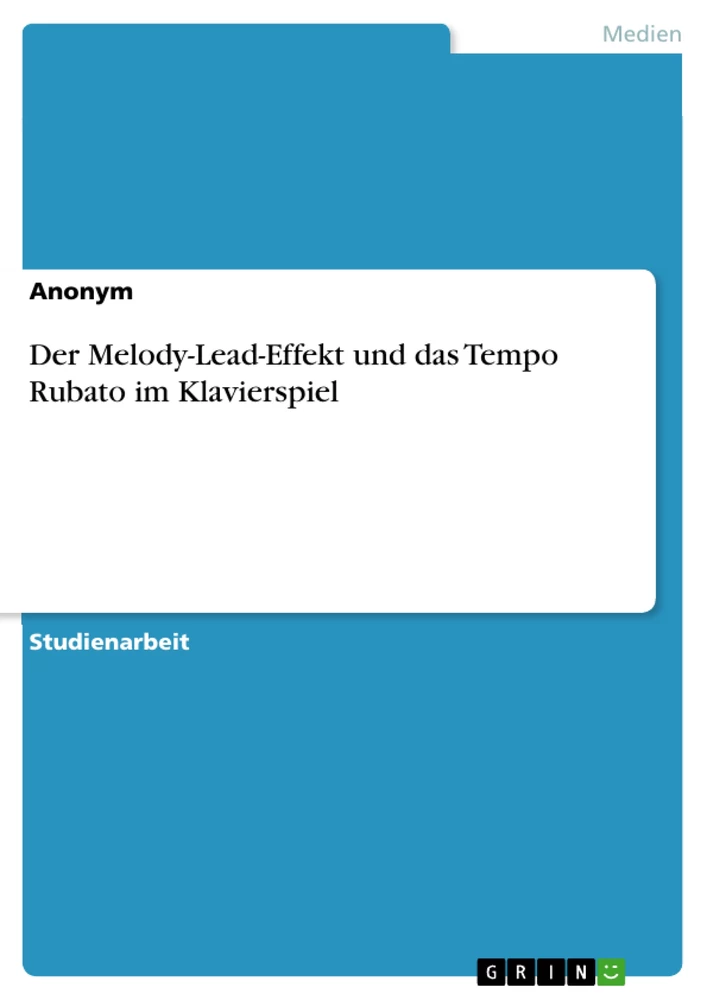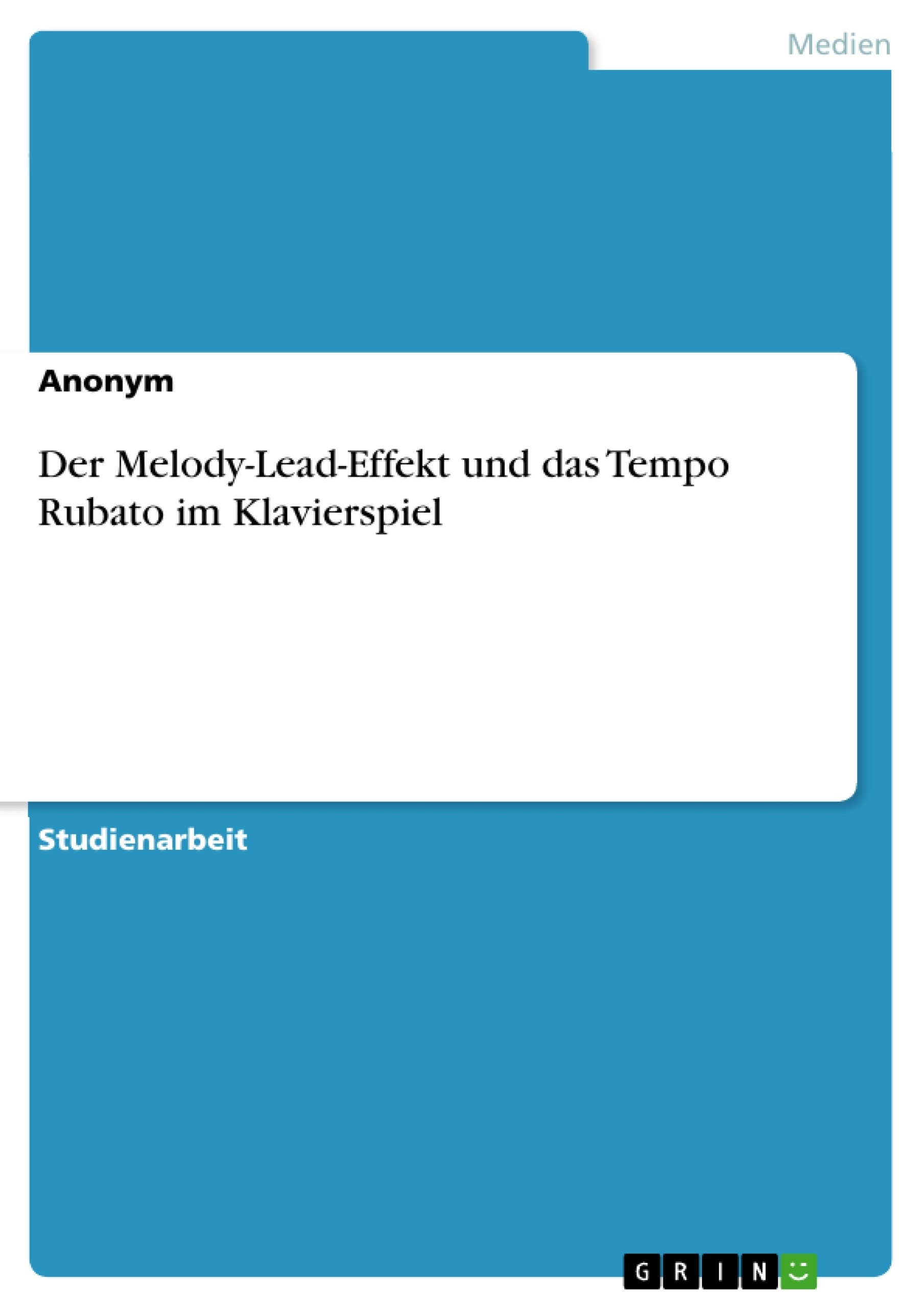Die vorliegende Arbeit wird verschiedene Studien zum Thema Melody-Lead betrachten und seine Entstehung sowie die Frage nach der Wahrnehmung des Melody-Lead-Effekts untersuchen. Darüber hinaus soll auch das Tempo rubato im früheren Sinne eine wichtige Rolle spielen, da untersucht werden soll, welchen Einfluss es auf die Lebendigkeit des Klavierspiels haben kann.
Vor wenigen Jahrzehnten konnte man noch leicht entscheiden, ob die Musik, die man gerade hört von einem echten Musiker oder einer Maschine gespielt wird – oftmals gab bereits der klangliche Aspekt Auskunft darüber. Ebenso fehlte der durch einen Computer gespielten Musik die Lebendigkeit und die Ausdruckskraft. Doch dieses Bild änderte sich, als die computergenerierten Sounds den realen Instrumentenklängen besser nachempfunden werden konnten und man sich auch mit dem Thema der musikalischen Ausdruckskraft beschäftigte. Ein bekannter Vertreter dieses Forschungsgebiets ist Werner Goebl.
Töne, die innerhalb einer Partitur gleichzeitig notiert sind (Akkorde), werden in der Realität nur selten wirklich gleichzeitig angeschlagen. Diese schlicht wirkende Beobachtung veranlasste Werner Goebl zu zahlreichen sehr komplexen Studien über Asynchronitäten im Klavierspiel. So untersuchte er in einer 2011 veröffentlichten Studie mit dem Namen „Die ungleichzeitige Gleichzeitigkeit des Spiels: Tempo rubato in Magaloffs Chopin und andere Asynchronizitäten“ den sogenannten Melody-Lead-Effekt und das Tempo rubato im früheren Sinne. Eine Stimme, die vom Pianisten hervorgehoben werden soll, wird von diesem nicht nur lauter, sondern auch etwas eher gespielt (Melody-Lead), so die Annahme. Im Folgenden soll hinterfragt werden, ob dieser Effekt Teil des bewussten Ausdrucksvermögens des jeweiligen Pianisten ist oder ob dies mit den baulichen Gegebenheiten des Klaviers zu tun hat und damit als ein Ergebnis dynamischer Differenzierung von verschiedenen Stimmen angesehen werden kann. Werner Goebl geht in diesem Zusammenhang auf verschiedene Erklärungsversuche ein und konnte dabei seine selbst erhobenen Daten mit in seine Betrachtungen einbeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Melody-Lead-Effekt
- Definition
- Die Entstehung des Melody-Lead-Effekts
- Die Wahrnehmung des Melody-Lead-Effekts
- Das Tempo rubato
- Definition
- Der Magaloff-Komplex
- Das Tempo rubato in Magaloffs Chopin
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Melody-Lead-Effekt und das Tempo Rubato im Klavierspiel. Ziel ist es, zu ergründen, ob der Melody-Lead-Effekt ein bewusstes Ausdrucksmittel des Pianisten ist oder durch die technischen Gegebenheiten des Instruments entsteht. Weiterhin wird der Einfluss des Tempo Rubato auf die Lebendigkeit des Spiels analysiert.
- Der Melody-Lead-Effekt als Ausdrucksphänomen
- Die Entstehung des Melody-Lead-Effekts im Kontext der Klaviertechnik
- Die Wahrnehmung des Melody-Lead-Effekts durch den Hörer
- Tempo Rubato und seine Auswirkung auf die musikalische Interpretation
- Untersuchung historischer und aktueller Studien zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel in der Computermusik und die zunehmende Annäherung an die Ausdruckskraft menschlicher Interpretation. Sie führt den Forschungsbereich von Werner Goebl ein, der Asynchronitäten im Klavierspiel untersucht, insbesondere den Melody-Lead-Effekt und Tempo Rubato. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Entstehung und Wahrnehmung des Melody-Lead-Effekts sowie den Einfluss des Tempo Rubato auf die Lebendigkeit des Spiels an.
Der Melody-Lead-Effekt: Dieses Kapitel definiert den Melody-Lead-Effekt als ein Phänomen, bei dem die Melodiestimme im Durchschnitt etwa 30 Millisekunden vor den Begleitstimmen erklingt. Es werden frühere Studien von Hartmann und Vernon erwähnt, die bereits Ton-Asynchronitäten untersuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse von Goebls Forschungsarbeit und der Velocity-Artefact-Hypothese von Repp, die einen Zusammenhang zwischen der Lautstärke und dem zeitlichen Vorsprung der Melodiestimme herstellt. Die Studien von Palmer zu Akkordasynchronitäten und die Untersuchung des Melody-Lead-Effekts in Abhängigkeit von der Ausdruckskraft und der Spielfertigkeit des Pianisten werden eingehend betrachtet.
Schlüsselwörter
Melody-Lead-Effekt, Tempo Rubato, Klavierspiel, Asynchronität, Musikalische Ausdruckskraft, Computergestützte Musikanalyse, Werner Goebl, Bruno Repp, Caroline Palmer, Klaviertechnik, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Melody-Lead-Effekt und Tempo Rubato im Klavierspiel"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Melody-Lead-Effekt und das Tempo Rubato im Klavierspiel. Es wird analysiert, ob der Melody-Lead-Effekt ein bewusstes Ausdrucksmittel des Pianisten oder ein Ergebnis der technischen Gegebenheiten des Instruments ist. Zusätzlich wird der Einfluss des Tempo Rubatos auf die Lebendigkeit des musikalischen Vortrags analysiert.
Was ist der Melody-Lead-Effekt?
Der Melody-Lead-Effekt beschreibt ein Phänomen, bei dem die Melodiestimme im Durchschnitt ca. 30 Millisekunden vor den Begleitstimmen erklingt. Die Arbeit untersucht verschiedene Theorien zu seiner Entstehung und Wahrnehmung, unter anderem die Velocity-Artefact-Hypothese von Repp (Zusammenhang zwischen Lautstärke und zeitlichem Vorsprung der Melodiestimme) und Studien von Palmer zu Akkordasynchronitäten.
Welche Rolle spielt die Klaviertechnik?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Klaviertechnik bei der Entstehung des Melody-Lead-Effekts. Es wird untersucht, inwiefern die technischen Fähigkeiten des Pianisten den Effekt beeinflussen und ob er ein bewusstes Stilmittel oder eine ungewollte Nebenwirkung der Spieltechnik darstellt.
Was ist Tempo Rubato und wie wirkt es sich auf das Spiel aus?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Tempo Rubatos auf die Lebendigkeit des musikalischen Vortrags. Es wird insbesondere der Magaloff-Komplex im Kontext von Chopins Werken betrachtet. Der Fokus liegt auf der Auswirkung von rhythmischen Variationen auf die Interpretation und die Wahrnehmung des Stücks durch den Hörer.
Welche Wissenschaftler werden in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Forschungsarbeiten von Werner Goebl (der Asynchronitäten im Klavierspiel untersucht), Bruno Repp (Velocity-Artefact-Hypothese), und Caroline Palmer (Studien zu Akkordasynchronitäten). Zusätzlich werden frühere Studien von Hartmann und Vernon erwähnt, die sich bereits mit Ton-Asynchronitäten auseinandergesetzt haben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Melody-Lead-Effekt (inkl. Definition, Entstehung und Wahrnehmung), ein Kapitel zum Tempo Rubato (inkl. Magaloff-Komplex), ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Melody-Lead-Effekt, Tempo Rubato, Klavierspiel, Asynchronität, Musikalische Ausdruckskraft, Computergestützte Musikanalyse, Werner Goebl, Bruno Repp, Caroline Palmer, Klaviertechnik, Interpretation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung und Wahrnehmung des Melody-Lead-Effekts zu ergründen und den Einfluss des Tempo Rubatos auf die Lebendigkeit des Klavierspiels zu analysieren. Es soll untersucht werden, ob der Melody-Lead-Effekt ein bewusstes Ausdrucksmittel darstellt oder durch die technischen Gegebenheiten des Instruments entsteht.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Der Melody-Lead-Effekt und das Tempo Rubato im Klavierspiel, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/322682