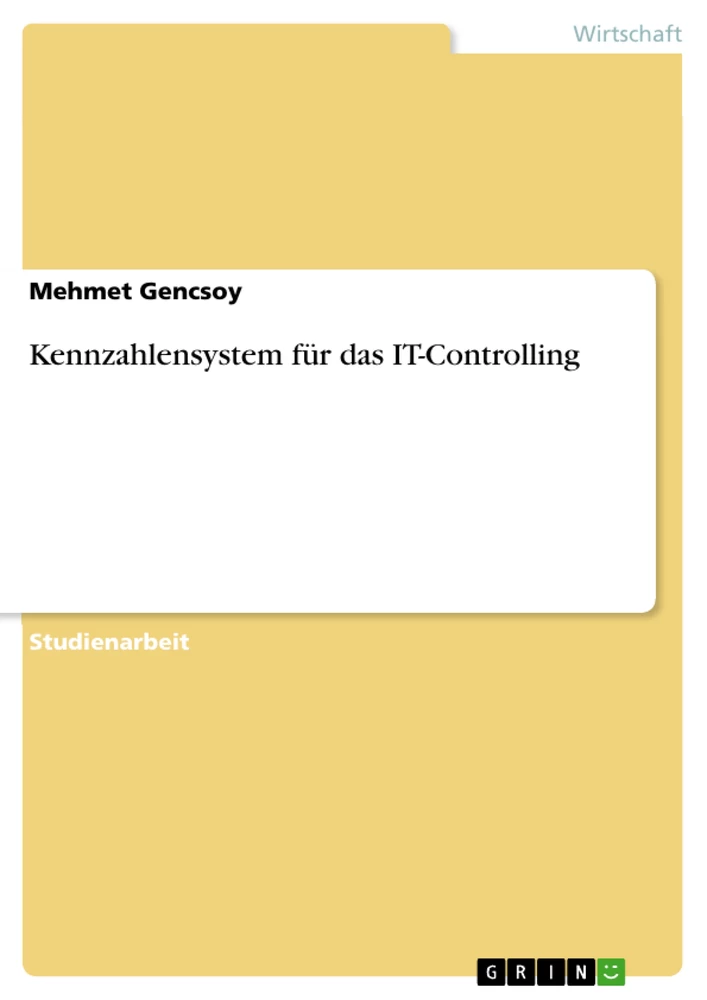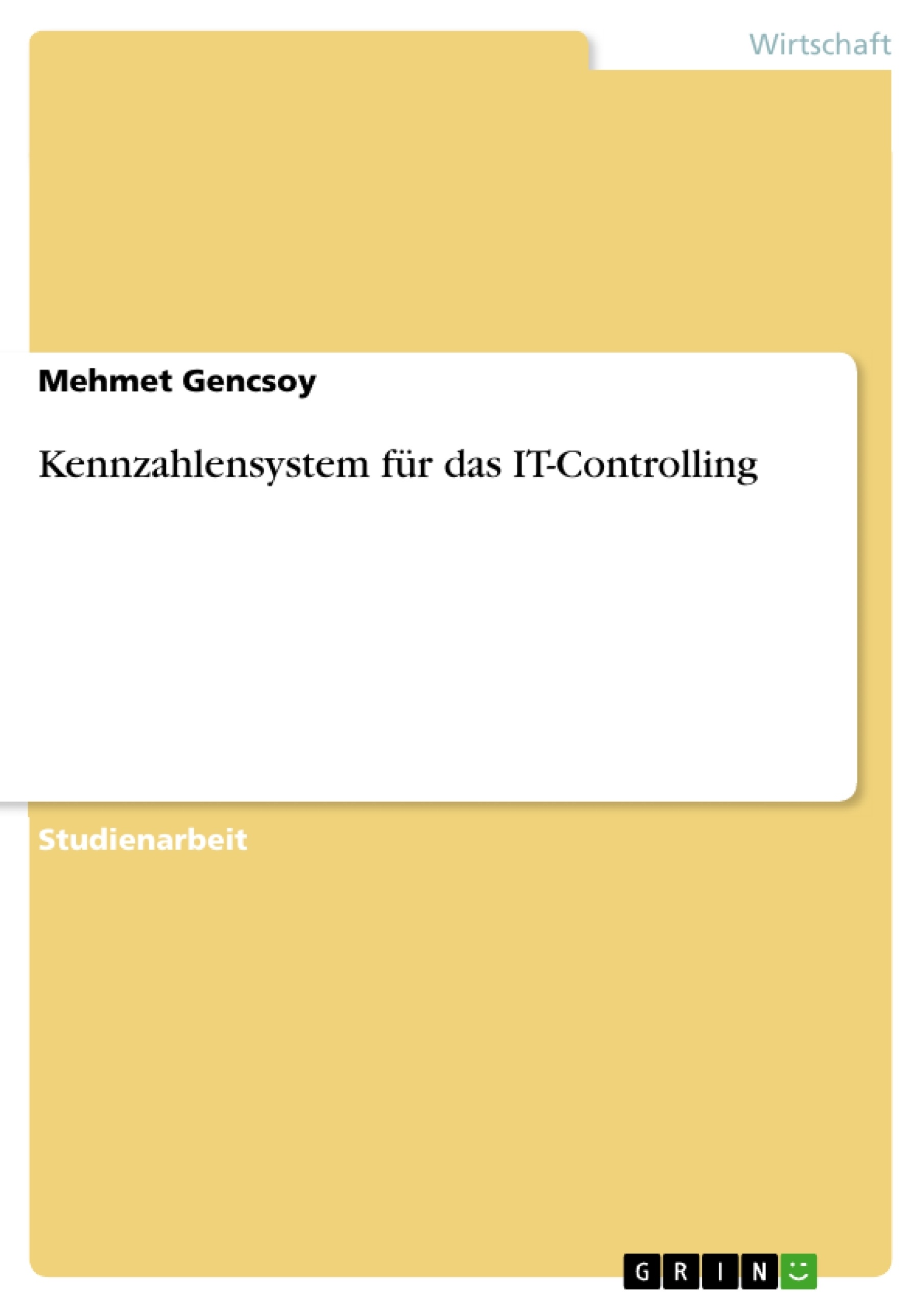Mit diesem Assignment wird auf die folgende Fragestellung eingegangen: Welches Kennzahlensystem lässt sich am besten auf die IT und IT-Organisation in einem mittelständischen Automobilzulieferer anwenden und warum?
Die Führung eines Unternehmens wird oft einer riesigen Anzahl von Zahlen ausgesetzt, die sie einordnen und bewerten soll. Dabei kann es leicht passieren, dass der Überblick verloren geht und das Unternehmen in eine falsche Richtung gesteuert wird.
Das Controlling nutzt solche Kennzahlensysteme, um wichtige Entscheidungsgrundlagen für das Management aufzubereiten. Bei diesem Assignment wird gezielt die IT-Organisation, also das IT-Controlling, untersucht. Dazu werden im nächsten Kapitel die Grundlagen eruiert, wobei die Begriffe Controlling und IT-Controlling erläutert werden. Im gleichen Kapitel wird auch die Definition von Kennzahlen und Kennzahlensystemen ausgearbeitet. Im nächsten Kapitel werden die in der Literatur bekannten Kennzahlensysteme vorgestellt und auf ihre Eignung bewertet. Darauf folgend wird die aktuelle Situation der Automobilbranche erörtert und die Relevanz der vorgestellten Kennzahlensysteme für das IT-Controlling eines mittelständischen Automobilzulieferers untersucht. Abschließend finden im letzten Kapitel eine Zusammenfassung sowie eine kritische Würdigung der Erkenntnisse statt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Controlling
- IT-Controlling
- Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- Kennzahlensysteme für das IT-Controlling eines mittelständischen Automobilzulieferers
- Du-Pont-Kennzahlensystem
- Diebold-Kennzahlensystem
- SVD-Kennzahlensystem
- Statuskonzept von Kütz
- Fazit
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Assignment befasst sich mit der Frage, welches Kennzahlensystem sich am besten für die IT und IT-Organisation in einem mittelständischen Automobilzulieferer eignet. Dabei wird untersucht, wie Kennzahlen im Controlling eingesetzt werden, um eine Informationsüberflutung bei der Unternehmensführung zu vermeiden und wichtige Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.
- Grundlagen des Controllings und des IT-Controllings
- Definition und Anwendung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen
- Vorstellung und Bewertung verschiedener Kennzahlensysteme
- Relevanz der Kennzahlensysteme für das IT-Controlling in der Automobilbranche
- Zusammenfassung und kritische Würdigung der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung des Assignments vor und erläutert die Bedeutung von Kennzahlen im Controlling, insbesondere im Kontext des IT-Controllings. Sie verweist auf die Notwendigkeit, einen Informationsüberfluss bei der Unternehmensführung zu vermeiden und wichtige Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.
Grundlagen
Dieses Kapitel definiert die Begriffe Controlling und IT-Controlling. Es erläutert die Aufgaben und Funktionen des Controllings sowie die Bedeutung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen für die Entscheidungsfindung im Unternehmen.
Kennzahlensysteme für das IT-Controlling eines mittelständischen Automobilzulieferers
Dieses Kapitel stellt verschiedene in der Literatur bekannte Kennzahlensysteme vor und bewertet deren Eignung für das IT-Controlling. Es werden die Du-Pont-, Diebold-, SVD-Kennzahlensysteme sowie das Statuskonzept von Kütz vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert.
Kritische Würdigung
Das Kapitel fasst die Erkenntnisse des Assignments zusammen und bietet eine kritische Würdigung der verschiedenen Kennzahlensysteme. Es bewertet die Eignung der vorgestellten Kennzahlensysteme für das IT-Controlling eines mittelständischen Automobilzulieferers und gibt Empfehlungen für die Praxis.
Schlüsselwörter
IT-Controlling, Kennzahlensystem, Automobilzulieferer, Du-Pont, Diebold, SVD, Statuskonzept, Entscheidungsgrundlagen, Informationsüberfluss, Unternehmenssteuerung, Transparenz.
- Quote paper
- Mehmet Gencsoy (Author), 2016, Kennzahlensystem für das IT-Controlling, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/320970