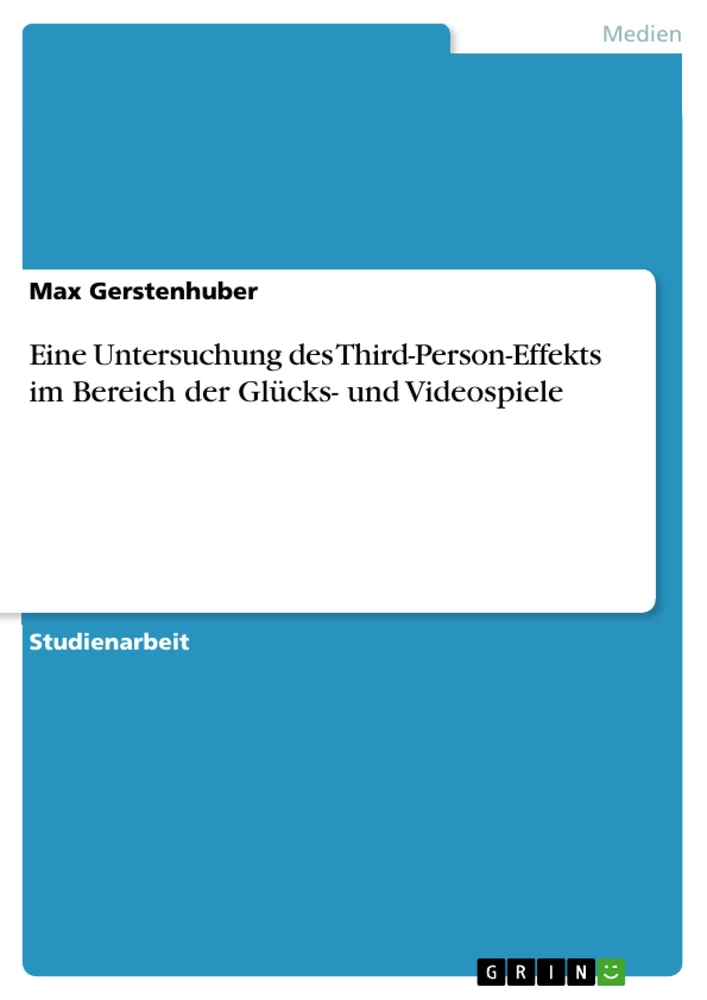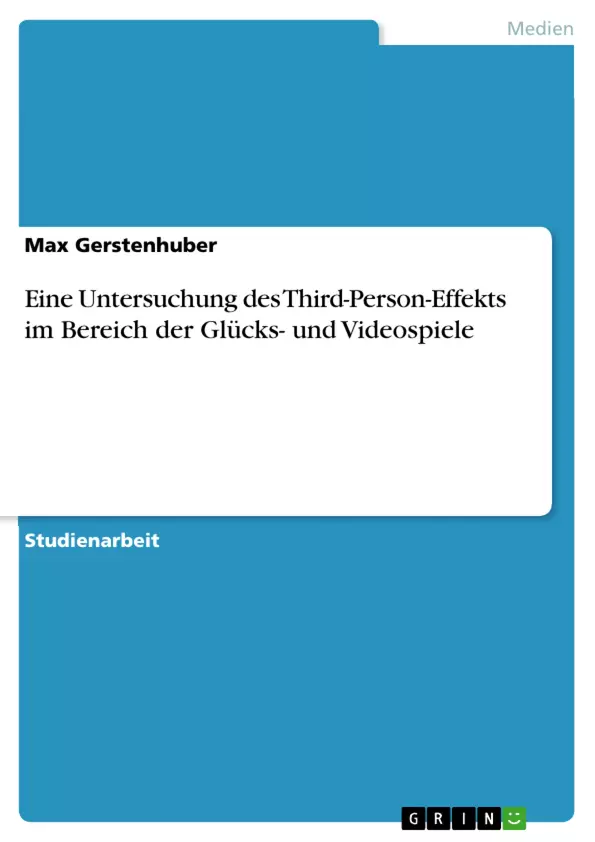Stand 2012 spielen 35 Prozent der Deutschen zumindest gelegentlich Video- und Computerspiele, was einen Anstieg von sieben Prozentpunkten seit 2008 bedeutet. Und gut acht Millionen Erwachsene in Deutschland spielen sogar mehrmals wöchentlich Videospiele. Diese Zahl hat sich damit alleine im Zeitraum von 2007 bis 2012 mehr als verdoppelt und entspricht mittlerweile einem Anteil von 11,4 Prozent an der erwachsenen Bevölkerung. Damit wird die Computer-und Videospielindustrie im diesem Jahr neuesten Hochrechnungen zufolge insgesamt 2,5 Milliarden Euro umsetzen.
Ähnliches ist auch bei dem Konsum von Glücksspielen zu beobachten. Alleine auf dem On-line-Glücksspielmarkt ist das weltweite Marktvolumen in den Jahren 2003 bis 2012 von 7,4 Milliarden US-Dollar auf schätzungsweise über 35 Milliarden US-Dollar angestiegen, was nahezu einer Verfünffachung entspricht. Und laut einer Forsa-Umfrage nahmen 2010 alleine zwei Millionen Deutsche an Glücksspielen im Internet teil.
Mit der wachsenden Bedeutung von Glücks- und Videospielen muss aber auch von einer sich ausweitenden Zahl der Spielsüchtigen ausgegangen werden. Das Hans-Bredow-Institut ermittelte in einer repräsentativen Studie 2011, dass sich 0,5 Prozent der deutschen erwachsenen Bevölkerung über dem Schwellenwert der Abhängigkeit befinden. Noch etwas höher fallen die Zahlen beim Glücksspiel aus: Laut der repräsentativ angelegten Bevölkerungsstudie PAGE mit über 15.000 Befragten ergibt sich 2011 ein Anteil der pathologischen Glücks-spieler von 0,9 Prozent an der erwachsenen deutschen Gesamtbevölkerung (vgl. Hans-Bredow-Institut; PAGE-Studie).
Viele der Spieler sind sich dieser Problematik durchaus bewusst. Das Thema Spielsucht ist nicht neu und auch in den Medien immer wieder präsent. Verschiedenste Studien in der Vergangenheit haben aber gezeigt, dass Individuen negative Effekte verschiedenster Medien auf andere als viel stärker einschätzen als auf sich selbst. Die Befragten halten Dritte beispielsweise für wesentlich leichter beeinflussbar durch den Konsum von gewalthaltigen Inhalten in der Musik, im Fernsehen und im Internet. Davon geht eine gewisse Gefahr aus, da die beschriebene Überschätzung der Wirkung auf andere oftmals mit einer starken Unterschätzung der Wirkung auf sich selbst einhergeht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Third-Person Effect
- 2.1 Entstehung und zentrale Annahmen
- 2.2 Der Third-Person Effect im Detail
- 2.3 Einflussvariablen der Wahrnehmungsdifferenz
- 2.4 Kategorien des TPB
- 3. Ergebnisse
- 3.1 Studien zum Glücksspiel
- 3.2 Studien zu Computer- und Videospielen
- 3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4. Kritik
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Third-Person Effect (TPE) im Kontext des Konsums von Glücksspielen und Videospielen. Die Hauptziele sind es, den TPE zu erläutern, die Ergebnisse relevanter Studien zu präsentieren und kritisch zu bewerten, um daraus Schlussfolgerungen für zukünftige Forschung und Verständnis zu ziehen.
- Der Third-Person Effect und seine zentralen Annahmen
- Der Einfluss des TPE auf die Wahrnehmung von Glücksspiel und Videospielkonsum
- Studienanalysen zum TPE in Bezug auf Glücksspiele und Videospiele
- Einflussfaktoren auf die Wahrnehmungsdifferenz beim TPE
- Kritische Bewertung der bisherigen Forschungsergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die steigende Popularität von Videospielen und Glücksspielen in Deutschland und verweist auf die damit verbundene Problematik der Spielsucht. Sie führt in die Thematik des Third-Person Effects ein, der die Tendenz beschreibt, die negativen Auswirkungen von Medien auf andere stärker einzuschätzen als auf die eigene Person. Die Arbeit untersucht, ob dieser Effekt auch im Kontext von Glücksspielen und Videospielen auftritt und welche Verhaltensänderungen daraus resultieren könnten.
2. Der Third-Person Effect: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und zentralen Annahmen des Third-Person Effects (TPE). Es wird detailliert auf die zwei Grundannahmen eingegangen: die Wahrnehmungsdifferenz (Third-Person-Perception, TPP) und die Verhaltenskomponente (Third-Person-Behavior, TPB). Es werden relevante Einflussvariablen, wie die Distanz zur betroffenen Person, erläutert und in den wissenschaftlichen Kontext des Influence of Presumed Media Influence-Ansatzes (IPI) eingeordnet. Ein Beispiel verdeutlicht den TPE anhand des Konsums von Computer- und Videospielen sowie Glücksspielen.
Schlüsselwörter
Third-Person Effect, Glücksspiel, Videospiele, Spielsucht, Medienwirkung, Wahrnehmungsdifferenz, Verhaltenskomponente, Einflussvariablen, Kommunikationswissenschaft, Studienanalyse, kritische Bewertung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Der Third-Person Effect im Kontext von Glücksspielen und Videospielen
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Third-Person Effect (TPE) im Kontext des Konsums von Glücksspielen und Videospielen. Sie analysiert, ob und wie dieser Effekt die Wahrnehmung und das Verhalten von Individuen in Bezug auf diese Medien beeinflusst.
Was ist der Third-Person Effect (TPE)?
Der TPE beschreibt die Tendenz, die negativen Auswirkungen von Medien auf andere stärker einzuschätzen als auf die eigene Person. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und zentralen Annahmen des TPE, insbesondere die Wahrnehmungsdifferenz (TPP) und die Verhaltenskomponente (TPB), sowie relevante Einflussvariablen wie die Distanz zur betroffenen Person.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Hauptziele sind die Erläuterung des TPE, die Präsentation und kritische Bewertung relevanter Studien zum TPE im Kontext von Glücksspielen und Videospielen sowie das Ziehen von Schlussfolgerungen für zukünftige Forschung und ein besseres Verständnis des Themas.
Welche Studien werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert Studien zum TPE im Bezug auf Glücksspiele und Computer- und Videospiele. Die Ergebnisse dieser Studien werden zusammengefasst und kritisch bewertet.
Welche Einflussfaktoren auf die Wahrnehmungsdifferenz beim TPE werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Einflussfaktoren, die die Wahrnehmungsdifferenz beim TPE beeinflussen können. Die Distanz zur betroffenen Person ist ein Beispiel für einen solchen Faktor.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Third-Person Effect, ein Kapitel mit den Ergebnissen relevanter Studien, ein Kapitel mit Kritikpunkten und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Third-Person Effect, Glücksspiel, Videospiele, Spielsucht, Medienwirkung, Wahrnehmungsdifferenz, Verhaltenskomponente, Einflussvariablen, Kommunikationswissenschaft, Studienanalyse, kritische Bewertung.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den analysierten Studien und der kritischen Bewertung des TPE im Kontext von Glücksspielen und Videospielen. Diese Schlussfolgerungen sollen das Verständnis des Themas verbessern und zukünftige Forschung anregen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Medienwirkung, insbesondere im Kontext von Glücksspielen und Videospielen, interessieren. Sie bietet einen umfassenden Überblick über den Third-Person Effect und seine Relevanz in diesem Bereich.
Wo finde ich weitere Informationen zum Third-Person Effect?
Weitere Informationen zum Third-Person Effect finden Sie in der wissenschaftlichen Literatur zur Kommunikationswissenschaft und Medienpsychologie. Die Arbeit selbst bietet eine umfassende Literaturgrundlage und weiterführende Hinweise.
- Quote paper
- Max Gerstenhuber (Author), 2012, Eine Untersuchung des Third-Person-Effekts im Bereich der Glücks- und Videospiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/318896