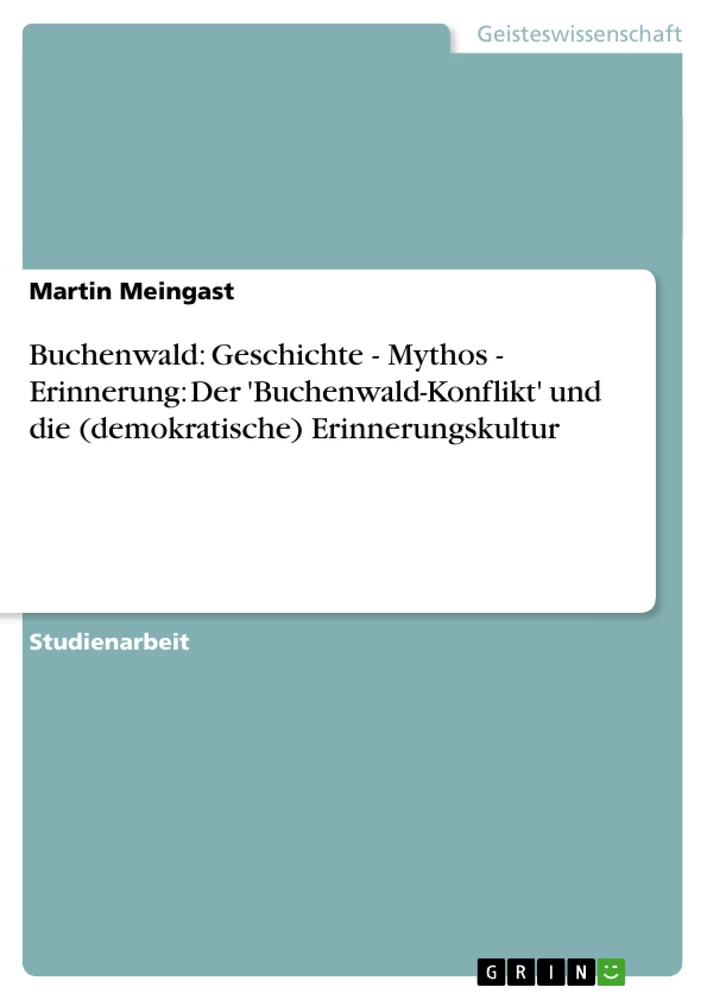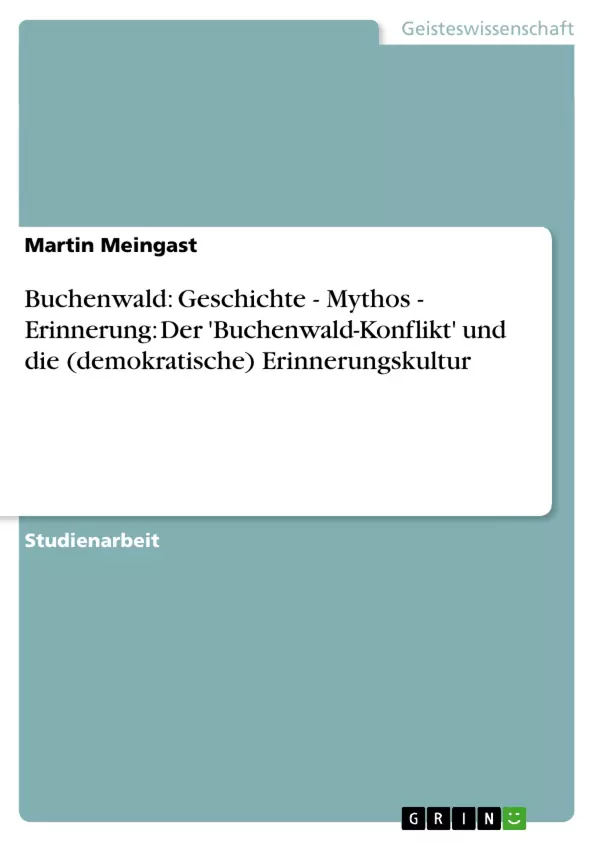Nach der Wende 1989/1990 begann eine (zuerst auf die direkt betroffenen Institutionen wie Opferverbände und Region begrenzte, später aber bundesweite) Debatte um die Aufarbeitung und angemessene Erinnerung an das Grauen der Nationalsozialisten im Konzentrationslager Buchenwald und die Nutzung des Lagers durch die sowjetischen Besatzer nach dem zweiten Weltkrieg. Diese Debatte verdeutlicht bei genauerer Betrachtung, was 40 Jahre kommunistische, bzw. sozialistische Erinnerungskultur auch heute noch für Auswirkungen auf das Geschichtsbild in den neuen Bundesländern haben. Der staatlich verordnete Antifaschismus in der ehemaligen DDR führte zu einer Verwischung, Manipulation und Uminterpretation der Vergangenheit, deren Spuren heute noch großes Konfliktpotential bieten und den korrekten, aufgeklärten Umgang mit der Vergangenheit erschweren. Doch wie kommt es zu einer solchen Geschichtsmanipulation? Warum wird die Auseinandersetzung um die Vergangenheit teilweise so emotional geführt? Und warum ist sie so wichtig für unsere heutige Gesellschaft?
Um eine Beantwortung dieser Fragen zu ermöglichen, müssen sowohl theoretische als auch inhaltliche Grundlagen geschaffen werden – dies soll das Ziel der nächsten Kapitel sein. Nach dem Kapitel „Die Geschichte der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte der DDR“ werden dann der Themenkomplex ‚Gründungsmythos Buchenwald’ thematisiert, während zum Schluss des Kapitels „Die Wende 1989/90 und die öffentliche Debatte über die Geschichte Buchenwalds“ die Bedeutung der Debatte in einer demokratischen Erinnerungskultur erörtert werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Geschichte und Erinnerung
- Die Geschichte des KZ
- Die Geschichte des Speziallager Nr. 2
- Die Geschichte der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte der DDR
- Gründungsmythos, Buchenwald'
- Die Wende 1989/90 und die öffentliche Debatte über die Geschichte Buchenwalds
- Die selektive Wahrnehmung und Erinnerung
- Die öffentliche Debatte im Rahmen einer demokratischen Erinnerungskultur
- Schlussbemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Debatte um die Erinnerung an das Konzentrationslager Buchenwald nach der Wende 1989/90 und untersucht die Auswirkungen der 40 Jahre dauernden kommunistischen Erinnerungskultur in der ehemaligen DDR auf das heutige Geschichtsbild. Die Arbeit beleuchtet den Konflikt zwischen den unterschiedlichen Perspektiven auf die Vergangenheit und die Bedeutung der öffentlichen Debatte im Kontext einer demokratischen Erinnerungskultur.
- Die Konstruktion von Geschichte und Erinnerung
- Die Rolle des "Gründungsmythos Buchenwald" in der DDR-Propaganda
- Die selektive Wahrnehmung der Geschichte Buchenwalds in der ehemaligen DDR
- Die öffentliche Debatte um die Aufarbeitung der Vergangenheit nach der Wende
- Die Bedeutung der demokratischen Erinnerungskultur für den Umgang mit der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Problematik der Debatte um Buchenwald und die Auswirkungen der sozialistischen Erinnerungskultur auf die heutige Gesellschaft. Das Kapitel "Theorie" behandelt die wissenschaftlichen Grundlagen der Begriffe Geschichte und Erinnerung und erläutert deren Bedeutung für die Analyse der Geschichte Buchenwalds. Das Kapitel "Die Geschichte des KZ" präsentiert einen Überblick über die Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald von seiner Errichtung 1937 bis zur Befreiung durch die US-Armee 1945.
Schlüsselwörter
Erinnerungskultur, Buchenwald, KZ, Speziallager, DDR, Geschichte, Mythos, Wende 1989/90, öffentliche Debatte, demokratische Erinnerungskultur, Geschichtsmanipulation, selektive Wahrnehmung.
- Arbeit zitieren
- Martin Meingast (Autor:in), 2004, Buchenwald: Geschichte - Mythos - Erinnerung: Der 'Buchenwald-Konflikt' und die (demokratische) Erinnerungskultur, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/31863