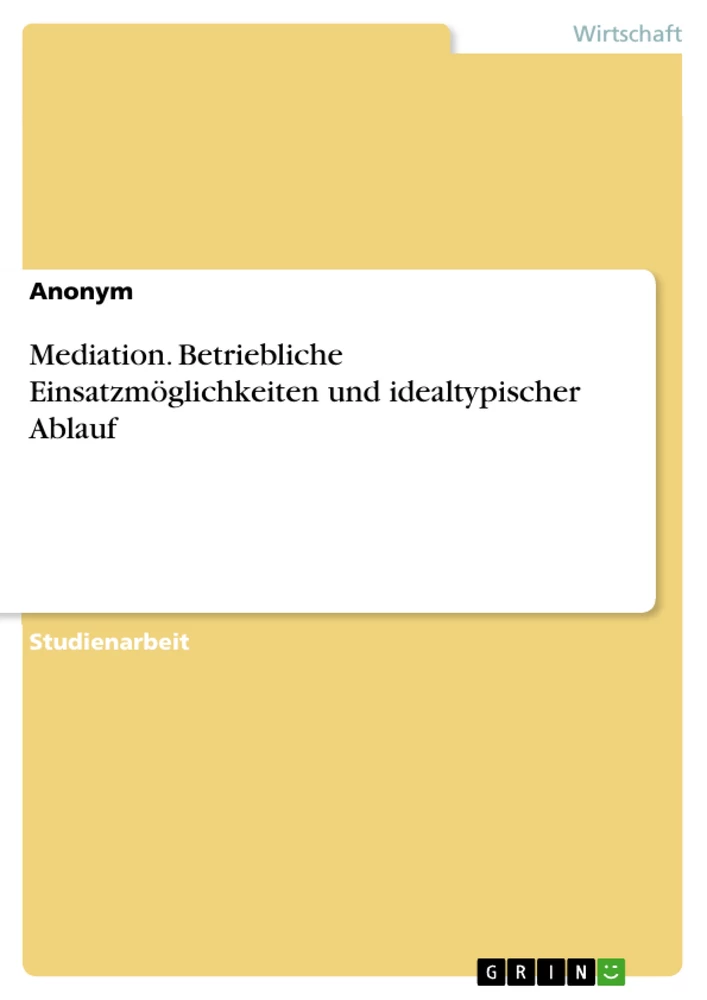Jeder Mensch kommt im Laufe seines Lebens mit zahlreichen unterschiedlichen Konflikten in Berührung. Doch wer denkt, Konflikte seien grundsätzlich negativ, der irrt sich. Konflikte sind bei erfolgreicher Auseinandersetzung sogar sinnvoll und notwendig, da sie zu einer Weiterentwicklung beitragen.
Nicht nur Menschen entwickeln sich weiter, sondern auch Unternehmen, die dadurch erst wettbewerbsfähig werden. Eine Möglichkeit zur Konfliktlösung bietet die Methode der Mediation. Deren Ursprünge basieren auf Traditionen in der Volksrepublik China, die dann durch chinesische Einwanderer in Nordamerika weiter praktiziert und verbreitet wurden. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen führten schließlich auch in Deutsch-land zu der Anwendung einer alternativen Konfliktlösung, zuerst im Familien- und Umweltbereich, später jedoch auch vermehrt im Arbeitsalltag.
Die vorliegende Arbeit liefert einen Überblick über die theoretischen Grundlagen der Mediation und beschreibt die betrieblichen Einsatzmöglichkeiten und den idealtypischen Ablauf.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen der Mediation
- Begriffsklärung und Einordnung der Mediation
- Grundprinzipien der Mediation
- Möglichkeiten und Grenzen der Mediation
- Betriebliche Einsatzmöglichkeiten der Mediation
- Beschreibung eines idealtypischen Ablaufs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit analysiert das Einsatzpotential von Mediation in Unternehmen und beleuchtet den idealtypischen Ablauf. Die Arbeit zielt darauf ab, das Verständnis für Mediation als Konfliktlösungsstrategie zu fördern und ihre praktische Anwendung in betrieblichen Kontexten aufzuzeigen.
- Begriffsklärung und Einordnung von Mediation
- Grundprinzipien der Mediation, z.B. Freiwilligkeit, Eigenverantwortung
- Vorteile und Grenzen von Mediation im betrieblichen Kontext
- Mögliche Einsatzgebiete der Mediation in Unternehmen
- Idealtypischer Ablauf eines Mediationsprozesses
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema Mediation und seine Bedeutung im Kontext von Konflikten vor. Anschließend werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der Mediation erörtert, einschließlich ihrer Definition, ihrer Grundprinzipien und ihrer Möglichkeiten und Grenzen. Kapitel 3 widmet sich den Einsatzmöglichkeiten der Mediation in Unternehmen und stellt verschiedene Anwendungsgebiete vor. Kapitel 4 beschreibt den idealtypischen Ablauf eines Mediationsprozesses.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Mediation, Konfliktlösung, betriebliche Anwendung, Grundprinzipien, Einsatzmöglichkeiten und Ablauf des Mediationsprozesses.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Mediation?
Mediation ist ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konflikts, bei dem eine neutrale dritte Person (der Mediator) die Parteien begleitet.
Woher stammt die Methode der Mediation ursprünglich?
Die Ursprünge liegen in Traditionen der Volksrepublik China, die später in Nordamerika weiterentwickelt und verbreitet wurden.
Welche Grundprinzipien gelten in einer Mediation?
Zu den wichtigsten Prinzipien gehören Freiwilligkeit, Eigenverantwortung der Konfliktparteien, Vertraulichkeit und die Allparteilichkeit des Mediators.
In welchen Bereichen wird Mediation in Unternehmen eingesetzt?
Sie findet Anwendung bei Konflikten zwischen Mitarbeitern, zwischen Führungskräften und Teams oder auch bei strukturellen Veränderungen im Arbeitsalltag.
Wie läuft ein Mediationsprozess idealtypisch ab?
Der Prozess folgt meist Phasen von der Einleitung über die Themensammlung und Interessenklärung bis hin zur Erarbeitung und schriftlichen Fixierung einer Vereinbarung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Mediation. Betriebliche Einsatzmöglichkeiten und idealtypischer Ablauf, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/313563