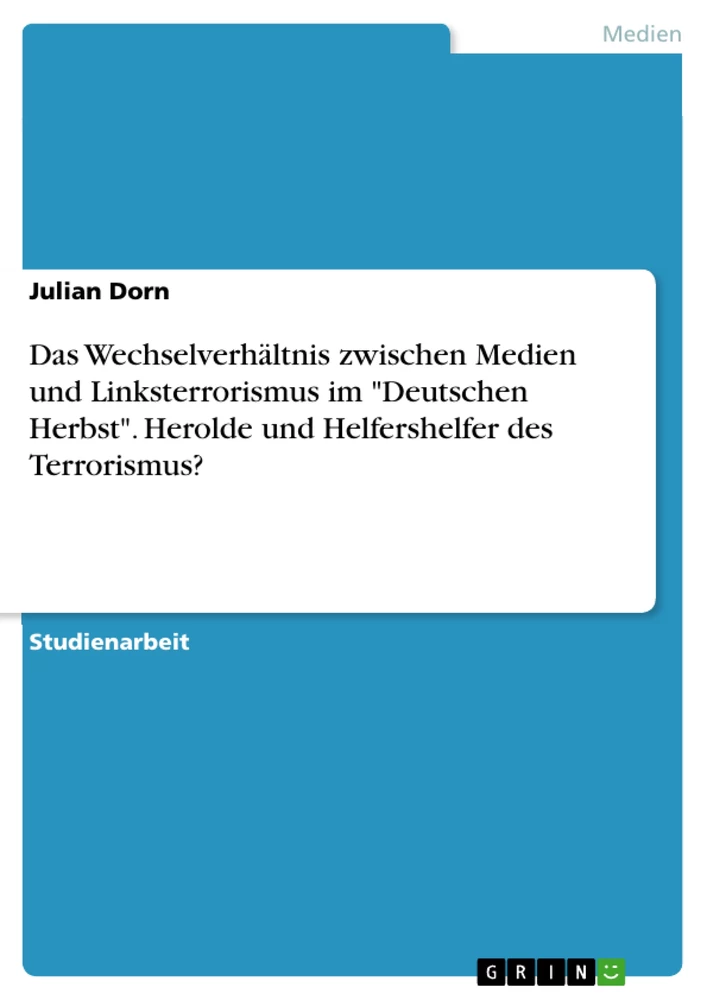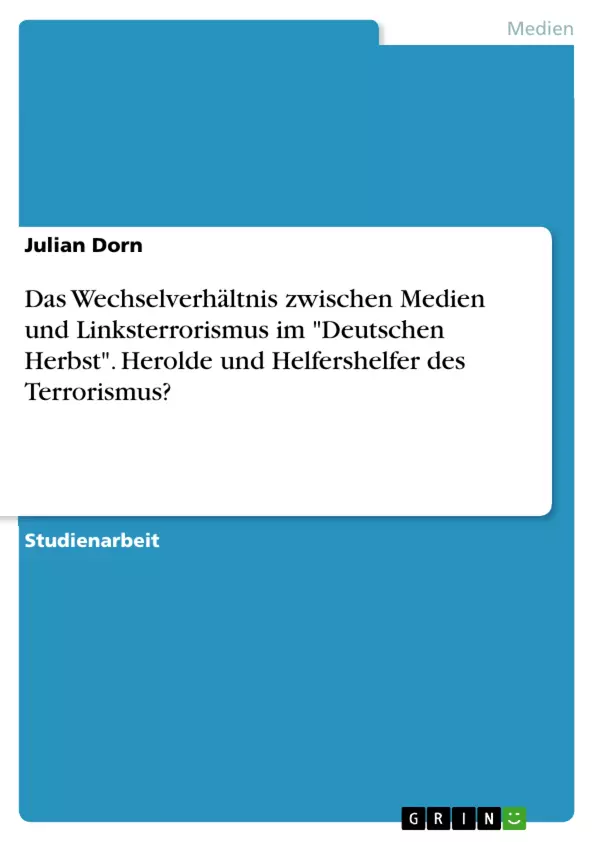„Eine inszenatorische Qualität der Ereignisse“ bescheinigt der Journalist Andreas Elter den islamistisch-fundamentalistischen Anschlägen des 11. Septembers auf das World Trade Center in New York und charakterisiert damit eine neue Dimension des Terrorismus, dem nun eine weltumspannende Aufmerksamkeit zuteil wird. Terroranschläge gelten nie nur den Opfern, sie zielen immer auch auf die Gesellschaft in toto ab. Diese intendierte Öffentlichkeitswirksamkeit wird jedoch erst durch die Multiplikatorwirkung moderner Massenmedien ermöglicht.
Terroristische Gruppierungen haben längst realisiert, wie entscheidend die Medien für die Genese flächendeckender Aufmerksamkeit sind und haben daher begonnen, diese Kanäle zu nutzen, um mit minimalem Aufwand maximalen Schrecken zu verbreiten. Das aktuell brisante islamistische Bedrohungsszenario durch den Islamischen Staat (IS) bestätigt dies: Mit massenmedial inszenierten Videos der Enthauptungen westlicher Journalisten instrumentalisieren die Extremisten die globale Vernetzung durch das Internet zu propagandistischen Zwecken – und sorgen so gleichzeitig dafür, dass sich die Bilder im kollektiven Gedächtnis einprägen.
Der amerikanische Historiker und Publizist Walter Laqueur versuchte sich bereits im Jahr 1977 an einer Bestimmung des funktionalen Verhältnisses zwischen Massenmedien und Terrorismus und konstatierte in diesem Zusammenhang: “The success of a terrorist operation depends almost entirely on the amount of publicity it receives. (…) The terrorist’s act by itself is nothing, publicity is all.”
Wie jede Form der Kommunikation bedarf auch die terroristische der Vermittlung, woraus sich nun die Schnittstelle zwischen Terrorismus und Massenmedien ergibt: Die in der Gewalttat codierte ideologische Botschaft muss durch den medialen Distributionskanal flächendeckend verbreitet werden, um das Maximum der intendierten psychologischen Wirkung zu erzielen. Dabei entsteht jedoch gleichermaßen der Eindruck, dass auch die Medien ökonomisch erheblich von spektakulären Terroranschlägen profitieren, da sich mit solchen Ereignissen die Auflagenzahl potenzieren lässt.
Daraus ergibt sich nun ein komplexer Zusammenhang wechselseitiger Abhängigkeiten. Diese symbiotischen Wechselwirkungen und die Charakterisierung des Verhältnisses zwischen Massenmedien und Terrorismus stehen nun im Zentrum der folgenden Betrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Operationalisierungen und theoretische Zugänge
- Definition des Begriffs „Massenmedien“
- Das Mediensystem der BRD in den siebziger Jahren
- Der Terrorismus-Begriff
- Das Wechselverhältnis zwischen RAF und den Medien 1977
- Das terroristische Rollenverständnis von den Medien
- Das ambivalente Verhältnis der RAF zu den Medien: Zwischen Dämonisierung und Instrumentalisierung
- Der Umgang der RAF mit den Medien
- Verhalten der Medien und des Staates gegenüber der RAF
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das wechselseitige Verhältnis zwischen der Roten Armee Fraktion (RAF) und den deutschen Medien während des Deutschen Herbstes 1977. Die Arbeit analysiert die Erwartungen der RAF an die Medien, die Rolle der Medien aus terroristischer Perspektive und bewertet die „unheilvolle Allianz“ zwischen Terroristen und Medien. Das Ziel ist es, das komplexe Wechselspiel zwischen Medien und Terrorismus zu beleuchten und zu hinterfragen, ob die Medien tatsächlich als „Helfer und Herolde des Terrorismus“ fungierten.
- Die Definition von Massenmedien und das Mediensystem der BRD in den 1970er Jahren.
- Das terroristische Rollenverständnis der RAF und ihre Strategien im Umgang mit den Medien.
- Die ambivalente Beziehung der RAF zu den Medien: Instrumentalisierung und Dämonisierung.
- Die Reaktion der deutschen Medien und des Staates auf den Linksterrorismus.
- Eine kritische Bewertung der These von der „unheilvollen Allianz“ zwischen Medien und RAF.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Terrorismus und Medien in einem komplexen, wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Terroristen nutzen die Medien zur Verbreitung ihrer Botschaft und zur Erzielung maximaler psychologischer Wirkung, während Medien von spektakulären Ereignissen profitieren. Am Beispiel des Deutschen Herbstes 1977 und der RAF wird dieses Verhältnis untersucht. Die Arbeit fragt nach den Erwartungen der RAF an die Medien und der Rolle der Medien im Kontext des Linksterrorismus.
Operationalisierungen und theoretische Zugänge: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Massenmedien“ und beleuchtet das bundesdeutsche Mediensystem der 1970er Jahre. Es diskutiert verschiedene Terrorismus-Definitionen und die historische Entwicklung des Begriffs „Masse“, der oft negativ konnotiert ist und mit Manipulierbarkeit und Beeinflussbarkeit verbunden wird. Die Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Verhältnisses zwischen RAF und Medien. Es wird auf die Ambivalenz des Massenbegriffs und seine negative Konnotation eingegangen.
Das Wechselverhältnis zwischen RAF und den Medien 1977: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert die Erwartungen der RAF an die Medien, ihre Strategie der Mediennutzung und das Verhalten der Medien im Deutschen Herbst. Es wird untersucht, inwiefern die Medien die terroristischen Rollenvorstellungen erfüllten und ob von einer „unheilvollen Allianz“ gesprochen werden kann. Die Analyse umfasst die mediale Darstellung der RAF in verschiedenen Presseorganen und untersucht mögliche Unterschiede zwischen links- und rechtsgerichteten Medien. Die RAF instrumentalisierte die Medien gezielt, um ihre Botschaften zu verbreiten und maximale Aufmerksamkeit zu erlangen. Der Umgang der Medien mit der RAF ist komplex und ambivalent.
Schlüsselwörter
Rote Armee Fraktion (RAF), Deutscher Herbst 1977, Linksterrorismus, Massenmedien, Mediensystem BRD, Terrorismus, Medienwirkung, Propaganda, Medienrepräsentation, öffentliche Meinung, Instrumentalisierung, Dämonisierung, „unheilvolle Allianz“.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: RAF und Medien im Deutschen Herbst 1977
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das komplexe Wechselverhältnis zwischen der Roten Armee Fraktion (RAF) und den deutschen Medien während des Deutschen Herbstes 1977. Im Fokus steht die Analyse der gegenseitigen Erwartungen und Strategien, sowie die Bewertung der oft diskutierten „unheilvollen Allianz“ zwischen Terroristen und Medien.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Wechselspiel zwischen Medien und Terrorismus zu beleuchten und die Frage zu beantworten, ob die Medien tatsächlich als „Helfer und Herolde des Terrorismus“ fungierten. Es werden die Strategien der RAF im Umgang mit den Medien analysiert und die Reaktionen der Medien und des Staates kritisch bewertet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Massenmedien und das Mediensystem der BRD der 1970er Jahre, das terroristische Rollenverständnis der RAF und ihre Medienstrategien (Instrumentalisierung und Dämonisierung), die Reaktion der Medien und des Staates auf den Linksterrorismus, sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der These der „unheilvollen Allianz“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Operationalisierungen und theoretischen Zugängen, ein Kernkapitel zum Wechselverhältnis zwischen RAF und Medien 1977 und ein Fazit. Die Einleitung formuliert die zentrale These, während das zweite Kapitel die theoretischen Grundlagen legt. Das dritte Kapitel analysiert das Verhältnis im Detail, und das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Was wird im Kapitel "Operationalisierungen und theoretische Zugänge" behandelt?
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Massenmedien“, beleuchtet das bundesdeutsche Mediensystem der 1970er Jahre und diskutiert verschiedene Terrorismus-Definitionen. Es werden auch die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Verhältnisses zwischen RAF und Medien gelegt, inklusive einer Auseinandersetzung mit der Ambivalenz des Massenbegriffs.
Was ist der Inhalt des Kernkapitels (Wechselverhältnis zwischen RAF und Medien 1977)?
Das Kernkapitel analysiert die Erwartungen der RAF an die Medien, ihre Strategie der Mediennutzung und das Verhalten der Medien während des Deutschen Herbstes. Es untersucht die Erfüllung terroristischer Rollenvorstellungen durch die Medien und die Frage nach einer „unheilvollen Allianz“. Die Analyse umfasst die mediale Darstellung der RAF in verschiedenen Presseorganen und mögliche Unterschiede zwischen links- und rechtsgerichteten Medien.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Rote Armee Fraktion (RAF), Deutscher Herbst 1977, Linksterrorismus, Massenmedien, Mediensystem BRD, Terrorismus, Medienwirkung, Propaganda, Medienrepräsentation, öffentliche Meinung, Instrumentalisierung, Dämonisierung, „unheilvolle Allianz“.
Welche These wird in der Einleitung aufgestellt?
Die Einleitung stellt die These auf, dass Terrorismus und Medien in einem komplexen, wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Terroristen nutzen die Medien zur Verbreitung ihrer Botschaft und maximaler psychologischer Wirkung, während Medien von spektakulären Ereignissen profitieren. Am Beispiel des Deutschen Herbstes 1977 und der RAF wird dieses Verhältnis untersucht.
Wie wird die "unheilvolle Allianz" zwischen RAF und Medien bewertet?
Die Arbeit untersucht kritisch die These von der „unheilvollen Allianz“. Es wird analysiert, inwieweit die Medien die terroristischen Rollenvorstellungen erfüllten und ob diese Allianz tatsächlich bestand. Die Analyse berücksichtigt dabei die verschiedenen Perspektiven und die Komplexität des Verhältnisses.
- Quote paper
- Julian Dorn (Author), 2015, Das Wechselverhältnis zwischen Medien und Linksterrorismus im "Deutschen Herbst". Herolde und Helfershelfer des Terrorismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/312900