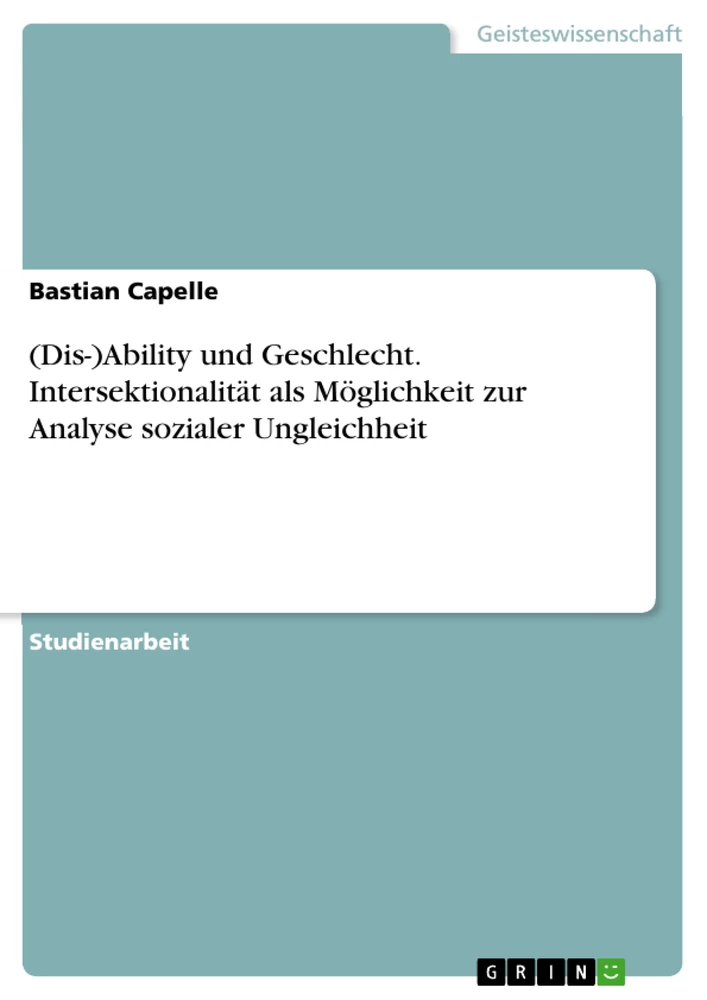Die Arbeit beleuchtet zum einen die Grundzüge des Paradigmas Intersektionalität, als auch den aktuellen Stand der (primär deutschlandweiten) Intersektionalitätsdebatte. Hierbei wird insbesondere auf die Problematik einer Untersuchung und Analyse verschiedener Ungleichheitsdimensionen eingegangen, welche im Sinne des Intersektionalitätsgedankens in wechselseitigen Beziehungen zueinander betrachtet werden müssen.
Zum anderen wird der Fokus auf die interdependenten Strukturkategorien Geschlecht und (Dis-)Ability gelegt, an deren Beispiel eine intersektionale Betrachtungsweise nahegebracht werden sollen.
Das heute vorherrschende (Sozialisations-)System der (gerade westlichen) Gesellschaften ist durch einen Rahmen der globalisierten Ökonomie bestimmt, welche primär den Menschen als Individuum und somit als eigenständig (zu) leistendes Subjekt definiert. Somit nimmt der Selbstbestimmungsgedanke eine wesentliche Rolle innerhalb der sozialen Interaktion ein (WALDSCHMIDT, 2012). Es wird eine bestimmte Art der Lebensführung in den Mittelpunkt gerückt, bei der davon ausgegangen wird, dass der Mensch sowohl autonom leben will als auch autonom handeln soll. Dieser Autonomiegedanke gilt jedoch offensichtlich nicht für alle Individuen innerhalb dieses Gesellschaftssystems.
Zu dieser angesprochenen Gruppe lassen sich nicht zuletzt, von dem Medizin- und Gesundheitssektor ausgehend und über alle gesellschaftlichen Bereiche weiterführend, „psychisch verwirrte, geistig behinderte und schwerstbehinderte Menschen“ (ebd. S. 12, nach SINGER (1984), SASS (1986) u.a.) zählen. Hier wird also offensichtlich die Gesellschaft, wenn auch zu ungleichen Teilen, in zwei Gruppen unterteilt. Als Ursache fungiert innerhalb dieses Mechanismus die Differenzkategorie ‚Behinderung’, welche der Kategorie ‚Nichtbehinderung’ gegenübersteht.
Diese zwei Kategorien, im weiteren Verlauf als „Ability“ und „Disability“ bezeichnet, stehen innerhalb des gesellschaftlichen Systems allerdings nicht allein und können somit auch nicht vereinzelt untersucht werden.
Die vorliegende Arbeit orientiert sich an dem Vorgehen intersektionaler Ansätze, welche Differenz- und Ungleichheitskategorien wie (Dis-)Ability, Ethnizität, „Rasse“, Geschlecht oder Klasse interdependent begreifen und somit resultierende (je nach Ort und Situation möglicherweise variable) spezifische Formen von Diskriminierungen und Ungleichheiten sowie deren mögliche Entstehungsprozesse analysieren (WOLLRAD & JACOB & KÖBSELL, 2010).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Intersektionalität
- 1.1 (Struktur-)Kategorie (Dis-)Ability
- 1.2 (Struktur-)Kategorie Geschlecht
- 1.3 Geschlecht und (Dis-)Ability
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beschäftigt sich mit dem Konzept der Intersektionalität und untersucht, wie es zur Analyse sozialer Ungleichheit, insbesondere im Bezug auf (Dis-)Ability und Geschlecht, eingesetzt werden kann. Das Hauptziel ist es, zu demonstrieren, wie diese Kategorien miteinander verwoben sind und zu spezifischen Formen von Diskriminierung und Ungleichheit führen können.
- Die Bedeutung des Intersektionalitätsansatzes zur Analyse sozialer Ungleichheit
- Die Interdependenz von (Dis-)Ability, Geschlecht und anderen Differenzkategorien
- Die Entstehungsprozesse spezifischer Formen von Diskriminierung
- Die Machtverhältnisse und Herrschaftsstrukturen im Kontext des Kapitalismus
- Die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen Ungleichheitskategorien zu untersuchen, anstatt sie einfach zu addieren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt das vorherrschende (Sozialisations-)System der heutigen Gesellschaft, das von der globalisierten Ökonomie geprägt ist. Es wird die Rolle des Autonomiegedankens im Kontext sozialer Interaktion und die Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen im Hinblick auf Autonomie und Selbstbestimmung beleuchtet. Der Text argumentiert, dass die Kategorie "Behinderung" nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern in Verbindung mit anderen Differenzkategorien wie Geschlecht und Klasse steht.
Intersektionalität
Dieser Abschnitt behandelt die Entstehung und Entwicklung der Intersektionalitätsdebatte, insbesondere in den USA, wo Schwarze Frauen die mangelnde Repräsentation in feministischen Bewegungen kritisierten. Es werden die Beiträge von Kimberley Crenshaw und das Konzept der "Intersectionality" vorgestellt und mit Hilfe von Gerichtsfällen illustriert, wie die Verwebung verschiedener Ungleichheitskategorien zu spezifischen Formen von Diskriminierung führt.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Intersektionalität?
Intersektionalität beschreibt die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen (wie Geschlecht, Behinderung, Ethnizität), die zusammen spezifische Formen sozialer Ungleichheit erzeugen.
Wie hängen (Dis-)Ability und Geschlecht zusammen?
Die Arbeit zeigt auf, dass behinderte Frauen oft andere Formen der Diskriminierung erfahren als behinderte Männer oder nicht-behinderte Frauen, da sich beide Kategorien gegenseitig beeinflussen.
Welche Rolle spielt der Autonomiegedanke in unserer Gesellschaft?
In westlichen Gesellschaften gilt Autonomie als Ideal; Menschen mit Behinderungen wird diese Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedoch oft abgesprochen, was zu Exklusion führt.
Warum reicht es nicht aus, Ungleichheiten einfach zu addieren?
Der Intersektionalitätsansatz betont, dass die Verwebung der Kategorien etwas qualitativ Neues schafft, das durch eine rein additive Betrachtung nicht erfasst werden kann.
Woher stammt die Intersektionalitätsdebatte ursprünglich?
Sie entstand primär in den USA aus der Kritik Schwarzer Feministinnen (wie Kimberlé Crenshaw), die sich weder im weißen Feminismus noch in der Bürgerrechtsbewegung voll repräsentiert sahen.
- Arbeit zitieren
- Bastian Capelle (Autor:in), 2015, (Dis-)Ability und Geschlecht. Intersektionalität als Möglichkeit zur Analyse sozialer Ungleichheit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/310603